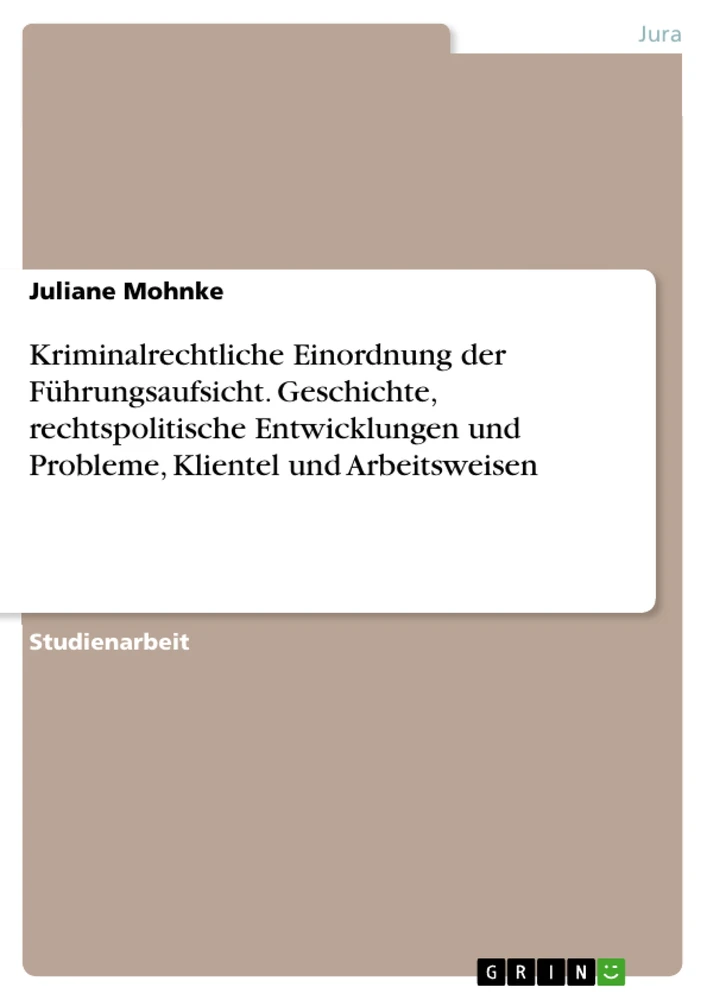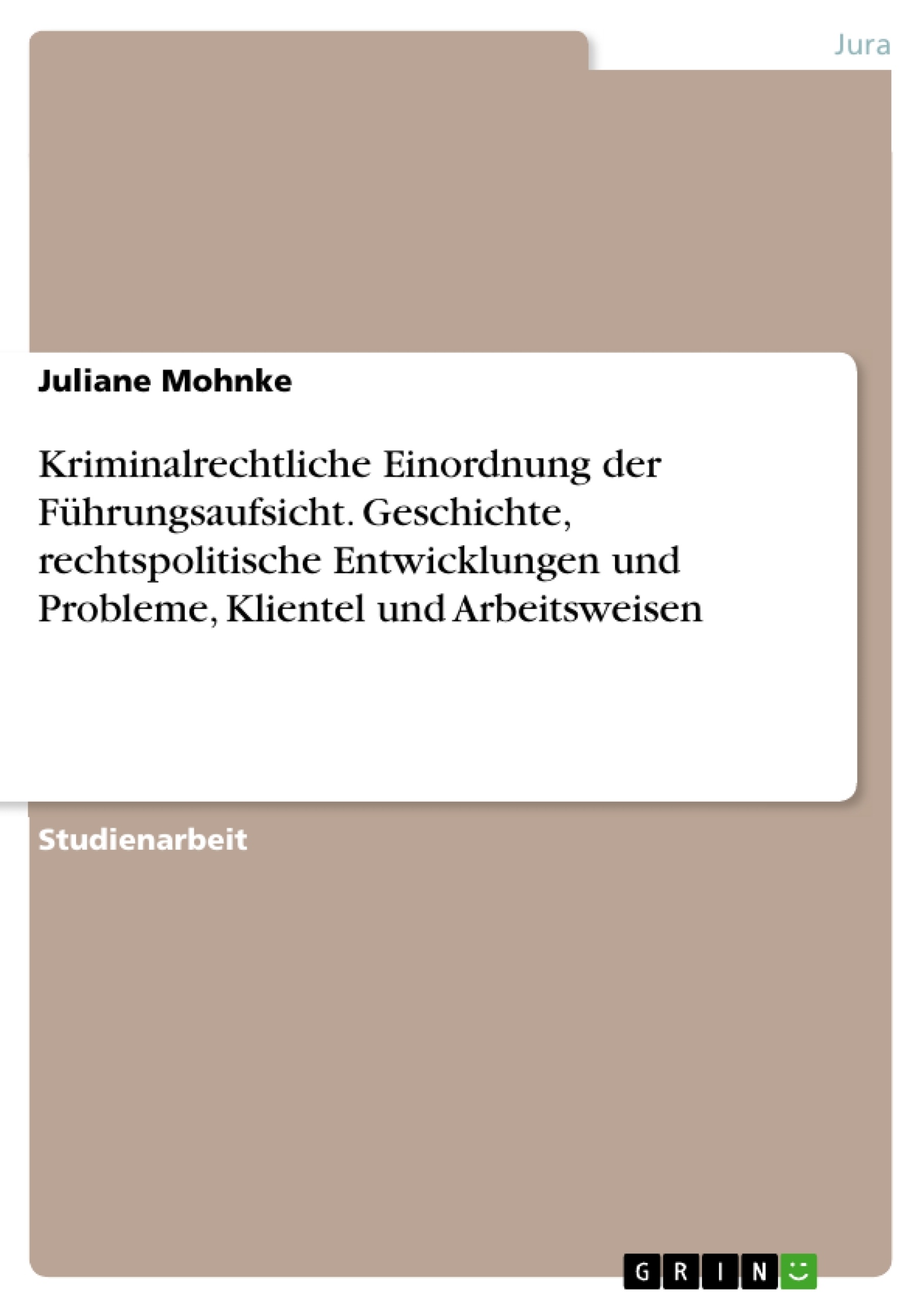Gegenstand dieser Arbeit ist die Maßregel Führungsaufsicht. Als erstes wird dem Leser ein kurzer Überblick über die Einordnung der Führungsaufsicht in das kriminalrechtliche Sanktionensystem gegeben. Danach folgt ein Blick in die Entstehungsgeschichte und die rechtspolitische Entwicklung der Führungsaufsicht. Anschließend werden die Probleme der Klientel, insbesondere die Rückfälligkeit einiger Tätergruppen, aufgezeigt. Außerdem wird dargestellt, wie viele unterschiedliche Tätergruppen und die damit einhergehenden unterschiedlichen Anordnungsmöglichkeiten der Führungsaufsicht es gibt. Nachdem die Seite der Klientel ausführlich veranschaulicht wurde, wird die Arbeitsweise der Führungsaufsichtsstellen und die mit ihnen zusammenarbeiteten Organe näher beleuchtet sowie abschließend auf die Arbeitsweise in Mecklenburg-Vorpommern und deren Entwicklung eingegangen.
Das heutige Strafrecht soll den Straftäter nicht durch eine Strafe verurteilen, um dem Schuldausgleich gerecht zu werden, vielmehr soll es darüber hinaus auch einen präventiven Zweck verfolgen, um den Schutz der Allgemeinheit zu gewährleisten. Aufgrund dieses zweiten, präventiven Zweckes wurde im Zuge des 2. Strafrechtsreformgesetzes im Januar 1975 die Führungsaufsicht als Maßregel der Besserung und Sicherung in das Strafgesetzbuch aufgenommen.
Mit dieser Maßregel wird bezweckt, gefährliche oder gefährdete Täter bei der Gestaltung ihres Lebens in der Freiheit über gewisse kritische Zeiträume hinweg zu unterstützen und zu betreuen sowie sie zu überwachen, um sie von künftigen Straftaten abzuhalten. Die Führungsaufsicht hat also eine Doppelfunktion. Mit ihr sollen sowohl Resozialisierungshilfe gewährt als auch Sicherungsaufgaben zum Schutz der Allgemeinheit wahrgenommen werden.
Jedoch war die Führungsaufsicht seit ihrer Einführung ständig Kritik bezüglich ihrer Effektivität ausgesetzt. Durch den Wandel der Zeit und dem mit ihm einhergehenden Wandel der Gesellschaft, sei es durch Internet- und Medienpräsenz, rücken Straftaten von Sexual- und Gewalttätern immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Es wurde mehr Sicherheit und Kontrolle bei solchen Tätern gefordert, um Rückfälle zu vermeiden. Man kann wohl sagen, dass dies mit Erfolg geschah. Dem folgend kam es nämlich im Jahr 2007 und 2011 zu Reformgesetzen bezüglich der Führungsaufsicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Zweispurigkeit des kriminalrechtlichen Sanktionensystems in Deutschland
- 2.1. Strafe
- 2.2. Maßnahmen
- 2.3. Verfassungsmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Führungsaufsicht
- 3. Die Entstehungsgeschichte der Führungsaufsicht
- 3.1. Die Polizeiaufsicht
- 3.2. Die Sicherungsaufsicht
- 3.3. Die Führungsaufsicht
- 4. Rechtspolitische Entwicklung
- 4.1. Gesetz zur Reform von 2007 und die damit verbundenen Probleme
- 4.2. Gesetz zur Reform von 2011 und die damit verbundenen Probleme
- 4.3. Geltung im Jugendstrafrecht
- 4.4. Praxis-Reformen
- 5. Probleme der Klientel
- 5.1. Richterlich angeordnete Führungsaufsicht
- 5.2. Führungsaufsicht kraft Gesetz
- 5.2.1. Vollständige Verbüßung
- 5.2.2. Freiheitsentziehende Maßregeln
- 5.3. Die Problemlagen
- 6. Arbeitsweise der Führungsaufsichtsstellen und Zusammenarbeit mit Gericht, Bewährungshilfe und ggf. der forensischen Ambulanz sowie der Polizei
- 6.1. Das Gericht
- 6.2. Die Führungsaufsichtsstelle
- 6.3. Die Bewährungshilfe
- 6.4. Die forensische Ambulanz
- 6.5. Die Polizei
- 6.6. Arbeitsweise der Führungsaufsicht in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Entwicklung
- 6.6.1. Integrale Straffälligenarbeit (InStar)
- 6.6.2. Konzept „Für optimierte Kontrolle und Sicherheit“ (Fokus)
- 6.6.3. Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit (LaStar)
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Thema der Führungsaufsicht im deutschen Strafrecht. Ziel ist es, die Geschichte der Führungsaufsicht zu beleuchten, die rechtspolitische Entwicklungen und Probleme zu analysieren und die Problemlagen der Klientel sowie die Arbeitsweise der Führungsaufsichtsstellen zu beleuchten.
- Die Entwicklung der Führungsaufsicht von der Polizeiaufsicht bis zur heutigen Form
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Probleme der Führungsaufsicht
- Die spezifischen Herausforderungen der Klientel der Führungsaufsicht
- Die Arbeitsweise der Führungsaufsichtsstellen und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
- Die Integration von Führungsaufsicht in die integrale Straffälligenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Führungsaufsicht ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 beleuchtet die Zweispurigkeit des kriminalrechtlichen Sanktionensystems in Deutschland und stellt die Führungsaufsicht als ein Instrument der Maßnahmen neben der Strafe dar. Kapitel 3 widmet sich der Entstehungsgeschichte der Führungsaufsicht und zeichnet die Entwicklung von der Polizeiaufsicht über die Sicherungsaufsicht hin zur heutigen Führungsaufsicht nach. Kapitel 4 analysiert die rechtspolitische Entwicklung der Führungsaufsicht und untersucht die Reformgesetze von 2007 und 2011 sowie die Geltung im Jugendstrafrecht. Kapitel 5 beleuchtet die Problemlagen der Klientel der Führungsaufsicht, wobei unterschieden wird zwischen richterlich angeordneter Führungsaufsicht und Führungsaufsicht kraft Gesetz. Kapitel 6 befasst sich mit der Arbeitsweise der Führungsaufsichtsstellen und der Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen wie Gericht, Bewährungshilfe, forensischer Ambulanz und Polizei. Das Kapitel 7 bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der Führungsaufsicht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Führungsaufsicht, Strafrecht, Kriminalpolitik, Sanktionssystem, Rechtspolitische Entwicklung, Klientel, Arbeitsweise, Zusammenarbeit, Bewährungshilfe, forensische Ambulanz, Polizei, Integrale Straffälligenarbeit, Mecklenburg-Vorpommern, InStar, Fokus, LaStar. Die Arbeit behandelt die Führungsaufsicht aus verschiedenen Perspektiven, analysiert ihre Geschichte, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die spezifischen Herausforderungen der Klientel. Darüber hinaus werden die Arbeitsweise der Führungsaufsichtsstellen und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Führungsaufsicht im Strafrecht?
Die Führungsaufsicht ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung, die dazu dient, entlassene Straftäter zu überwachen und bei der Resozialisierung zu unterstützen.
Wann wird Führungsaufsicht angeordnet?
Sie kann entweder richterlich angeordnet werden oder tritt kraft Gesetzes ein, wenn eine Freiheitsstrafe vollständig verbüßt wurde oder eine Unterbringung in einer Maßregelvollzugsanstalt endet.
Was ist die Doppelfunktion der Führungsaufsicht?
Sie kombiniert Hilfe zur Resozialisierung mit der Sicherung der Allgemeinheit durch Kontrolle und Überwachung des Täters.
Welche Institutionen arbeiten bei der Führungsaufsicht zusammen?
Die Zusammenarbeit erfolgt zwischen Gerichten, Führungsaufsichtsstellen, der Bewährungshilfe, der Polizei und teilweise forensischen Ambulanzen.
Was sind InStar und LaStar in Mecklenburg-Vorpommern?
Dies sind Konzepte und Behörden zur integralen Straffälligenarbeit, die eine optimierte Kontrolle und Sicherheit durch vernetzte Arbeitsweisen gewährleisten sollen.
- Quote paper
- Juliane Mohnke (Author), 2013, Kriminalrechtliche Einordnung der Führungsaufsicht. Geschichte, rechtspolitische Entwicklungen und Probleme, Klientel und Arbeitsweisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355473