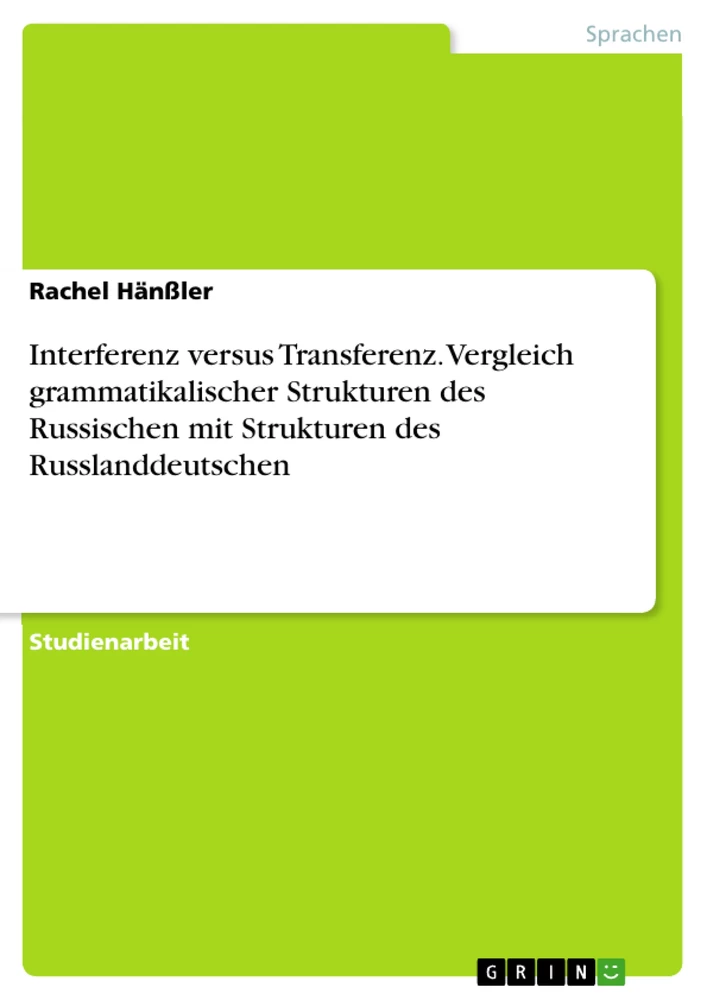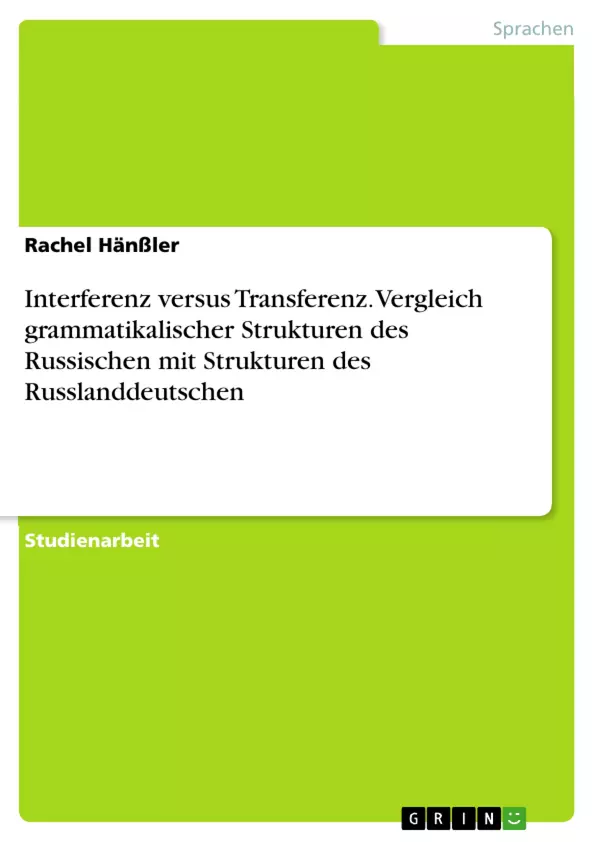Diese Arbeit behandelt die Sprachkontaktforschung, also dem Phänomen, dass Sprecher zwei oder mehr Sprachen nebeneinander gebrauchen. Oftmals wirkt das eine System auf das andere ein. Mit dieser Sprachkontakterscheinung wird sich in dieser Arbeit befasst.
Sie ist folgendermaßen aufgebaut: Zunächst wird auf das Phänomen eingegangen, wobei erstsprachliche Strukturen auf äquivalente Strukturen einer Fremdsprache bzw. Zweitsprache und umgekehrt übertragen werden. Es soll der Ursprung dieser Entdeckung und Namensgebung erkannt werden und wie unterschiedliche Linguisten diesen Terminus kategorisierten und die Definition differenzierten. Dies ist wichtig, da der Terminus zum einen als Interferenz auftaucht, zum anderen aber auch als Transferenz.
In Kapitel 2 wird sich mit der Interferenz sowie dessen Diversifizierungen beschäftigt, wobei der Linguist Weinreich von Bedeutung ist. In Kapitel 3 wird näher auf den Begriff Transferenz eingegangen. Dabei sollen Transferleistungen wie Code-Switching und Borrowing als kategorisierte Transfererscheinungen eine bessere Kenntnis bieten, da besonders Code-Switching ein oft gebrauchter Begriff beim Thema Kontakterscheinung ist.
Dem folgt in Kapitel 4 eine Gegenüberstellung der beiden Termini und es soll konkludiert werden, was bei dieser unterschiedlichen Namensgebung perspektivisch zu beachten ist.
Im letzten Kapitel dieser Arbeit wird die Übertragung zweitsprachlicher Strukturen auf äquivalente Strukturen der Erstsprache anhand mehrerer Beispielen erläutert. Dabei wird sich auf die Ebenen der Lexik, Phonologie/Prosodie, Morphologie und Syntax spezialisiert. Durch diese Erläuterungen soll dem Leser diese Sprachkontakterscheinung so gut wie möglich erklärt werden, und ebenfalls, wie diese zu einem Sprachwandel oder auch einer Sprachattrition führen kann.
Im Kapitel 5 wird sich ausschließlich auf Beispiele bezogen, die sich im Russlanddeutschen zeigen. Einerseits wird dadurch noch spezieller das Seminarthema „Sprachen und Sprachverhalten von Russischsprachigen in Deutschland“ aufgegriffen, wobei auch die Sprache der Russlanddeutschen in Russland behandelt wurde, andererseits gibt Claudia Maria Riehl sehr passende Beispiele dazu.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Interferenz
- 2.1. Herkunft und Bedeutung von Interferenz
- 2.2. Differenzierung der Definition
- 2.2.1. Positive und negative Interferenz
- 2.2.2. Proaktive und retroaktive Interferenz
- 2.2.3. Interlinguale und intralinguale Interferenz
- 3. Transferenz
- 3.1. Transferenz in der Linguistik
- 3.1.1. Intrusiver und inhibitiver Transfer
- 3.1.2. Positiver und negativer Transfer
- 3.2. Transferleistungen: Code-Wechsel
- 3.2.1. Code-Switching
- 3.2.2. Borrowing
- 3.2.3. Code-Mixing
- 3.1. Transferenz in der Linguistik
- 4. Gegenüberstellung der Termini Interferenz und Transferenz
- 5. Interferenz- bzw. Transferenzerscheinungen
- 5.1. Lexikalischer Transfer
- 5.2. Phonologischer und prosodischer Transfer
- 5.3. Morphologischer Transfer
- 5.4. Syntaktischer Transfer
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übertragung russischer Sprachstrukturen auf äquivalente Strukturen des Russlanddeutschen. Sie beleuchtet die Begriffe Interferenz und Transferenz, differenziert ihre Definitionen und vergleicht beide Konzepte. Die Arbeit analysiert sprachliche Transfererscheinungen auf verschiedenen Ebenen (Lexik, Phonologie/Prosodie, Morphologie und Syntax) am Beispiel des Russlanddeutschen.
- Unterscheidung der Begriffe Interferenz und Transferenz
- Analyse der verschiedenen Arten von Interferenz und Transferenz
- Erläuterung von Transferleistungen wie Code-Switching und Borrowing
- Beschreibung von Transfererscheinungen im Russlanddeutschen
- Sprachkontakt und seine Auswirkungen auf den Sprachwandel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprachkontakt und die wechselseitige Beeinflussung von Sprachen ein. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und skizziert den Fokus auf die Übertragung erst- und zweitsprachlicher Strukturen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Erscheinung im Russlanddeutschen, wobei die Geschichte der Russlanddeutschen und ihrer Sprachsituation beleuchtet wird, um den Kontext der Transfererscheinungen zu verdeutlichen. Die spezifische Sprachsituation der Russlanddeutschen, geprägt von langen Perioden der Isolation und anschließender Russifizierung, wird als Grund für die untersuchten Transferphänomene dargestellt.
2. Interferenz: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff "Interferenz", seiner Herkunft und Bedeutung. Es differenziert den Begriff in verschiedene Kategorien (positive/negative, proaktiv/retroaktiv, interlingual/intralingual) und diskutiert unterschiedliche sprachwissenschaftliche Ansätze zu seiner Definition, wobei der Beitrag von Weinreich hervorgehoben wird. Die Diskussion der verschiedenen Definitionen verdeutlicht die Komplexität des Begriffs und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
3. Transferenz: Dieses Kapitel analysiert den Begriff "Transferenz" im linguistischen Kontext, inklusive der Unterscheidung von intrusivem und inhibitivem sowie positivem und negativem Transfer. Ein besonderer Fokus liegt auf Transferleistungen wie Code-Switching, Borrowing und Code-Mixing, welche als typische Erscheinungsformen des Sprachkontakts und der Sprachmischung im Russlanddeutschen detailliert beschrieben werden. Die Erklärung dieser Mechanismen trägt zum Verständnis der im Russlanddeutschen beobachteten Sprachphänomene bei.
4. Gegenüberstellung der Termini Interferenz und Transferenz: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Termini "Interferenz" und "Transferenz" und diskutiert die Implikationen der unterschiedlichen Begriffsverwendung. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Konzepte herausgearbeitet, um die jeweilige Nützlichkeit für die Beschreibung von Sprachkontakterscheinungen zu beleuchten und eventuelle Missverständnisse aufgrund der terminologischen Unterschiede zu vermeiden.
5. Interferenz- bzw. Transferenzerscheinungen: Dieses Kapitel untersucht die Übertragung zweitsprachlicher (russischer) Strukturen auf äquivalente Strukturen der Erstsprache (Russlanddeutsch) anhand von Beispielen aus den Bereichen Lexik, Phonologie/Prosodie, Morphologie und Syntax. Die Beispiele veranschaulichen die konkrete Ausprägung der Sprachkontakterscheinungen und beleuchten, wie diese zu Sprachwandel oder Sprachattrition beitragen können. Der Fokus auf das Russlanddeutsche ermöglicht eine detaillierte Analyse der spezifischen sprachlichen Entwicklung in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Interferenz, Transferenz, Sprachkontakt, Russlanddeutsch, Code-Switching, Borrowing, Code-Mixing, Mehrsprachigkeit, Sprachwandel, Sprachattrition, Lexik, Phonologie, Prosodie, Morphologie, Syntax, Russifizierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Übertragung Russischer Sprachstrukturen auf das Russlanddeutsche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Übertragung russischer Sprachstrukturen auf das Russlanddeutsch. Sie konzentriert sich auf die Konzepte „Interferenz“ und „Transferenz“, differenziert diese und vergleicht sie miteinander. Die Analyse erfolgt anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen sprachlichen Ebenen (Lexik, Phonologie/Prosodie, Morphologie und Syntax).
Welche Begriffe werden im Detail untersucht?
Die zentralen Begriffe sind Interferenz und Transferenz. Die Arbeit differenziert die Definitionen von Interferenz (positiv/negativ, proaktiv/retroaktiv, interlingual/intralingual) und Transferenz (intrusiv/inhibitiv, positiv/negativ). Zusätzlich werden Transferleistungen wie Code-Switching, Borrowing und Code-Mixing erläutert.
Wie werden Interferenz und Transferenz unterschieden?
Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Vergleich von Interferenz und Transferenz. Die Arbeit hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Konzepte hervor und diskutiert die Implikationen der unterschiedlichen Begriffsverwendung für die Beschreibung von Sprachkontakterscheinungen.
Welche sprachlichen Ebenen werden analysiert?
Die Analyse umfasst die lexikalische, phonologische/prosodische, morphologische und syntaktische Ebene des Russlanddeutschen. Konkrete Beispiele aus diesen Bereichen veranschaulichen die Übertragung russischer Strukturen.
Was ist die Rolle des Russlanddeutschen in dieser Arbeit?
Das Russlanddeutsche dient als Fallbeispiel, um die Übertragung zweitsprachlicher (russischer) Strukturen auf die Erstsprache zu untersuchen. Die historische und sprachliche Situation der Russlanddeutschen, geprägt von Isolation und Russifizierung, wird als Kontext der Transferphänomene dargestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Interferenz, Transferenz, Gegenüberstellung von Interferenz und Transferenz, Interferenz- bzw. Transferenzerscheinungen und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Interferenz, Transferenz, Sprachkontakt, Russlanddeutsch, Code-Switching, Borrowing, Code-Mixing, Mehrsprachigkeit, Sprachwandel, Sprachattrition, Lexik, Phonologie, Prosodie, Morphologie, Syntax, Russifizierung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Begriffe Interferenz und Transferenz zu unterscheiden und zu analysieren, Transferleistungen zu erläutern und Transfererscheinungen im Russlanddeutschen zu beschreiben. Sie untersucht auch den Einfluss von Sprachkontakt auf den Sprachwandel.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet eine detaillierte Übersicht über den Inhalt jedes Kapitels, inklusive der behandelten Themen und der Herangehensweise.
- Quote paper
- Rachel Hänßler (Author), 2016, Interferenz versus Transferenz. Vergleich grammatikalischer Strukturen des Russischen mit Strukturen des Russlanddeutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355526