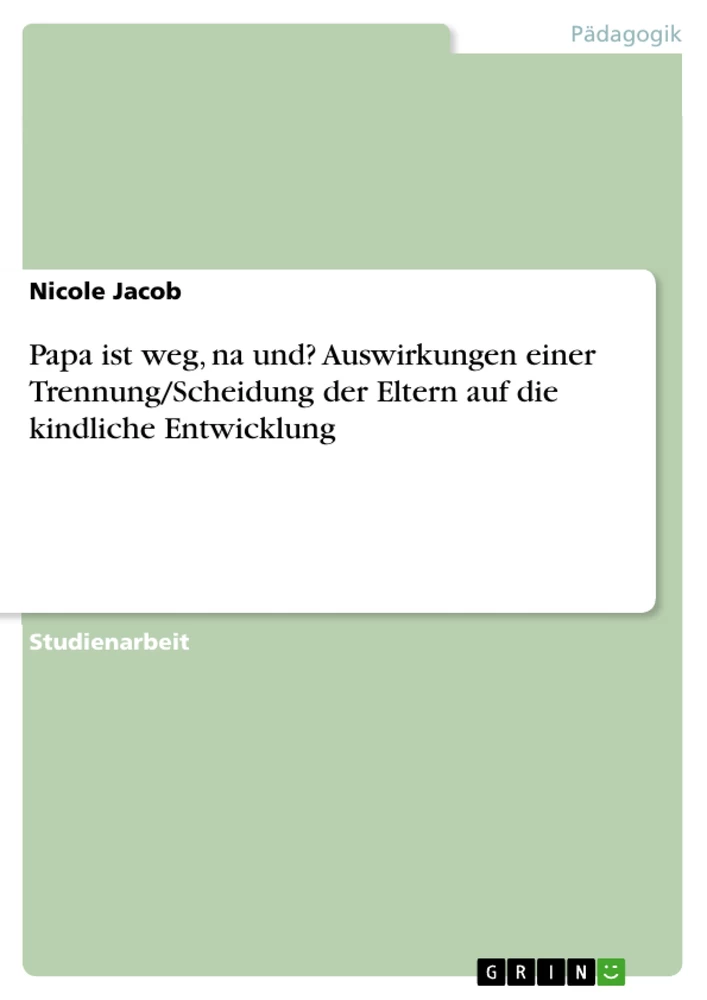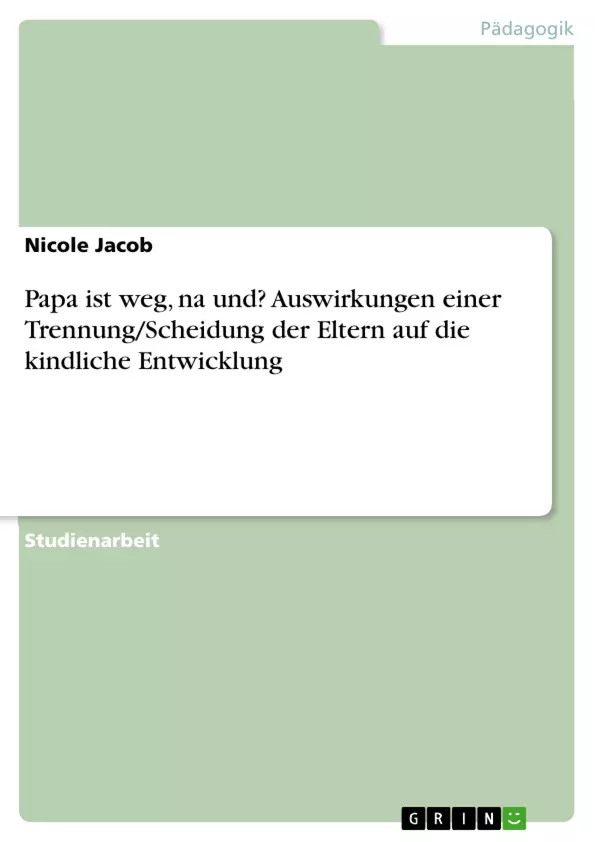Der Beantwortung der Frage nach den Auswirkungen einer Trennungsgeschichte auf die kindliche Entwicklung wird sich in dieser Hausarbeit genähert.
So erscheint es zum einen wichtig zu sein, bindungstheoretische Annahmen hinzuzuziehen. Zuerst wird die Bindungstheorie von John Bowlby beleuchtet und die Verschiedenheit von Qualitäten der Mutter-Kind-Bindung betrachtet. Zum anderen werden neuere Forschungsergebnisse in Bezug auf Bindung behandelt. In diesem Kapitel werden die Bindungsqualitäten im Trennungs- und Nachtrennungsprozess beleuchtet. Darauf folgen mögliche psychische Folgen, die Kindeswohlgefährdung und Unterstützungsangebote für Eltern. Im Ausblick wird das Vorangegangene zusammengefasst, die Forschungsfrage beantwortet und die Konsequenz für die Soziale Arbeit dargestellt.
Eine Trennung oder Ehescheidung markiert den Schlussstrich unter einem gemeinsamen Leben eines Paares oder einer Familie. Nach den Angaben des statistischen Bundesamtes wurde im Jahr 2014 knapp jede dritte Eheschließung in Deutschland geschieden (vgl. Statistisches Bundesamt 2015, S. 8). Von 8,1 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern leben knapp 20% bei einem alleinerziehenden Elternteil. Im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen spricht man von 12,9 Millionen, davon leben 17% bei einem Elternteil (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2015).
Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfe kommen 90% der Kinder und Jugendlichen aus Trennungsfamilien, die aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten Unterstützung erfahren. So auch beispielsweise der zwölfjährige Tom (Name wurde geändert), der sich in der Schule und im Gruppenkontext stark verhaltensauffällig zeigt: zum einen droht er seinen Mitschülern, zeigt impulsives und aggressives Verhalten, schlägt schnell zu und verbucht bereits drei Anzeigen bei der Polizei. Zum anderen weist er eine niedrige Frustrationstoleranz auf, weint in Gesprächen häufig, wenn er mit seinem Verhalten konfrontiert wird, und hat Schwierigkeiten, sich konzentrieren zu können. Seine Eltern sind seit 8 Jahren geschieden und streiten sich, wenn sie punktuell Kontakt haben. Auf die Frage nach seinem Vater sagte er: "Papa ist weg, na und?!"
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Bindung
- 2.1 Begriffsbestimmung: Bindung
- 2.2 Bindungstheorie nach Bowlby
- 2.3 Postulate der Bindungstheorie
- 2.3.1 Qualität der Fürsorge
- 2.3.2 Biologische Notwendigkeit
- 2.3.3 Bindungs- und Explorationsbalance
- 2.3.4 Bindungsqualitäten
- 2.3.5 Internale Arbeitsmodelle
- 3. Bindungsforschung
- 3.1 Die Bedeutung des Vaters für psychische Sicherheit und Bindung
- 3.2 Die Abwesenheit des Vaters
- 3.3 Bindungsqualität im Trennungs- und Nachtrennungsprozess
- 3.4 Veränderlichkeit des internalen Arbeitsmodells
- 4. Auswirkungen der Trennung auf die Kindliche Entwicklung
- 4.1 Psychische Folgen
- 4.2 Kindeswohlgefährdung als Folge hochkonflikthaften Verhaltens der Eltern
- 4.3 Hilfen für Eltern und Kinder
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen einer Trennung/Scheidung der Eltern auf die kindliche Entwicklung. Sie soll ein tieferes Verständnis für die Folgen von Trennungsprozessen für Kinder und Jugendliche vermitteln und die Bedeutung von Bindungstheorie für die Analyse dieser Prozesse verdeutlichen.
- Bedeutung von Bindung für die kindliche Entwicklung
- Einfluss der Trennung/Scheidung auf die Bindungsqualität
- Mögliche psychische Folgen für Kinder und Jugendliche
- Rolle von Kindeswohlgefährdung in Trennungsfamilien
- Hilfsmöglichkeiten für Eltern und Kinder in Trennungssituationen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Problemstellung vor, indem sie die Häufigkeit von Trennungen in Deutschland und den Zusammenhang von Trennungsprozessen mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern beleuchtet. Kapitel 2 widmet sich dem Konzept der Bindung, beleuchtet die Bindungstheorie von John Bowlby und erläutert die Postulate der Bindungstheorie.
Kapitel 3 befasst sich mit der Bindungsforschung und der Bedeutung des Vaters für psychische Sicherheit und Bindung, die Abwesenheit des Vaters in Trennungsfamilien, die Bindungsqualität im Trennungsprozess und die Veränderlichkeit des internalen Arbeitsmodells. In Kapitel 4 werden die Auswirkungen der Trennung auf die kindliche Entwicklung untersucht, insbesondere die psychischen Folgen und das Thema Kindeswohlgefährdung in Trennungsfamilien. Kapitel 4.3 befasst sich mit Hilfen für Eltern und Kinder in Trennungssituationen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind Bindung, Bindungstheorie, Trennung/Scheidung, kindliche Entwicklung, psychische Folgen, Kindeswohlgefährdung, Hilfen für Eltern und Kinder. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Bedeutung der Bindungsqualität im Trennungs- und Nachtrennungsprozess, die veränderlichen internalen Arbeitsmodelle und die möglichen Folgen für die kindliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst eine Trennung die kindliche Bindung?
Eine Trennung kann die Bindungsqualität massiv beeinträchtigen. Die Arbeit nutzt die Theorie von John Bowlby, um zu zeigen, wie sich die Sicherheit der Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Bindung verändert.
Welche psychischen Folgen können bei Kindern auftreten?
Mögliche Folgen sind Verhaltensauffälligkeiten, gesteigerte Aggressivität, Impulsivität, niedrige Frustrationstoleranz sowie Konzentrationsschwierigkeiten und Trauer.
Welche Bedeutung hat der Vater für die Entwicklung?
Der Vater ist essenziell für die psychische Sicherheit. Seine Abwesenheit oder hochkonflikthafte Elternbeziehungen können die Entwicklung nachhaltig stören.
Wann spricht man von Kindeswohlgefährdung bei Trennungen?
Kindeswohlgefährdung kann eine Folge von hochkonflikthaftem Verhalten der Eltern sein, wenn das Kind emotional instrumentalisiert wird oder unter dem dauerhaften Streit leidet.
Welche Hilfen gibt es für Trennungsfamilien?
Unterstützung bieten ambulante Jugendhilfen, Erziehungsberatungsstellen und spezifische Angebote der Sozialen Arbeit, die sowohl Eltern als auch Kinder begleiten.
- Quote paper
- Nicole Jacob (Author), 2016, Papa ist weg, na und? Auswirkungen einer Trennung/Scheidung der Eltern auf die kindliche Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355528