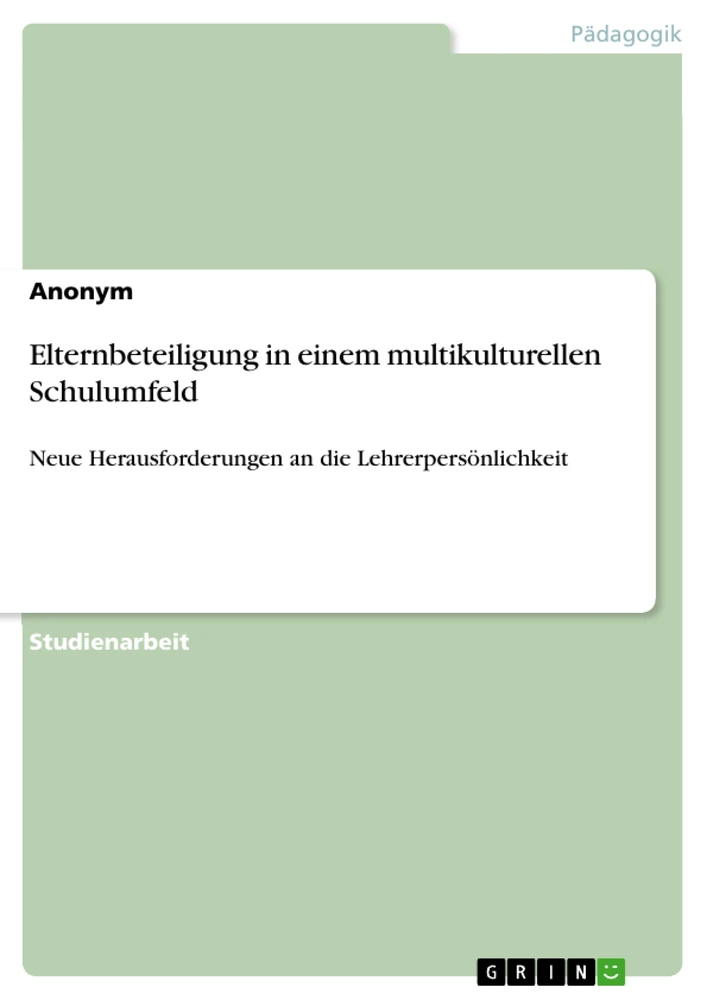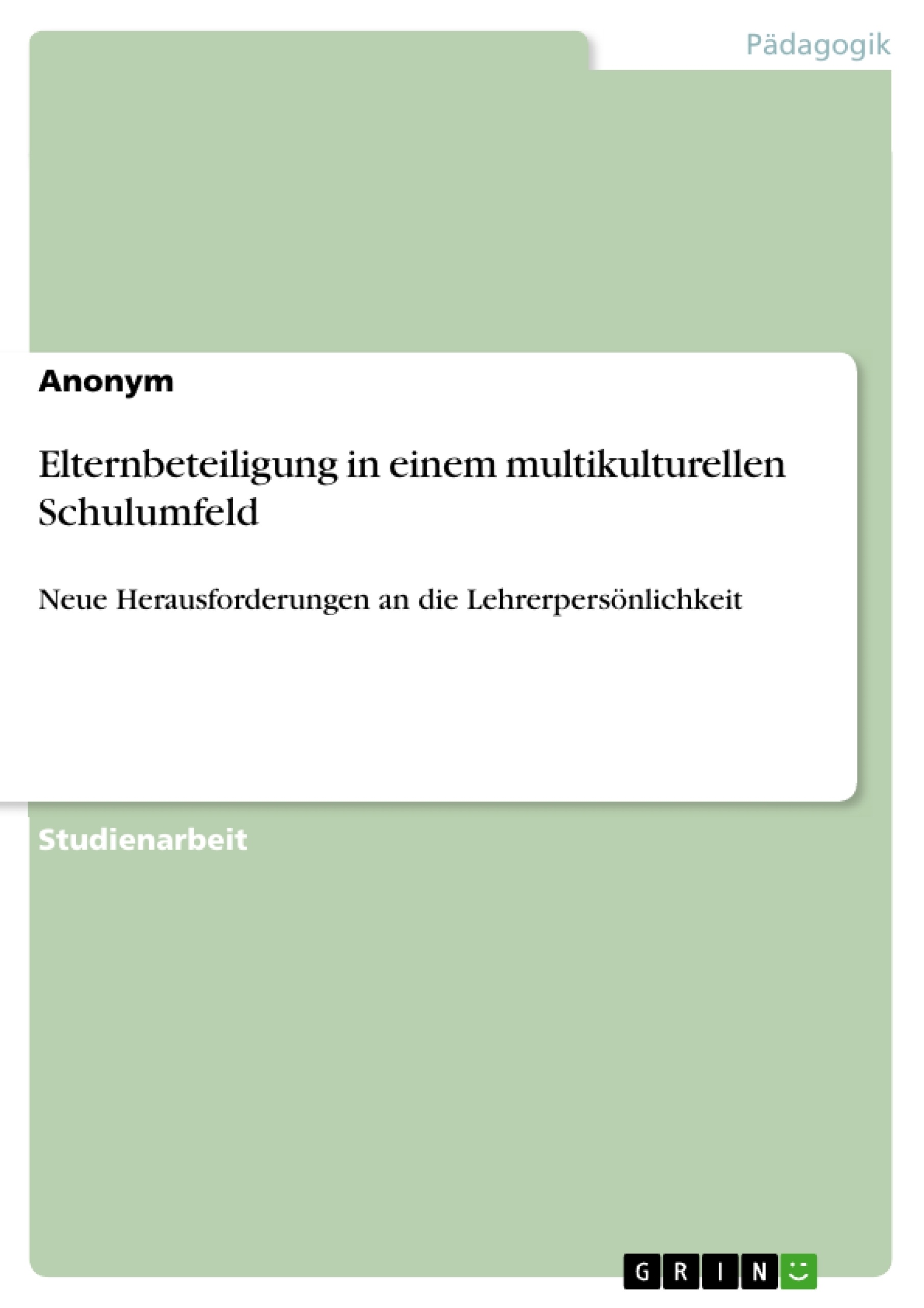Sie ist in allen Länderverfassungen verankert – und doch bleibt die praktische Gestaltung der Elternbeteiligung, beziehungsweise der Kooperation von Familien und Lehrkräften, im Gesamtbild gegenwärtiger Bemühungen hinter den Erwartungen zurück. Dabei steht die hiesige Bildungspolitik in besonderer Weise vor der Herausforderung, gegen das bestehende Leistungsgefälle entlang der Ethnizitäten anzukämpfen; weist dieses Gefälle doch auf institutionell verankerte Chancenungleichheiten im deutschen Bildungssystem hin. Tatsächlich wird die Elternbeteiligung als wichtiger Interventionspunkt angesehen, um speziell für Migrantenkinder und Schüler mit bildungsfernen Eltern das schulische Lernen und die Erfolgschancen zu verbessern. Was muss getan werden? Die bereits bestehenden Ansätze und Projekte zur verbesserten Zusammenarbeit oben skizzierter Parteien müssen systematisch ausgeweitet werden. Der erste Schritt zum vertrauensvollen Miteinander muss gewiss von den Lehrkräften getan werden. Denn es müssen gerade die Eltern erreicht werden, die (aus unterschiedlichsten Gründen) dem Schulleben fern stehen. Doch dies setzt neue, hohe Anforderungen an ‚den Lehrer‘! So ist das Ziel der vorliegenden Hausarbeit, die Herausforderungen und Hindernisse für eine Kooperation vonseiten der Eltern als auch vonseiten der Lehrer aufzuzeigen. Davon ausgehend leite ich die Qualifikationen ab, die eine Lehrkraft besitzen oder idealerweise bereits im Studium erwerben sollte. Doch zuvor ist es nötig, die Elternbeteiligung zu definieren und zu kontextualisieren und sie im zweiten Schritt auf die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten herunterzubrechen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Elternbeteiligung im Kontext einer sozial gerechteren Bildung
- 2. Praktische Umsetzungsmöglichkeiten der Elternbeteiligung
- 3. Erschwerte Bedingungen für Elternarbeit im multikulturellen Umfeld
- 4. Erforderliche Qualifikationen der Lehrkräfte
- 5. Die Frage nach dem Erwerb der Qualifikationen
- III. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Herausforderungen und Hindernisse einer erfolgreichen Kooperation zwischen Eltern und Lehrkräften im Kontext eines multikulturellen Schulumfelds. Das Ziel ist es, die notwendigen Qualifikationen aufzuzeigen, die Lehrkräfte besitzen oder idealerweise im Studium erwerben sollten, um eine effektive Elternbeteiligung zu ermöglichen. Die Arbeit beleuchtet dabei die spezifischen Bedingungen, die durch die kulturelle Vielfalt und den Migrationshintergrund von Schülern entstehen.
- Definition und Kontexte von Elternbeteiligung
- Praktische Umsetzungsmöglichkeiten der Elternbeteiligung
- Herausforderungen der Elternarbeit im multikulturellen Umfeld
- Erforderliche Qualifikationen der Lehrkräfte
- Die Bedeutung der Elternbeteiligung für den Bildungserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Elternbeteiligung im Bildungssystem und stellt die Notwendigkeit einer stärkeren Kooperation zwischen Familien und Lehrkräften heraus. Sie führt die Herausforderungen im Kontext der kulturellen Vielfalt und der Chancenungleichheiten im deutschen Bildungssystem an und betont die Bedeutung der Elternbeteiligung, um den Bildungserfolg insbesondere von Migrantenkindern zu verbessern. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Hindernisse für eine erfolgreiche Kooperation von Seiten der Eltern und der Lehrer aufzuzeigen sowie die dafür notwendigen Qualifikationen der Lehrkräfte zu identifizieren.
II. Hauptteil
1. Elternbeteiligung im Kontext einer sozial gerechteren Bildung
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Elternbeteiligung im Kontext der sozial gerechten Bildung. Es werden die Ergebnisse von Schulleistungsstudien herangezogen, die auf ein gravierendes Gefälle zwischen Kindern und Jugendlichen deutscher und nicht-deutscher Herkunft beim Zugang zu höheren Bildungsgängen hinweisen. Es wird betont, dass die unzureichende Beteiligung von Migranteneltern am Schulleben zwar ein Faktor ist, jedoch nicht allein für den erschwerten Zugang zu Bildung verantwortlich gemacht werden kann. Das Kapitel verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen, die die enge Verbindung zwischen Schule, Familie und Bildungserfolg belegen, und betont die positive Wirkung des schulischen Engagements der Eltern auf das Lernverhalten der Kinder. Die verschiedenen Formen der Elternbeteiligung werden definiert und die Wichtigkeit einer aktiven Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften hervorgehoben.
2. Praktische Umsetzungsmöglichkeiten der Elternbeteiligung
Das zweite Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur praktischen Umsetzung der Elternbeteiligung. Es werden sechs Punkte von RÜESCH vorgestellt, die die Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern umfassen, darunter Vermittlung von Informationen, Elternbildung, individuelle Erziehungsberatung, Unterstützung bei Schularbeiten und Mitsprache in Entscheidungsgremien. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ansätze eine relativ traditionelle Sicht auf die Rolle der Eltern widerspiegeln, die in erster Linie als unterstützende Partner gesehen werden. Das Kapitel stellt jedoch neue Perspektiven vor, die auf eine kreative Verknüpfung der Lebenswelten der Familien mit den Curricula und auf eine aktivere Einbindung der Eltern in kritische Untersuchungen des schulischen Systems setzen.
Schlüsselwörter
Elternbeteiligung, multikulturelles Schulumfeld, soziale Gerechtigkeit, Bildungsungleichheit, Migranteneltern, Lehrkräftequalifikation, Kooperation, Partizipation, Schulentwicklung, Bildungserfolg, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Elternbeteiligung in multikulturellen Schulen so wichtig?
Sie gilt als zentraler Interventionspunkt, um die Bildungschancen von Migrantenkindern zu verbessern und institutionelle Benachteiligungen abzubauen.
Welche Hindernisse gibt es für die Kooperation mit Migranteneltern?
Herausforderungen sind unter anderem Sprachbarrieren, unterschiedliche Bildungsvorstellungen, Bildungsferne und eine gegenseitige Distanz zwischen Elternhaus und Schule.
Welche Qualifikationen sollten Lehrkräfte für diese Arbeit haben?
Lehrkräfte benötigen interkulturelle Kompetenz, Empathie, Beratungsfähigkeiten und die Bereitschaft, aktiv auf bildungsferne Eltern zuzugehen.
Was sind praktische Formen der Elternbeteiligung?
Dazu gehören Informationsaustausch, Elternbildung, Erziehungsberatung, Hausaufgabenunterstützung und die Mitwirkung in schulischen Gremien.
Wie wirkt sich elterliches Engagement auf den Schulerfolg aus?
Studien belegen, dass aktives Interesse und Beteiligung der Eltern das Lernverhalten der Kinder positiv beeinflussen und die Erfolgsaussichten steigern.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2014, Elternbeteiligung in einem multikulturellen Schulumfeld, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355645