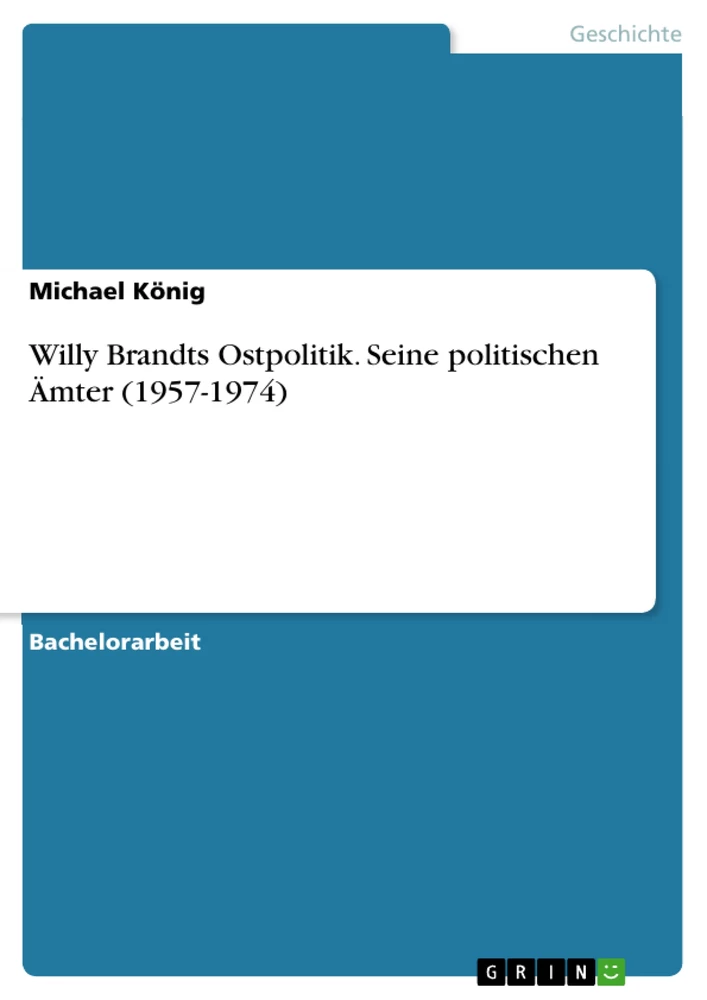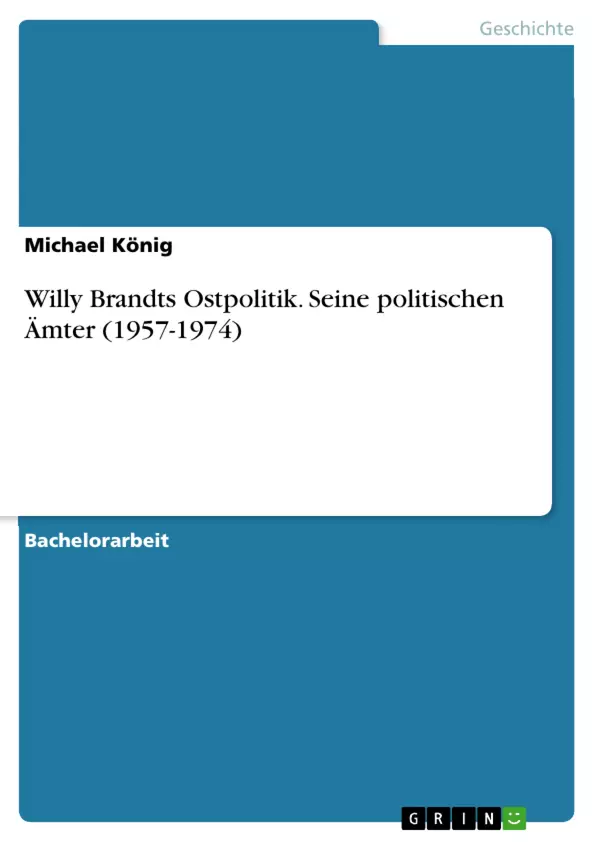Diese Abschlussarbeit möchte die Frage klären, wie es zu der sogenannten Ostpolitik Willy Brandts kam. Des Weiteren wirft sie einen Blick auf Brandts Politik in den drei von ihm bekleideten Ämtern. Hier soll der Frage nachgegangen werden, ob seine Politik zur Problematik der Ostpolitik eine Kontinuität, eine gemeinsame Tendenz aufweist.
Aufgrund des von Brandt kontinuierlich verfolgten Plans zur Ostpolitik, den er schon früh ausarbeitete und nur unwesentlich korrigierte, ist es möglich, Gemeinsamkeiten zwischen den Ämtern herauszuarbeiten. Demgemäß wird sich der Hauptteil dieser Arbeit mit der Beweisführung zur Belegung der These beschäftigen. Hierfür wird die Zeit zwischen den Jahren 1957 (Antritt als regierender Bürgermeister von Berlin) und 1974 (Rücktritt als Bundeskanzler) herangezogen. Exemplarisch sollen für jedes Amt ein oder mehrere Schlaglichter genauer untersucht werden. Für die Zeit als Bürgermeister ist seine Position zur Ostpolitik besonders am Berlin Ultimatum 1958, am Mauerbau 1961 und am Passierscheinabkommen von 1963 erkennbar, weswegen der Fokus hier auf diesen Jahren liegen wird. Da die grundlegende Ausarbeitung und Richtungsweisung der brandtschen Ostpolitik in seiner Berliner Zeit erarbeitet wurde, wird sich jenes Kapitel detaillierter mit den Geschehnissen befassen, als die darauffolgenden Kapitel. Die anschließende Aufgabe als Außenminister ist etwas schwieriger zu beleuchten, da Brandt diesen Posten nur zwei Jahre innehatte, weswegen das Hauptaugenmerk auf der Großen Koalition und dem einschneidenden Ereignis des Prager Frühling 1968 liegen wird. Nach der Bundestagswahl 1969 und seiner Ernennung zum Kanzler gibt es vielfältige Möglichkeiten seine Sicht der Ostpolitik zu untersuchen. Im Zentrum der Untersuchung sollen hier nun der Kniefall von Warschau, sowie die Ostverträge (Moskau / Warschau / Grundlagenvertrag) stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Brandts erste Gedanken zur Ostpolitik
- „,,Berlin bleibt frei!\" - Willy Brandt als Bürgermeister von Berlin
- Anfänge: Das Berlin Ultimatum 1958
- Schock: Der Mauerbau 1961
- Erklärung: Tutzing 1963
- Erleichterung: Das Passierscheinabkommen 1963
- Kabinett Kiesinger - Brandt als Außenminister
- Revolution? Der Prager Frühling 1968
- „Mehr Demokratie wagen“ - Brandt als Bundeskanzler
- „Wandel durch Annäherung“: Die Ostverträge
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abschlussarbeit untersucht die Entwicklung und Umsetzung von Willy Brandts Ostpolitik. Der Fokus liegt auf der Analyse seiner politischen Aktivitäten während seiner Amtszeiten als Berliner Bürgermeister, Außenminister und Bundeskanzler. Die Arbeit beleuchtet, ob Brandts Politik in diesen verschiedenen Ämtern eine Kontinuität und gemeinsame Tendenz in Bezug auf die Ostpolitik aufweist.
- Die Entstehung und Entwicklung von Brandts Ostpolitik
- Die Bedeutung von Brandts Berliner Zeit für die Ostpolitik
- Brandts Rolle als Außenminister und seine Reaktion auf den Prager Frühling 1968
- Die Umsetzung der „Wandel durch Annäherung“-Politik als Bundeskanzler
- Die Analyse von Kontinuitäten und Gemeinsamkeiten in Brandts Ostpolitik über seine verschiedenen Ämter hinweg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Willy Brandt als „Deutschen Weltbürger“ vor und erläutert seine politische Karriere. Sie führt die Forschungsfrage ein, die sich mit der Entwicklung und Kontinuität von Brandts Ostpolitik befasst. Die Quellenlage und der aktuelle Forschungsstand werden vorgestellt, um die Grundlage der Arbeit zu verdeutlichen. Die Arbeit bietet eine Definition des Begriffs „Ostpolitik“ und liefert einen historischen Kontext für die spätere Analyse.
Kapitel 2 beleuchtet Brandts erste Gedanken zur Ostpolitik, die er bereits vor seiner politischen Karriere entwickelt hat. Es wird seine Positionierung nach dem Krieg und seine Erfahrungen im Exil in den Blick genommen. Die Analyse zeigt seine frühen Überzeugungen und Ideen, die später in seiner Ostpolitik zum Ausdruck kommen.
Kapitel 3 konzentriert sich auf Brandts Zeit als Bürgermeister von Berlin. Es werden drei wichtige Ereignisse analysiert: das Berlin Ultimatum 1958, der Mauerbau 1961 und das Passierscheinabkommen 1963. Diese Ereignisse zeigen, wie Brandt mit der Ostpolitik in seiner Berliner Zeit umging und welche Strategien er verfolgte.
Kapitel 4 befasst sich mit Brandts Zeit als Außenminister. Es wird die Große Koalition und das einschneidende Ereignis des Prager Frühling 1968 analysiert. Dieses Kapitel beleuchtet Brandts Rolle in der deutschen Außenpolitik und seine Reaktion auf die Ereignisse in der Tschechoslowakei.
Kapitel 5 untersucht Brandts Zeit als Bundeskanzler. Es werden der Kniefall von Warschau und die Ostverträge (Moskau / Warschau / Grundlagenvertrag) analysiert. Dieses Kapitel zeigt, wie Brandt die „Wandel durch Annäherung“-Politik umsetzte und welche Ergebnisse er erzielte.
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen bezüglich der Kontinuität und Entwicklung von Brandts Ostpolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Ostpolitik Willy Brandts, die „Wandel durch Annäherung“-Politik, die deutsch-deutschen Beziehungen, die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, der Prager Frühling 1968, die Ostverträge, der Kniefall von Warschau und die Rolle von Willy Brandt als Berliner Bürgermeister, Außenminister und Bundeskanzler.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern von Willy Brandts Ostpolitik?
Der Kern war die Strategie „Wandel durch Annäherung“, die darauf abzielte, durch Entspannungspolitik und Verträge die Beziehungen zur DDR und den osteuropäischen Staaten zu normalisieren.
Welche Rolle spielte Brandt als Bürgermeister von Berlin für die Ostpolitik?
In seiner Berliner Zeit (1957-1966) entwickelte er die Grundlagen seiner Politik, geprägt durch Ereignisse wie das Berlin-Ultimatum, den Mauerbau und das erste Passierscheinabkommen.
Was bedeuten die „Ostverträge“?
Dazu gehören der Moskauer Vertrag, der Warschauer Vertrag und der Grundlagenvertrag mit der DDR. Sie bildeten das rechtliche Fundament für die Anerkennung von Grenzen und die Verbesserung der deutsch-deutschen Beziehungen.
Warum ist der „Kniefall von Warschau“ historisch so bedeutend?
Er war eine spontane symbolische Geste der Bitte um Vergebung für die Verbrechen der NS-Zeit und ein Meilenstein für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen.
Wie reagierte Brandt als Außenminister auf den Prager Frühling 1968?
Trotz der Niederschlagung der Reformbewegung hielt Brandt an der Notwendigkeit des Dialogs mit dem Osten fest, was seine Entschlossenheit zur Fortführung der Entspannungspolitik unterstrich.
Gab es eine Kontinuität in Brandts Politik über seine Ämter hinweg?
Ja, die Arbeit zeigt, dass Brandt einen kontinuierlichen Plan verfolgte, den er schon früh in Berlin ausarbeitete und in seinen späteren Ämtern als Außenminister und Kanzler konsequent umsetzte.
- Arbeit zitieren
- Michael König (Autor:in), 2016, Willy Brandts Ostpolitik. Seine politischen Ämter (1957-1974), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355690