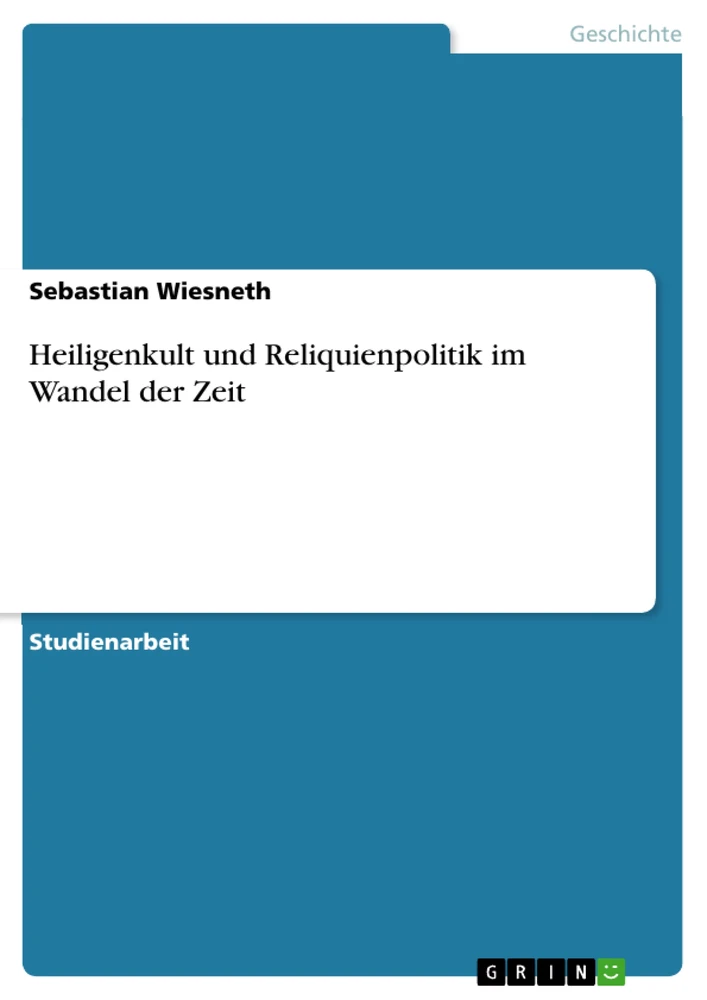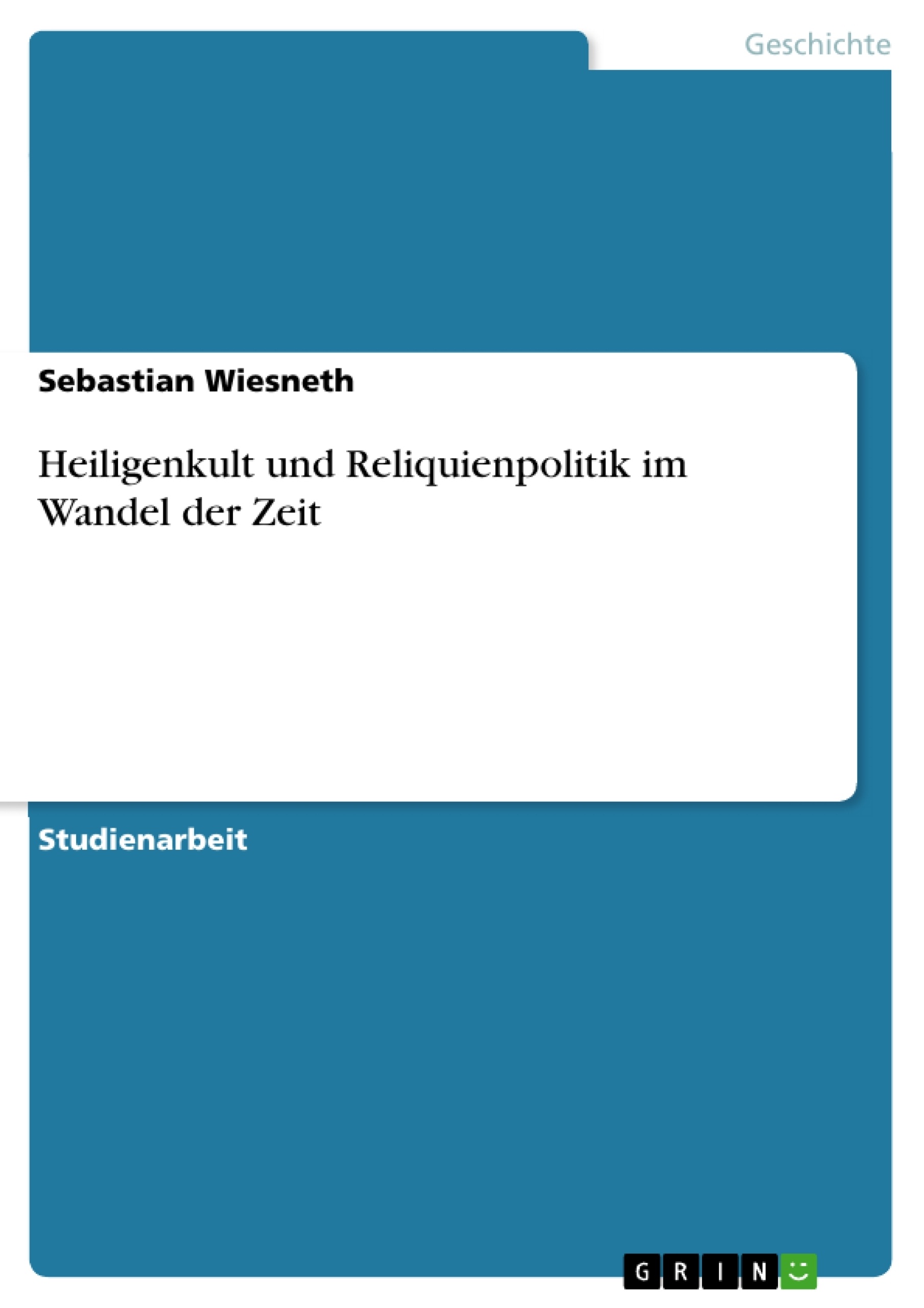Mutter Teresa ist ein weltweites Symbol für christliche Nächstenliebe. Nun soll die verstorbene Ordensschwester, die schon zu Lebzeiten als Heilige verehrt wurde, heiliggesprochen werden. Dies wurde möglich, nachdem Papst Franziskus Ende 2015 ein Wunder, welches durch Fürbitten zu ihr gewirkt wurde, anerkannt hat.
Ein Wunder ist ein wesentlicher Bestandteil des Kanonisierungsverfahrens. Im Mittelalter sah die Situation anders aus. So schreibt Arnold Angenendt: "Die Liturgie der Erhebung und Neubeisetzung – daran kann kein Zweifel sein – bedeutete zunächst genau das, was später das Kanonisierungsverfahren aussprach: Die Anerkenntnis der Heiligkeit." Aber auch die Erhebung von Gebeinen war in Rom vor dem 8. Jahrhundert aufgrund des Translationsverbots nicht alltäglich.
Inhaltsverzeichnis
- Auf dem Weg zu Heiligen
- Der Wandel im 8. und 9. Jahrhundert
- Vorgeschichte
- Das Translationsverbot
- Reliquienteilungen
- Der Wandel
- Translationen
- Bau und Stiftungstätigkeit
- Der Heiligenkult
- Vorgeschichte
- Fazit: Kurswechsel und Aufschwung statt wirklichen Wandel
- Ausblick: Ein wirklicher Wandel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Wandel im Umgang mit Heiligen und Reliquien in Rom während der Zeit von der Mitte des 8. bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts. Sie konzentriert sich dabei auf die Pontifikate von Paul I. bis zu Gregor IV. und betrachtet insbesondere die Entwicklung der Translationen, der Bau- und Stiftungstätigkeit sowie des Heiligenkults.
- Entwicklung des Heiligenkults in Rom vom 2. bis zum 8. Jahrhundert
- Das Translationsverbot und seine Auswirkungen auf die Reliquienpolitik
- Die Bedeutung von Translationen, Bau- und Stiftungstätigkeit für den Heiligenkult
- Die Rolle der Päpste im Wandel des Heiligenkults
- Der Einfluss der Reliquien auf das Pilgerwesen und die Liturgie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Heiligenkults in Rom vom 2. Jahrhundert bis zum 8. Jahrhundert. Es geht auf die Verehrung von Märtyrern, Bischöfen, Bekennern und Kirchenstiftern ein und erläutert die Bedeutung von Reliquien im Kontext des christlichen Grab- und Totenkults. Im zweiten Kapitel wird die Zeit vor dem 8. Jahrhundert genauer betrachtet, insbesondere das Translationsverbot und die Praxis der Reliquienteilung. Das Kapitel zeigt, wie sich diese Praktiken im 8. und 9. Jahrhundert veränderten und welche Rolle die Päpste dabei spielten.
Schlüsselwörter
Heiligenkult, Reliquien, Translationen, Bau- und Stiftungstätigkeit, Päpste, Liber Pontificalis, Rom, 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich der Heiligenkult im 8. und 9. Jahrhundert?
In dieser Zeit kam es in Rom zu einem massiven Aufschwung durch die systematische Erhebung und Überführung (Translation) von Gebeinen aus den Katakomben in die Kirchen innerhalb der Stadtmauern.
Was war das Translationsverbot in Rom?
Bis zum 8. Jahrhundert galt in Rom ein striktes Verbot, die Gräber der Märtyrer zu öffnen oder Gebeine zu bewegen. Reliquien wurden meist nur in Form von Berührungsreliquien (z.B. Tücher) verteilt.
Welche Rolle spielten die Päpste bei der Reliquienpolitik?
Päpste wie Paul I. oder Gregor IV. nutzten Translationen, um neue Kirchen zu weihen, das Pilgerwesen zu fördern und ihre eigene Macht sowie die sakrale Bedeutung Roms zu stärken.
Warum wurden Reliquien geteilt?
Die Teilung ermöglichte es, die Heiligkeit eines Märtyrers an mehreren Orten gleichzeitig präsent zu machen, was besonders für die Gründung neuer Klöster und Kirchen im Frankenreich wichtig war.
Was ist der „Liber Pontificalis“?
Der Liber Pontificalis ist eine Sammlung von Papstbiographien und dient als zentrale historische Quelle für die Bau- und Stiftungstätigkeit sowie die Reliquienübertragungen im mittelalterlichen Rom.
Wie hängen Heiligenverehrung und Kirchenbau zusammen?
Der Bau prächtiger Kirchen diente oft als würdiger Rahmen für die neu überführten Reliquien, wodurch die Kirchen zu bedeutenden spirituellen Zentren und Pilgerzielen wurden.
- Quote paper
- Sebastian Wiesneth (Author), 2016, Heiligenkult und Reliquienpolitik im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355733