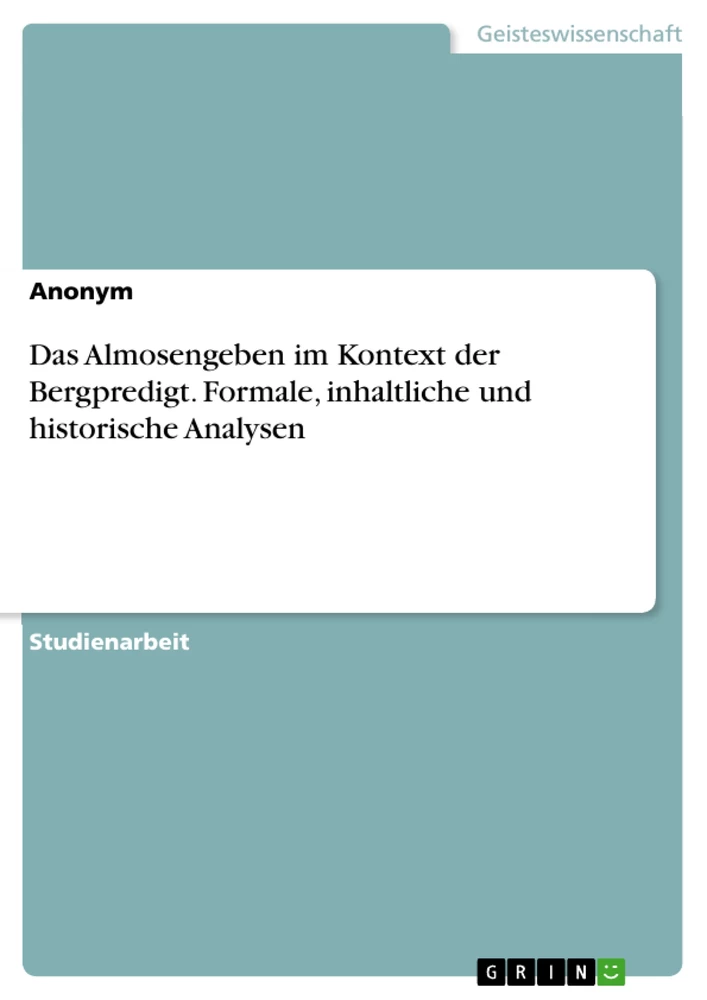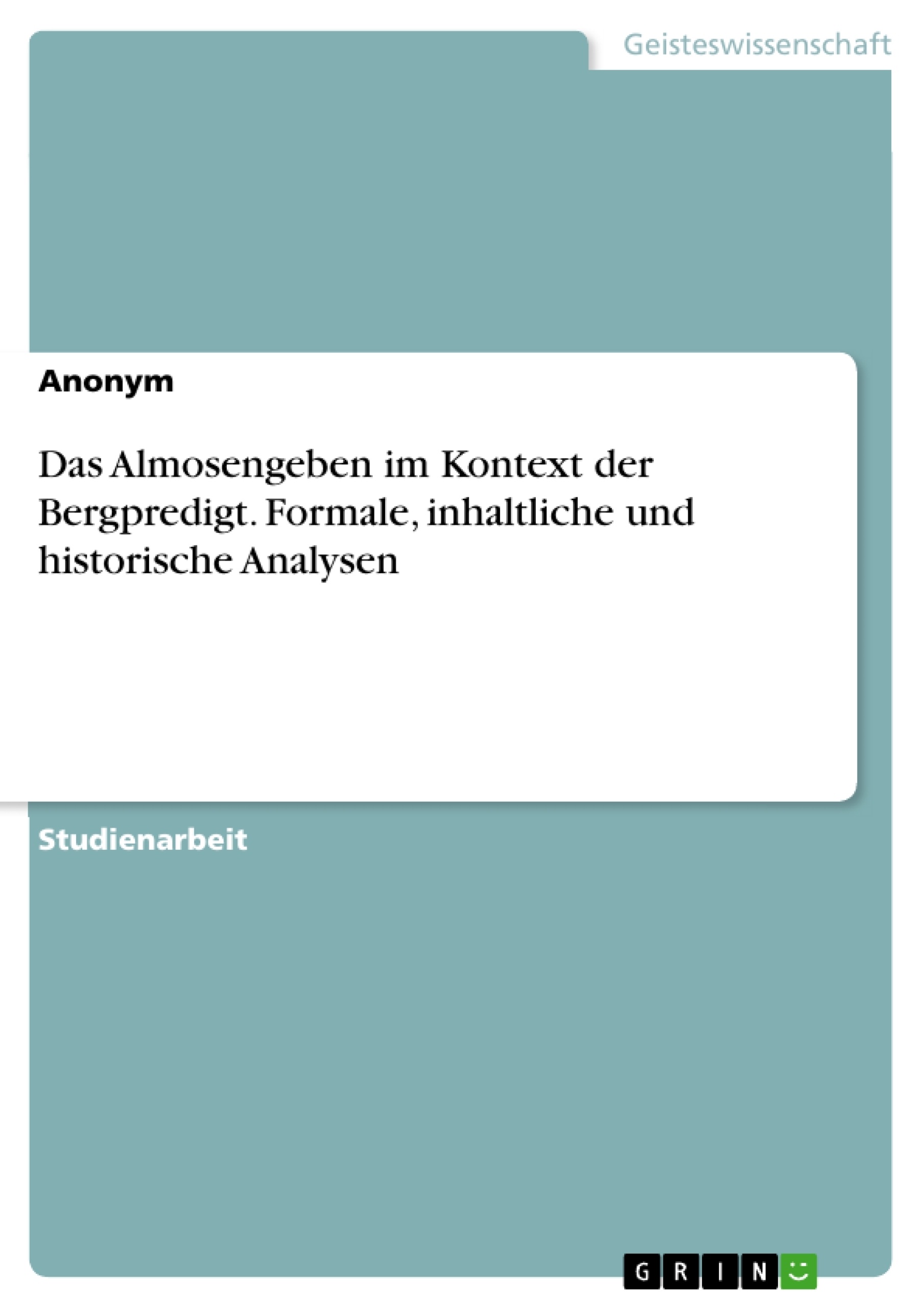Die Bergpredigt im Evangelium nach Matthäus umfasst viele verschiedene Lehren des christlichen Glaubens und der christlichen Glaubenspraxis. In diesem schriftlichen Referat sollen die Verse 1-4 des sechsten Kapitels genauer betrachtet werden, in denen es um die Frömmigkeitsübung des Almosengebens geht. Nach einer Einordnung in den Kontext der Bergpredigt folgen eine formale und eine inhaltliche Analyse. Letztere umfasst sowohl eine Einordnung in den historischen Kontext als auch eine Auseinandersetzung mit dem Öffentlichkeitsaspekt und dem Lohngedanken, die in den Versen eine zentrale Rolle spielen.
Die Anweisungen zum Almosengeben folgen in der Bergpredigt auf die Antithesen. Venetz stellt fest, die Antithesen zeigen, worin die besondere, von Jesus geforderte Gerechtigkeit besteht (Mt. 5,20). In dem nachfolgenden Text steht die Frage nach dem „Wie“ im Mittelpunkt, die innere Absicht wird nun thematisiert und anhand von drei Frömmigkeitsübungen konkretisiert. Es besteht eine große Gefahr der Überheblichkeit, die aus dieser besonderen Gerechtigkeit, Frömmigkeit und Nachfolge resultiert. Venetz betont in diesem Zusammenhang, dass in besagtem Abschnitt der Bergpredigt nicht neue Themen besprochen werden, sondern vielmehr eine Vertiefung der geforderten Gerechtigkeit stattfindet.
Das Almosengeben sollte folglich ebenso im Kontext der nachfolgenden Verse gesehen werden (Mt. 6, 1-18), in denen auch das Beten und Fasten vertieft werden. Wengst fasst das Thema dieses Abschnittes mit der Aufforderung zusammen, Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit anzustreben, die sich von einer weltlichen Gerechtigkeit unterscheiden. Diese drei Frömmigkeitsübungen sind zentrale Bestandteile des jüdischen und christlichen Glaubens und werden von Matthäus unter dem Begriff der Gerechtigkeit zusammengefasst.
Matthäus benutzt diese drei im Alltag eines Juden bekannten Frömmigkeitsübungen, um die Differenzierung zwischen einem Handeln vor Gott und einem Handeln vor den Menschen deutlich zu machen. Während das Almosengeben eine Beziehung zum Nächsten ausdrückt, umfasst das Beten die Beziehung zu Gott. Das Fasten wiederum stellt eine Auseinandersetzung mit sich selbst dar, ein Blick ins eigene Innere als religiöse Erfahrung. Dass diese Übungen nicht nur inhaltlich aufeinander aufbauen und zueinander passen, soll im weiteren Schritt die formale Analyse der Verse zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale Struktur
- Historischer Kontext des Almosengebens
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Öffentlichkeit vs. Verborgenheit
- Der Lohngedanke
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat analysiert Matthäus 6,1-4 im Kontext der Bergpredigt, insbesondere die Anweisungen zum Almosengeben. Die Zielsetzung ist eine umfassende Untersuchung der formalen und inhaltlichen Aspekte dieser Verse, unter Berücksichtigung des historischen Kontextes und der zentralen Themen Öffentlichkeit/Verborgenheit und der Erwartung eines Lohnes.
- Formale Struktur der Verse 1-4
- Historischer Kontext des Almosengebens im ersten Jahrhundert
- Das Spannungsfeld zwischen öffentlichem Handeln und innerer Frömmigkeit
- Der Aspekt des Lohnes und seine theologische Bedeutung
- Die Einbettung in die Gesamtkonzeption der Bergpredigt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Fokus auf Matthäus 6,1-4 im Rahmen der Bergpredigt. Sie positioniert die Analyse der Verse im Kontext der Frömmigkeitsübungen Almosengeben, Beten und Fasten und betont die Notwendigkeit, diese im Lichte der vorhergehenden Antithesen (Mt 5,20) zu verstehen. Die Einleitung verweist auf die zentrale Bedeutung der inneren Absicht und des Verhältnisses zu Gott als entscheidende Aspekte der "Gerechtigkeit" im Sinne Matthäus'. Die Bezugnahme auf Venetz und Wengst unterstreicht die Relevanz der Thematik in der bestehenden Forschung.
Formale Struktur: Dieses Kapitel analysiert die einheitliche Struktur der drei Frömmigkeitsübungen (Almosengeben, Beten, Fasten) in Matthäus 6,1-18. Es hebt die strukturelle Ähnlichkeit der Verse hervor, mit einem Imperativ im ersten Vers, der eine allgemeine Mahnung ausspricht, gefolgt von einer negativen Darstellung des unangemessenen Verhaltens und einer positiven Beschreibung der richtigen Handlungsweise. Betz' Einordnung der Verse als Kultdidache wird zitiert, und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Interpretationen von Wengst und Betz im Hinblick auf die formale Struktur werden beleuchtet. Der Fokus liegt auf der klug komponierten und in sich geschlossenen Struktur des Textes.
Historischer Kontext des Almosengebens: Dieser Abschnitt beleuchtet den historischen Hintergrund des Almosengebens zur Zeit Matthäus'. Er hebt die Abwesenheit einer staatlichen Armenversorgung hervor und betont die Abhängigkeit bedürftiger Menschen von der Nächstenliebe. Die Pflicht zum Almosengeben gemäß der Tora (3.Mo 19,9ff) wird erwähnt. Der Abschnitt thematisiert die Praxis öffentlicher Almosenspenden in Synagogen und die damit verbundene öffentliche Anerkennung der Spender, gegen die Matthäus sich möglicherweise wendet. Die Bezugnahme auf Wengst und Weder unterstreicht, wie die Matthäus-Verse im Lichte dieser gängigen Praxis zu verstehen sind.
Schlüsselwörter
Bergpredigt, Matthäus 6,1-4, Almosengeben, Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Öffentlichkeit, Verborgenheit, Lohn, historischer Kontext, formale Analyse, inhaltliche Analyse, Heuchelei, innere Haltung, Gottesverhältnis.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Matthäus 6,1-4
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf Matthäus 6,1-4 im Kontext der Bergpredigt. Im Mittelpunkt stehen die Anweisungen zum Almosengeben, betrachtet unter formalen, inhaltlichen und historisch-kontextuellen Aspekten.
Welche Aspekte werden untersucht?
Die Untersuchung umfasst die formale Struktur der Verse (Einheitlichkeit, Imperative, positive und negative Beschreibungen), den historischen Kontext des Almosengebens im ersten Jahrhundert (Abwesenheit staatlicher Armenhilfe, Bedeutung der Nächstenliebe, öffentliche Almosenspenden), sowie die inhaltlichen Schwerpunkte wie das Spannungsfeld zwischen öffentlicher Handlung und innerer Frömmigkeit und die theologische Bedeutung des Lohnaspekts. Die Einbettung in die Gesamtkonzeption der Bergpredigt wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse?
Ziel ist eine umfassende Untersuchung der formalen und inhaltlichen Aspekte von Matthäus 6,1-4, unter Berücksichtigung des historischen Kontextes und der zentralen Themen Öffentlichkeit/Verborgenheit und der Erwartung eines Lohnes. Die Analyse zielt darauf ab, ein tiefes Verständnis der Anweisungen zum Almosengeben im ursprünglichen Kontext zu erreichen.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Analyse bezieht sich auf die Werke von Venetz, Wengst, Betz und Weder, um die Thematik im Licht bestehender Forschung zu beleuchten und unterschiedliche Interpretationen der formalen Struktur und des historischen Kontextes zu diskutieren.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Bergpredigt, Matthäus 6,1-4, Almosengeben, Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Öffentlichkeit, Verborgenheit, Lohn, historischer Kontext, formale Analyse, inhaltliche Analyse, Heuchelei, innere Haltung und das Gottesverhältnis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur formalen Struktur, zum historischen Kontext des Almosengebens, sowie einen Schlussteil. Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Welche Interpretationen werden verglichen?
Die Analyse vergleicht und kontrastiert die Interpretationen von Wengst und Betz hinsichtlich der formalen Struktur der Verse und beleuchtet die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Bedeutung der Almosengabe im Kontext der damaligen Praxis.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext?
Der historische Kontext ist entscheidend für das Verständnis von Matthäus 6,1-4. Die Abwesenheit staatlicher Armenfürsorge und die gängige Praxis öffentlicher Almosenspenden beeinflussen die Interpretation der Verse und die Kritik Matthäus' an einer oberflächlichen Frömmigkeit.
Welche Rolle spielt die "innere Haltung"?
Die "innere Haltung" und das Verhältnis zu Gott werden als entscheidende Aspekte der "Gerechtigkeit" im Sinne Matthäus' hervorgehoben. Die Analyse betont die Bedeutung der inneren Absicht bei der Ausübung der Frömmigkeit.
Welche Schlussfolgerung zieht die Analyse?
(Die konkrete Schlussfolgerung der Analyse ist nicht explizit in der gegebenen Textvorlage enthalten. Sie müsste aus der vollständigen Analyse extrahiert werden.)
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Das Almosengeben im Kontext der Bergpredigt. Formale, inhaltliche und historische Analysen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355807