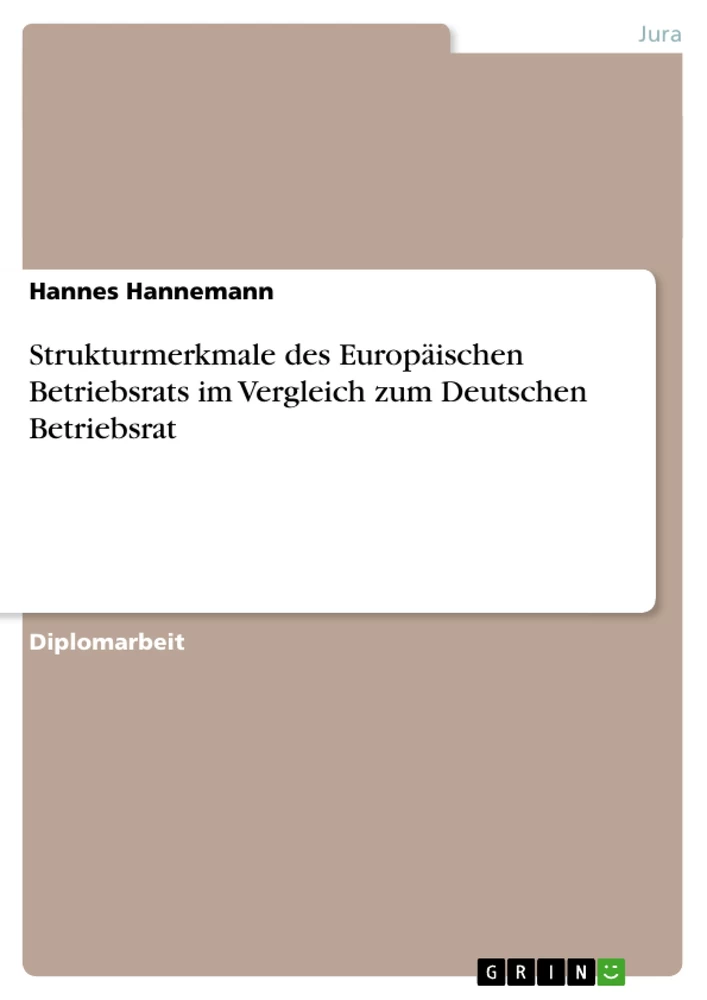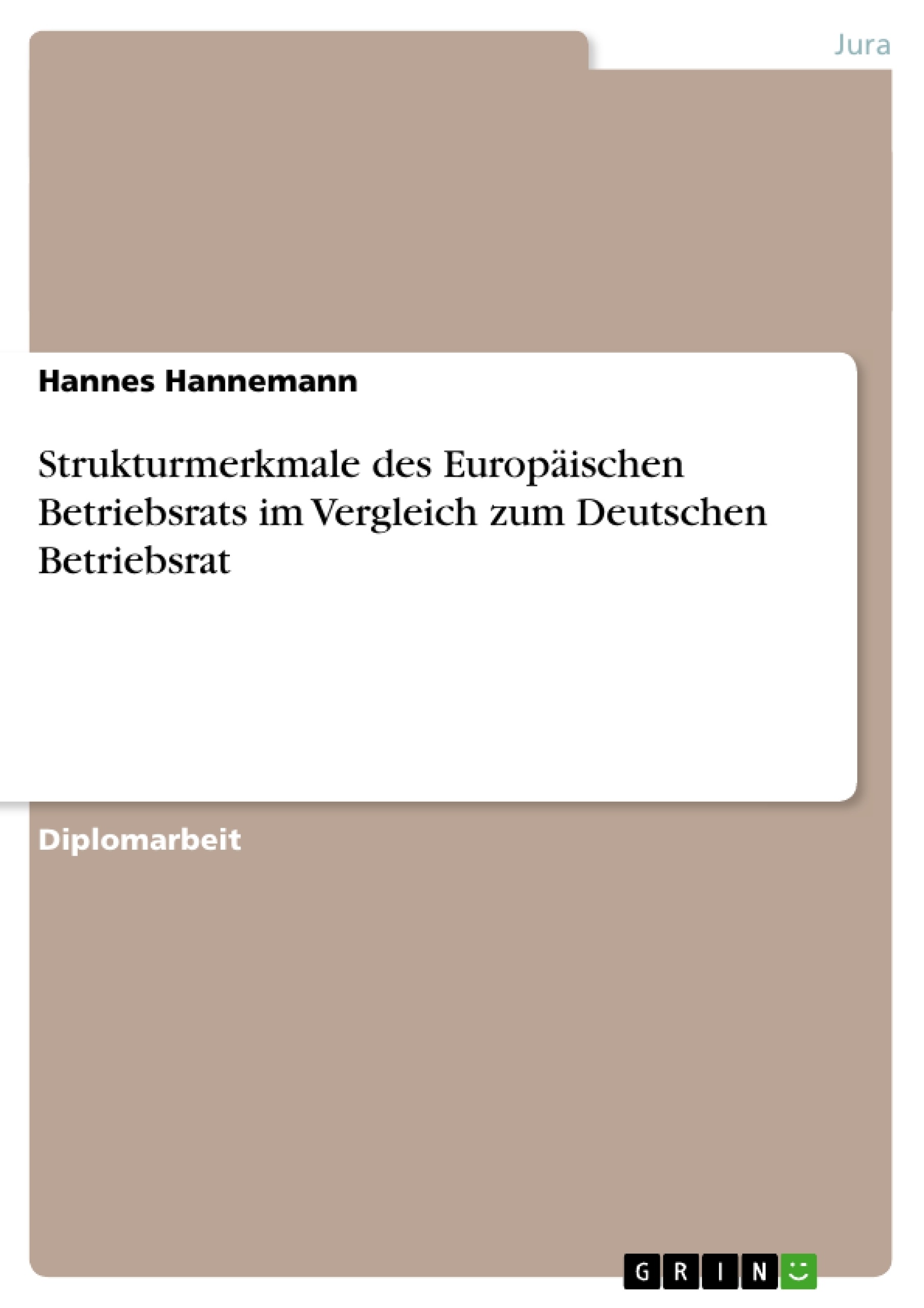Mit der zunehmenden Industrialisierung entstand in Deutschland aber auch in anderen europäischen Industriegesellschaften ein wachsendes Bedürfnis die sozialen und wirtschaftlichen Missstände zu beseitigen. Sozialtheoretiker verlangten die Schaffung von Interessenvertretungen in den Fabriken. Diese Forderungen gipfelten in einer Fabrikordnung, die in Deutsch-land von der konstituierenden Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848 erörtert, aber nie Gesetz wurde. Erst 1905 wurde die Bildung von Arbeiterausschüssen für Betriebe von mehr als 100 Arbeitnehmern im Bereich des Bergbaus zwingend vorgeschrieben. Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 enthielt in Art. 165 WRV erstmals eine verfassungsrechtliche Garantie der betrieblichen Mitbestimmung. Das Betriebsrätegesetz (BetrRG) wurde 1920 für die kollektive Mitbestimmung auf Betriebsebene geschaffen. Der erreichte Stand fiel den Nationalsozialisten zum Opfer Es wurde durch ein Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit abgelöst. Erst das Kontrollratsgesetz Nr. 22 gestattete die Einrichtung und Tätigkeit von Betriebsräten zur Wahrnehmung der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Arbeiter und Angestellten. Mit In-Kraft-Treten des Grundgesetzes 1949 ging der Bundesgesetzgeber daran, das Recht der Mitbestimmung neu zu ordnen. 1
Die internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen sind in den letzten Jahrzehnten ständig gewachsen. Kein Land kann heute Wirtschaftspolitik betreiben, ohne auf Wirkungen außerhalb des eigenen Territoriums Rücksicht zu nehmen und ohne Faktoren zu bedenken, die wirtschaftliche Aspekte anderer Länder betreffen. Die Römischen Verträge sind durch die Einheitliche Europäischen Akte mit dem Ziel der Weiterentwicklung des Gemeinsamen Marktes zu einem europäischen Binnenmarkt geändert worden. Nicht nur die Europäisierung hat Einfluss auf die staatliche Planung und Gestaltung, auch die vielen in verschiedenen Staaten wirkenden Unternehmen, deren Handel und Investitionen Begleiter wirtschaftlicher Verzahnung vieler Staaten sind, beeinflussen die Arbeitswelt. Dieser Fülle von Auslandsbeziehungen hat das deutsche Recht gerecht zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Merkmale des Deutschen Betriebsrat
- Die Betriebsverfassung
- Grundsätze der Zusammenarbeit im Betrieb
- Gremien und Organisationen
- Die Einigungsstelle
- Beteiligungsrechte der AN durch den BR
- Exkurs Unternehmensmitbestimmung
- Merkmale des Europäischen Betriebsrat
- Rechtsnormen vor und nach Erlass der Richtlinie 94/45/EG
- Die Richtlinie 94/45/EG
- Die Umsetzung der EBR-RL in den Beitrittsländern
- Der Europäische Betriebsrat im Vergleich zum Deutschen Betriebsrat
- Der Europäische Betriebsrat ein transnationales Recht
- Unterrichtung und Anhörung
- Arbeitsweise Europäischer Betriebsräte
- Schlussfolgerungen und Ausblick
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Strukturmerkmale des Europäischen Betriebsrats im Vergleich zum Deutschen Betriebsrat. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme aufzuzeigen und die rechtlichen Grundlagen, insbesondere die europäische Richtlinie 94/45/EG, zu beleuchten.
- Rechtliche Grundlagen des Europäischen Betriebsrats
- Vergleichende Analyse der Strukturmerkmale
- Untersuchung der Mitbestimmungsrechte
- Zusammenarbeit und Konfliktlösung im transnationalen Kontext
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der Betriebsratslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeitnehmermitbestimmung ein und beleuchtet die historische Entwicklung des deutschen Betriebsrats sowie den Einfluss der europäischen Integration auf die Arbeitswelt. Sie unterstreicht die Notwendigkeit von Mindestregelungen für die Mitbestimmung in transnationalen Unternehmen.
- Merkmale des Deutschen Betriebsrats: Dieses Kapitel stellt die Struktur und die Funktionsweise des deutschen Betriebsrats dar. Es analysiert die rechtlichen Grundlagen des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) und die verschiedenen Mitbestimmungsrechte in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Vor- und Nachteile der kollektiven Mitbestimmung werden ebenfalls erörtert.
- Merkmale des Europäischen Betriebsrats: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Europäischen Betriebsrat. Es fokussiert auf die Europäische Richtlinie 94/45/EG und ihre Umsetzung in den Beitrittsländern. Die Struktur und Funktionsweise des Europäischen Betriebsrats sowie seine Kompetenzen werden vorgestellt.
- Der Europäische Betriebsrat im Vergleich zum Deutschen Betriebsrat: In diesem Kapitel werden die Strukturmerkmale des Europäischen Betriebsrats mit denen des Deutschen Betriebsrats verglichen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme werden beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf die Mitbestimmungsrechte und die Zusammenarbeit in transnationalen Unternehmen.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Strukturmerkmalen des Europäischen Betriebsrats im Vergleich zum Deutschen Betriebsrat. Schlüsselbegriffe sind: Betriebsverfassung, Mitbestimmung, Arbeitnehmervertretung, Europäische Richtlinie 94/45/EG, transnationales Recht, Unternehmenstransparenz, Informations- und Konsultationsrechte, Arbeitnehmerbeteiligung, Konfliktlösung, europäische Integration, Arbeitsrecht.
- Quote paper
- Hannes Hannemann (Author), 2004, Strukturmerkmale des Europäischen Betriebsrats im Vergleich zum Deutschen Betriebsrat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35591