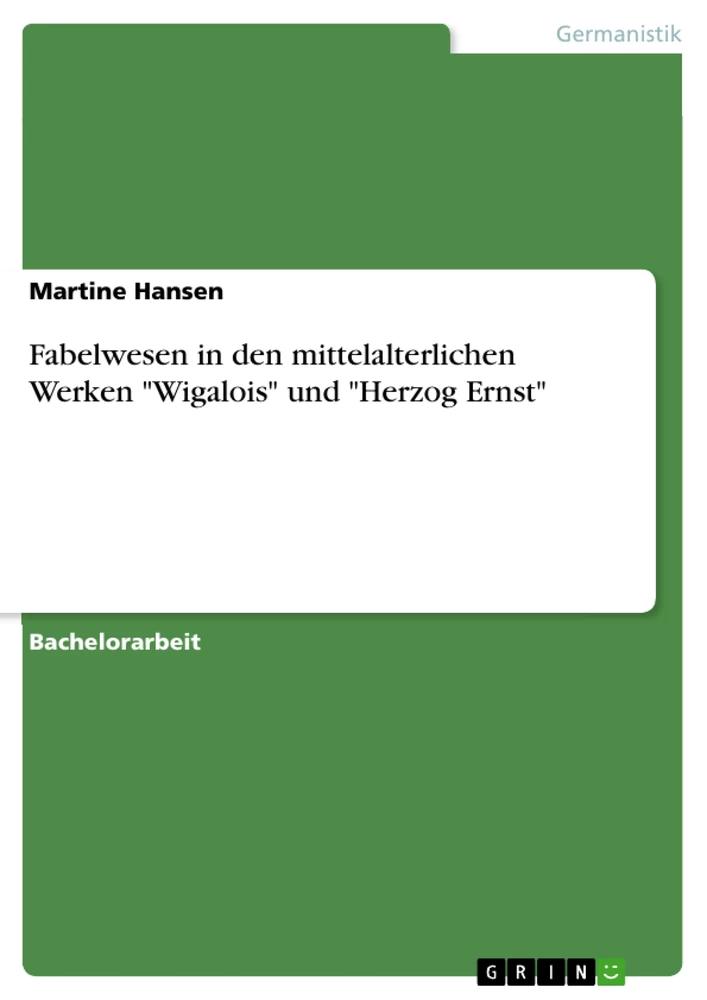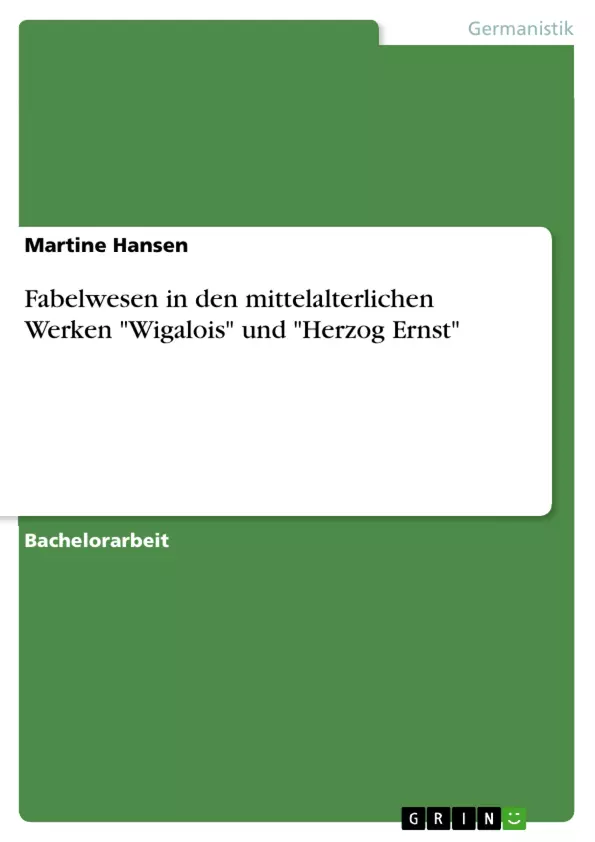Die folgende Arbeit soll einen Einblick in die Welt der Fabelwesen in der Antike und im Mittelalter, insbesondere in der mittelalterlichen Literatur, gewähren und ihre Funktionen erläutern. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Terminologie und bietet einen Ausblick auf die Wissenschaft der Zeit. Im zweiten Teil werden, im Rahmen der Primärtexte Wigalois von Wirnt von Grafenberg und Herzog Ernst, die einzelnen Fabelwesen in beiden Texten vorgestellt. Damit verbunden sind die Fragen, welche Funktionen sie im Mittelalter einnehmen und warum sie Teil der mittelalterlichen Literatur sind. Die Erörterung beider Fragen erstreckt sich über die Arbeit und kann somit als roter Faden angesehen werden.
Die Arbeit gliedert sich in vier große Teile. Nach der Einleitung wird sich dem theoretischen und geschichtlichen Teil gewidmet, in dem auf die Rolle und Bedeutung der Fabelwesen in der Antike und im mittelalterlichen Weltbild aufmerksam gemacht wird. Dazu herangezogen wird das Buch Monster im Mittelalter von Rudolf Simek, das sowohl über die Geschichte und Darstellung der Fabelwesen in der Antike und im Mittelalter Auskunft gibt als auch sich auf Theorien von wichtigen antiken Dichtern bezieht. Im Folgenden werden einzeln die Fabelwesen in den beiden Primärtexten vorgestellt und teilweise wird auch auf deren Relationen mit den antiken Dichtungen eingegangen. Dieser praktische Teil umfasst also in erster Linie das Werk Wigalois von Wirnt von Grafenberg, gefolgt vom anonym überlieferten Herzog Ernst.
Der letzte Teil befasst sich mit den Ergebnissen und der Schlussbetrachtung. In diesem Teil soll einerseits geklärt werden, welche Unterschiede und Ähnlichkeiten es zwischen beiden Texten bezüglich der Fabelwesen gibt, und andererseits, welche Funktion und Rolle die Fabelwesen in beiden Texten einnehmen. Im Fazit werden noch einmal die wichtigsten Punkte des theoretischen Teils hervorgehoben und anschließend werden meine Ergebnisse zusammengefasst und interpretiert. Im Gegensatz zu uns tritt der mittelalterliche Mensch, insbesondere der Held und der Ritter, öfters in Kontakt mit Fabelwesen. Zumindest wird dies in der mittelhochdeutschen Literatur sehr gut zum Ausdruck gebracht. Wegen ihres Reichtums an übernatürlichen Wesen fiel die Wahl auf den Artusroman Wigalois, in dem etwas bekanntere Fabelwesen vorkommen, und Herzog Ernst, in dem wir mit kuriosen Geschöpfen konfrontiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Fabelwesen: Ausblick auf die Wissenschaft der Zeit
- Darstellung der Fabelwesen im Weltbild des mittelalterlichen Menschen
- Drache, Riese und Zwerg als zentrale Fabelwesen in der mittelalterlichen Literatur
- Wigalois
- Hintergrundinformationen zum Werk
- Fabelwesen in der Handlung des Wigalois
- Der Zwerg
- Zwei Riesen
- Das wunderbare Tier vor der Burg
- Der Drache Pfetan
- Das Waldweib Ruel
- Marrien
- Herzog Ernst
- Hintergrundinformationen zum Werk
- Fabelwesen in der Handlung des Herzog Ernst
- Die Kranichmenschen
- Die Greifen
- Die Einsterne/Zyklopen
- Die Platthufe
- Die Ohren
- Die Pygmäen
- Die Riesen
- Ergebnisse und Schlussbetrachtung
- Umgang mit und Funktion von den Fabelwesen in beiden Texten
- Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen beiden Texten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle und Bedeutung von Fabelwesen in der mittelalterlichen Literatur, insbesondere in den Werken Wigalois von Wirnt von Grafenberg und Herzog Ernst. Die Arbeit soll einen Einblick in die Welt der Fabelwesen in der Antike und im Mittelalter gewähren und ihre Funktionen erläutern.
- Die Darstellung von Fabelwesen in der mittelalterlichen Literatur
- Die Funktionen von Fabelwesen in den Werken Wigalois und Herzog Ernst
- Die Bedeutung von Fabelwesen im Weltbild des mittelalterlichen Menschen
- Die Unterschiede und Ähnlichkeiten im Umgang mit Fabelwesen in beiden Texten
- Die Beziehung zwischen antiken Quellen und der Verwendung von Fabelwesen im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit dar. Der theoretische Teil beschäftigt sich mit der Terminologie und bietet einen Ausblick auf die Wissenschaft der Zeit. Hier werden die Fabelwesen im Weltbild des mittelalterlichen Menschen und ihre Darstellung in der Literatur beleuchtet. Die Kapitel über Wigalois und Herzog Ernst präsentieren die einzelnen Fabelwesen in beiden Texten und beleuchten ihre Funktionen im Mittelalter. Der letzte Teil behandelt die Ergebnisse und die Schlussbetrachtung, wobei die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen beiden Texten hinsichtlich der Fabelwesen und deren Funktion beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Fabelwesen, Mittelalter, Literatur, Wigalois, Herzog Ernst, Antike, Weltbild, Funktion, Wunderwesen, Drache, Riese, Zwerg, Monster, Mythologie, Wundervölker.
Häufig gestellte Fragen
Welche Fabelwesen kommen in 'Wigalois' vor?
Im Artusroman 'Wigalois' treten unter anderem Zwerge, Riesen, der Drache Pfetan und das Waldweib Ruel auf.
Welche kuriosen Geschöpfe findet man in 'Herzog Ernst'?
In 'Herzog Ernst' begegnet der Held Kranichmenschen, Greifen, Zyklopen (Einsternen), Platthufen und Pygmäen.
Welche Funktion hatten Fabelwesen im Mittelalter?
Sie dienten als Spiegelbild des mittelalterlichen Weltbildes, stellten Herausforderungen für den Ritter dar und verwiesen oft auf moralische oder religiöse Konzepte.
Gibt es Parallelen zwischen antiken und mittelalterlichen Fabelwesen?
Ja, die Arbeit untersucht, wie mittelalterliche Autoren auf antike Dichtungen und Theorien (z. B. über Monster) zurückgriffen.
Warum sind Fabelwesen so präsent in der mittelhochdeutschen Literatur?
Für den mittelalterlichen Menschen waren diese Wesen Teil seiner Realität und dienten in der Literatur dazu, die Tugenden des Helden im Kampf gegen das Übernatürliche zu beweisen.
- Quote paper
- Martine Hansen (Author), 2016, Fabelwesen in den mittelalterlichen Werken "Wigalois" und "Herzog Ernst", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355982