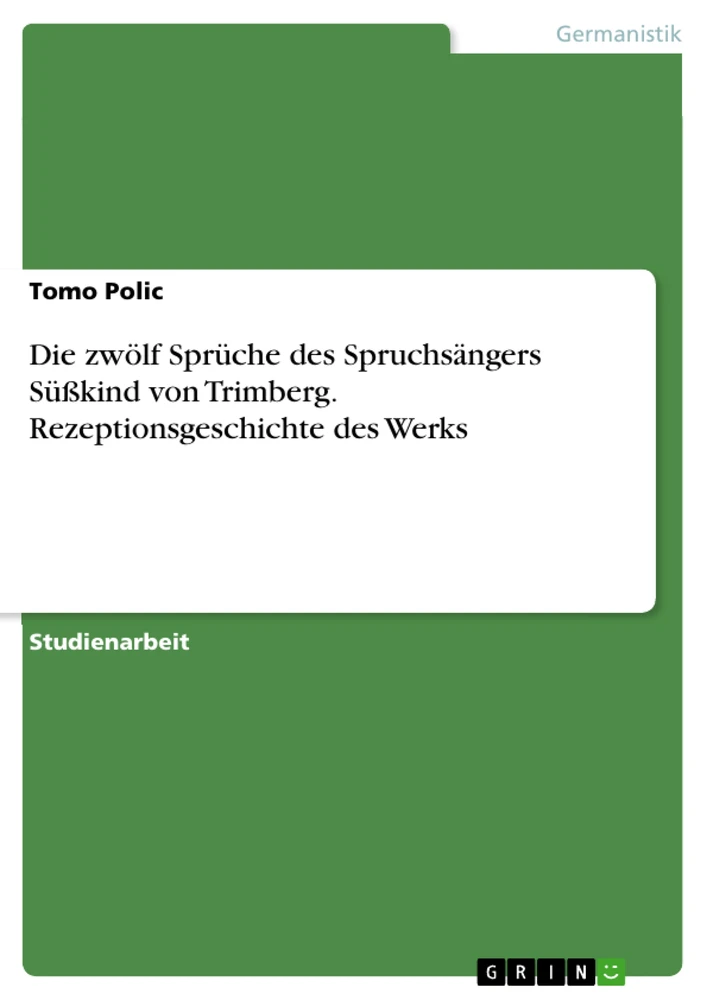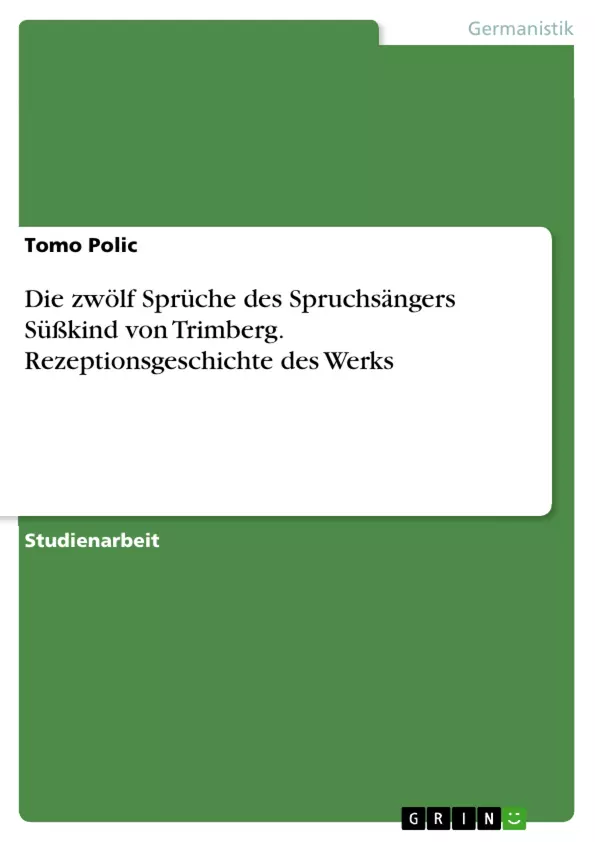In meiner Hausarbeit werde ich das Werk und die Rezeptionsgeschichte des Werks des Spruchsängers Süßkind von Trimberg vorstellen. Es sind zwölf Sangsprüche, die in der Großen Heidelberger Liederhandschrift (Codex Palatinus Germanicus 848=C) als Werke Süßkinds von Trimberg aufgeführt sind. Sie sind in sechs Tönen überliefert. Insgesamt 157 Zeilen Lyrik sind auch die einzigen Spuren, die der Sänger Süßkind hinterlassen hat.
Zwei Verse werden in der Forschung besonders kontrovers diskutiert. Denn dort geht es um die Herkunft des Dichters. In den besagten Versen singt Süßkind:
ich will in alter juden leben
mich hinnan fürwert ziehen. (V, 2,7f)
Die Tatsache, dass ein mittelalterlicher deutscher Dichter ein Jude sein könnte, inspirierte und irritierte nicht wenige Germanisten und Mittelalterspezialisten von dem 19. Jahrhundert bis heute und zeigte sich als ideale Projektionsfläche für jede Art der Fiktionalisierung und Instrumentalisierung. Es entstanden Unmengen an Sekundärliteratur, aber auch Biografien, Erzählungen und ein Roman.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sangspruchdichtung
- Süẞkind von Trimberg
- Eintrag in der Großen Heidelberger Liederhandschrift
- Das begleitende Bild in der Heidelberger Liederhandschrift
- Süskind von Trimberg – ein Jude oder nicht?
- Fiktion, Spruchdichtung und Geschichte im Josef Kasteins „Süßkind von Trimberg oder die Tragödie der Heimatlosigkeit“
- Minnesangskritik
- Rezeption der ausgewählten Gedichte
- Gotteslob („Küng herre“, III, 1)
- Frauenlob („Ir mannes krône“, III, 2)
- Armutsklage ( V, 1,2)
- Die Apologie: die Fabel über den Wolf (VI)
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Werk und der Rezeptionsgeschichte des Spruchsängers Süßkind von Trimberg. Sie analysiert die zwölf Sangsprüche, die in der Großen Heidelberger Liederhandschrift (Codex Palatinus Germanicus 848=C) als Werke Süßkinds von Trimberg aufgeführt sind. Der Fokus liegt insbesondere auf der Frage nach der Herkunft des Dichters, die durch zwei kontroverse Verse in den Sangsprüchen angestoßen wird. Darüber hinaus werden ausgewählte Gedichte aus dem Werk rezipiert und die Entwicklung der Forschung zu Süßkind von Trimberg in den Kontext der Geschichte des Antisemitismus gestellt.
- Die Spruchdichtung im Mittelalter
- Die Rezeption der Werke Süßkinds von Trimberg
- Die Frage nach der Identität und Herkunft des Dichters
- Der Einfluss von Antisemitismus auf die Forschung zu Süßkind von Trimberg
- Die Darstellung von Fiktion und Geschichte in der Literatur über Süßkind von Trimberg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Werk und die Rezeptionsgeschichte des Spruchsängers Süßkind von Trimberg vor. Sie beleuchtet die Bedeutung der zwölf Sangsprüche in der Großen Heidelberger Liederhandschrift und hebt die Kontroverse um die Herkunft des Dichters hervor.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Gattung der Sangspruchdichtung im Mittelalter. Es beleuchtet die soziale Stellung der Spruchsänger, ihre Beziehung zu den Minnesängern und die Themen, die sie in ihren Werken behandelten.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf Süßkind von Trimberg selbst. Es analysiert die ausgewählten Gedichte aus seinem Werk und diskutiert die kontroverse Frage nach seiner jüdischen Herkunft. Es werden verschiedene Interpretationen und Rezeptionen der Werke Süßkinds beleuchtet und die Debatte um seine Identität im historischen Kontext beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sangspruchdichtung, Süßkind von Trimberg, Mittelalter, Literaturgeschichte, Rezeptionsgeschichte, Antisemitismus, Jüdische Identität, Fiktion, Geschichte, Minnesang, Großen Heidelberger Liederhandschrift.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Süßkind von Trimberg?
Süßkind von Trimberg war ein Spruchsänger des 13. Jahrhunderts, dessen Werk in der Großen Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) überliefert ist.
War Süßkind von Trimberg tatsächlich Jude?
Diese Frage ist in der Forschung umstritten. Die Annahme stützt sich auf zwei Verse, in denen er singt, fortan 'in alter Juden Leben' ziehen zu wollen.
Was ist Sangspruchdichtung?
Eine mittelalterliche Gattung der Lyrik, die im Gegensatz zum Minnesang oft moralische, religiöse oder politische Themen behandelt.
Welche Rolle spielt der Antisemitismus in der Rezeption?
Die Forschung zu Süßkind wurde oft durch zeitgenössische Vorurteile geprägt; im 19. und 20. Jahrhundert diente er mal als Identifikationsfigur, mal als Zielscheibe antisemitischer Ausgrenzung.
Was zeigt das Bild im Codex Manesse zu Süßkind?
Das Bild zeigt ihn mit einem Hut, der oft als 'Judenhut' interpretiert wird, was die Theorie seiner jüdischen Herkunft stützt.
- Quote paper
- Tomo Polic (Author), 2015, Die zwölf Sprüche des Spruchsängers Süßkind von Trimberg. Rezeptionsgeschichte des Werks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356283