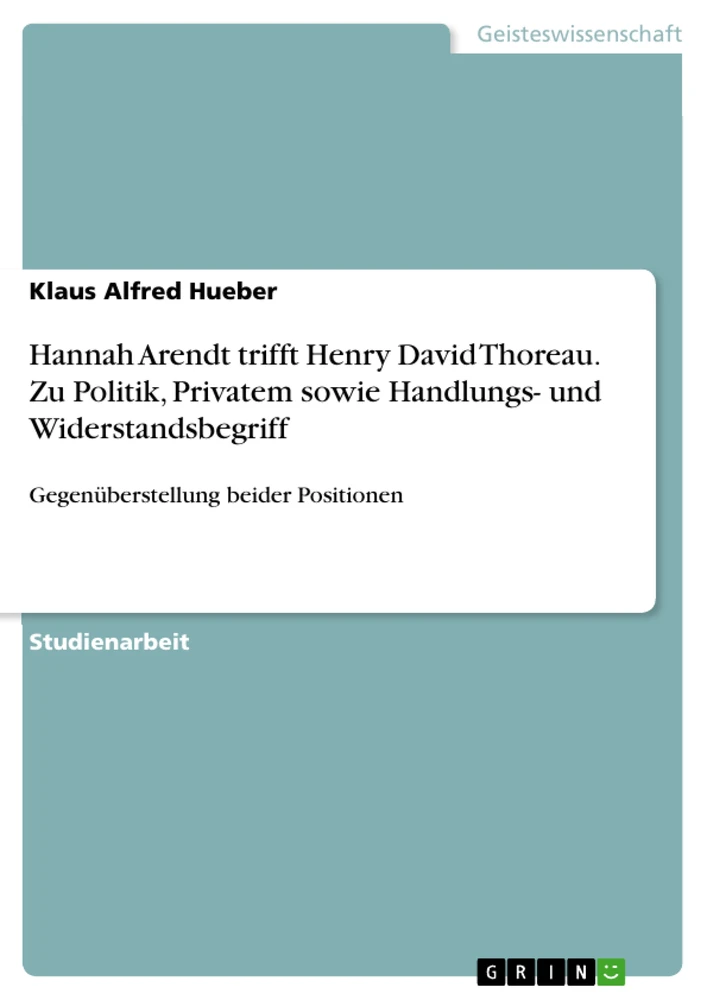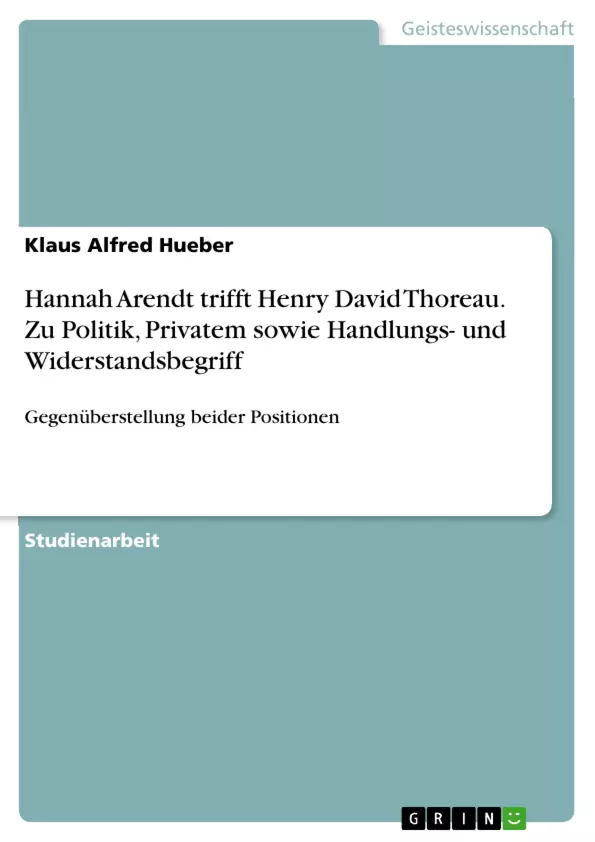Diese Arbeit vergleicht die Ansichten der beiden Philosophen Hannah Arendt und Henry David Thoreau in Bezug auf Politik und die Relation von Öffentlichkeit und Privatem. Zudem soll Arendts Begriff des „Handelns“ mit Thoreaus „gewaltlosem Widerstand“ verglichen werden.
Nur unschwer lässt sich schon früh erkennen, dass Hannah Arendts und Henry David Thoreaus Verständnisse von Politik und Gesellschaft schwer zu vereinbaren sind. Schon auf den ersten Blick zeigen sich eher tiefgreifende Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Arendt begreift sich hierbei als politische Denkerin und setzt sich scharfsinnig mit politischen Systemen auseinander. Thoreau gehört hingegen zu der seltenen Gattung von Philosophen, die ihre eigene Philosophie eher leben als lehren. So verfasst er nur wenige Essays sowie ein autobiographisches Werk und kein umfassendes philosophisches System. Ohnehin kann wohl sein Tagebuch als der größte Fundus für seine Ansichten gelten, und nicht zuletzt aufgrund des Umfangs – es besteht nämlich aus 47 Bänden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Was ist Politik?
- Wer ist frei?
- Revolution! - Aber wie?
- Das ist öffentlich oder doch privat?
- Abschließende Bemerkungen
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die unterschiedlichen politischen Philosophien von Hannah Arendt und Henry David Thoreau zu vergleichen und zu kontrastieren. Es wird untersucht, wie beide Denker das Wesen der Politik, die Bedeutung der Freiheit und das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privaten verstehen. Darüber hinaus soll Arendts Konzept des „Handelns“ mit Thoreaus „gewaltlosem Widerstand“ in Beziehung gesetzt werden.
- Arendts politische Philosophie im Vergleich zu Thoreau
- Das Wesen der Politik bei Arendt und Thoreau
- Die Bedeutung der Freiheit in beiden Denksystemen
- Das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privaten bei Arendt und Thoreau
- Der Vergleich von Arendts „Handeln“ und Thoreaus „gewaltlosem Widerstand“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zwei unterschiedlichen Positionen von Arendt und Thoreau vor. Arendt sieht in der Politik eine Möglichkeit, die gemeinsame Welt durch Handeln und Sprechen zu gestalten, während Thoreau eine skeptische Haltung gegenüber staatlicher Macht einnimmt und individuelles Gewissen über politische Gesetze stellt.
Das erste Kapitel des Hauptteils beschäftigt sich mit der Frage „Was ist Politik?“. Arendt betrachtet die griechische Polis als ein Ideal politischer Gemeinschaft, in der Entscheidungen durch Sprache und Überzeugung getroffen werden. Thoreau hingegen plädiert für eine minimale Staatsgewalt und setzt individuelles Handeln und Gewissen in den Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die politische Philosophie, Hannah Arendt, Henry David Thoreau, Politik, Freiheit, Öffentlichkeit, Privates, Handeln, Gewaltloser Widerstand. Darüber hinaus spielen die griechische Polis, die Sklavenpolitik, die Bürgerrechtsbewegung und der Anarchismus eine wichtige Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Politikverständnis von Hannah Arendt?
Arendt versteht Politik als Raum des gemeinsamen Handelns und Sprechens in der Öffentlichkeit, idealisiert am Beispiel der griechischen Polis.
Was bedeutet „gewaltloser Widerstand“ bei Thoreau?
Thoreau plädiert dafür, dem individuellen Gewissen mehr Gewicht beizumessen als staatlichen Gesetzen, und propagiert zivilen Ungehorsam gegen ungerechte Systeme.
Wie unterscheiden sich Arendt und Thoreau in Bezug auf das Private?
Arendt trennt strikt zwischen dem öffentlichen Raum (Politik) und dem privaten Raum (Notwendigkeit). Thoreau hingegen rückt das Individuum und sein privates Gewissen ins Zentrum des politischen Handelns.
Was meint Arendt mit dem Begriff des „Handelns“?
Handeln ist für Arendt die höchste Form menschlicher Tätigkeit, durch die Menschen ihre Einzigartigkeit zeigen und gemeinsam eine Welt gestalten.
Warum ist der Vergleich dieser beiden Denker spannend?
Er zeigt das Spannungsfeld zwischen kollektivem politischen Engagement (Arendt) und individueller moralischer Integrität sowie Staatskritik (Thoreau) auf.
- Quote paper
- Klaus Alfred Hueber (Author), 2017, Hannah Arendt trifft Henry David Thoreau. Zu Politik, Privatem sowie Handlungs- und Widerstandsbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356295