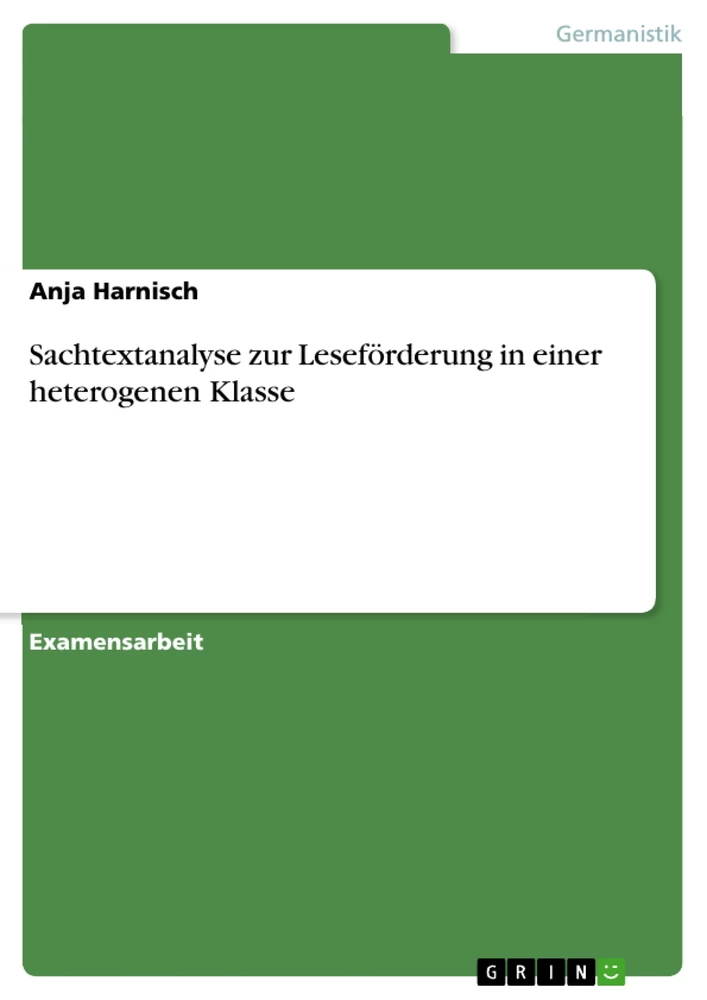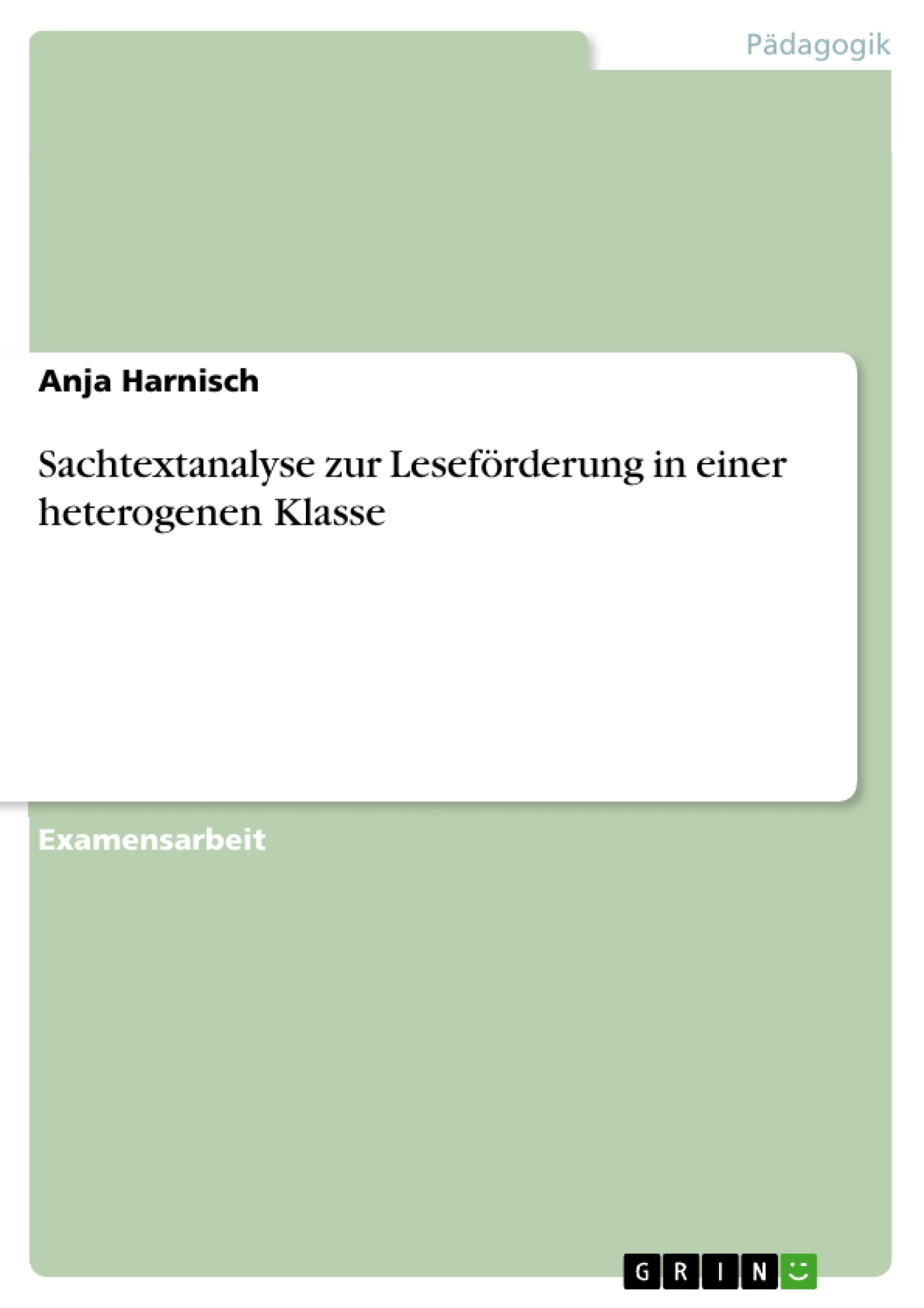Eine hohe Lesekompetenz gehört zu den zentralen kognitiven Basisfähigkeiten, die unumgänglich sind, um sich in der Wissensgesellschaft orientieren und etablieren zu können. Die spezifische Förderung von Lesekompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund stellt hier eine ganz besondere Herausforderung für die Lehrkräfte dar. So können Kinder mit Deutsch als Zweitsprache beispielsweise aus bildungsnahen oder bildungsfernen Elternhäusern kommen. Manche Kinder beherrschen ihre Erstsprache perfekt und verfügen über eine klare semantische und syntaktische Grundlage. Andere Kinder wiederum beherrschen weder ihre Erstsprache noch die Zweitsprache Deutsch genügend. Manche Schülerinnen und Schüler sind perfekt integriert in unsere Gesellschaft, andere wiederum sprechen auch mit ihren Freunden nur ihre Muttersprache, was zu keiner ausreichenden Sprachkompetenz führen kann.
Diese große Heterogenität erschwert die Förderarbeit der Lehrkräfte ungemein. In dieser Folgenden Arbeit soll an einem Unterrichtsbeispiel zum Thema Sachtextanalyse, ein möglicher Förderansatz erlautert werden. Die vorangestellte Theoriebetrachtung soll den Rahmen dafür liefern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sachtexte
- 2.1. Anforderungen an den Leser
- 2.2. Analytischer Umgang mit Sachtexten
- 2.3. Herausforderungen im DaZ-Unterricht
- 3. Lesekompetenz
- 3.1. Definition Lesen
- 3.2. Funktionen des Lesens
- 3.3. Begriffsklärung: Lesekompetenz (allgemein)
- 3.4. Modelle der Lesekompetenz
- 3.4.1. Lesekompetenzmodell nach PISA
- 3.4.2. Konzept der Lesesozialisationsforschung
- 3.4.3. Ein didaktischer Lesekompetenz-Begriff
- 3.4.4. Das Mehrebenenmodell nach ROSEBROCK/NIX
- 3.4.4.1. Die Prozessebene
- 3.4.4.2. Die Subjektebene
- 3.4.4.3. Die soziale Ebene
- 4. Lesefördermethoden
- 4.1. Laut- und Vielleseverfahren
- 4.2. Lesestrategien
- 4.3. Leseanimation
- 5. Lesesozialisation
- 5.1. Was ist Lesesozialisation?
- 5.2. Sozialisationsinstanzen
- 5.2.1. Familie
- 5.2.2. Schule
- 5.2.3. Peers
- 6. Unterrichtspraktischer Teil
- 6.1. Didaktische Vorüberlegungen – Beschreibung der Klasse
- 6.2. Äußere Rahmenbedingungen
- 6.3. Lernvoraussetzungen im Bezug auf das Thema
- 6.4. Legitimation des Themas
- 7. Planung, Darstellung und Reflexion der Einzelstunden
- 7.1 Planung und Darstellung der ersten beiden Unterrichtsstunden
- 7.2. Teilziele
- 7.3. Reflexion
- 7.4. Planung und Durchführung der dritten und vierten Stunde
- 7.5. Teilziele
- 7.6. Reflexion
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Leseförderung in heterogenen Klassen, insbesondere im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache. Ziel ist es, einen möglichen Förderansatz anhand einer Unterrichtssequenz zur Sachtextanalyse zu erläutern und theoretische Grundlagen bereitzustellen.
- Sachtextanalyse und Anforderungen an den Leser
- Lesekompetenzmodelle und deren didaktische Relevanz
- Lesefördermethoden und -strategien
- Der Einfluss der Lesesozialisation
- Praktische Umsetzung der Leseförderung in einer heterogenen Klasse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung hoher Lesekompetenz in der Wissensgesellschaft und die besonderen Herausforderungen der Leseförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund. Sie beschreibt die Heterogenität in den Lernvoraussetzungen dieser Schüler und kündigt die Untersuchung eines Förderansatzes anhand einer Unterrichtssequenz zur Sachtextanalyse an. Die Arbeit wird in einen theoretischen und einen praktischen Teil gegliedert.
2. Sachtexte: Dieses Kapitel beleuchtet das Thema Sachtexte im Kontext des Deutschunterrichts, insbesondere seit den PISA-Studien. Es untersucht die Anforderungen an den Leser, den analytischen Umgang mit Sachtexten und die spezifischen Herausforderungen für Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Es legt den Grundstein für das Verständnis der im praktischen Teil behandelten Sachtextanalyse.
3. Lesekompetenz: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Erörterung des Begriffs "Lesekompetenz". Es analysiert verschiedene Modelle der Lesekompetenz, darunter das PISA-Modell und das Konzept der Lesesozialisationsforschung. Ein didaktischer Lesekompetenzbegriff wird vorgestellt, der die kognitiven Fähigkeiten, das Selbstbild und das soziale Umfeld einbezieht und die strukturierte Erfassung von Lernprozessen betont, um Fördermaßnahmen zielgerichtet ableiten zu können. Das Mehrebenenmodell nach Rosebrock/Nix wird im Detail erläutert.
4. Lesefördermethoden: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Methoden und Strategien zur Leseförderung, um Kinder für das Lesen zu begeistern. Es werden konkrete Fördermaßnahmen vorgestellt, die die Vielfältigkeit didaktischer Möglichkeiten zur Unterstützung leseschwacher Schüler aufzeigen. Es stellt verschiedene Lesestrategien im Detail vor.
5. Lesesozialisation: Der Fokus liegt auf der Rolle der Sozialisationsinstanzen (Familie, Schule, Peers) in der Leseentwicklung. Es wird dargelegt, wie der Umgang mit dem Medium Buch in der Kindheit die Lesegewohnheiten prägt.
6. Unterrichtspraktischer Teil: Dieser Teil beschreibt die Planung und Durchführung einer Unterrichtseinheit zum Thema Sachtextanalyse für die siebte Jahrgangsstufe. Er erläutert didaktische Vorüberlegungen, die Beschreibung der Lerngruppe, die äußeren Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen. Die Legitimation des gewählten Themas wird begründet.
7. Planung, Darstellung und Reflexion der Einzelstunden: Dieser Abschnitt dokumentiert die Planung, Durchführung und Reflexion der Unterrichtsstunden. Teilziele und Reflexionen zu den einzelnen Stunden werden detailliert ausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Leseförderung, heterogene Klasse, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Sachtextanalyse, Lesekompetenz, Lesesozialisation, Lesestrategien, Fördermethoden, Unterrichtsplanung, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Leseförderung in heterogenen Klassen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Leseförderung in heterogenen Klassen, insbesondere bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Im Fokus steht die Entwicklung und Umsetzung einer Unterrichtssequenz zur Sachtextanalyse, unterlegt mit relevanten theoretischen Grundlagen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Sachtextanalyse und die Anforderungen an den Leser, verschiedene Lesekompetenzmodelle und deren didaktische Relevanz, Lesefördermethoden und -strategien, den Einfluss der Lesesozialisation und die praktische Umsetzung der Leseförderung in einer heterogenen Klasse. Ein detaillierter Unterrichtspraktischer Teil mit Planung, Durchführung und Reflexion einer konkreten Unterrichtssequenz ist ebenfalls enthalten.
Welche Lesekompetenzmodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Lesekompetenzmodelle, darunter das PISA-Modell und das Konzept der Lesesozialisationsforschung. Ein didaktischer Lesekompetenzbegriff wird vorgestellt, der die kognitiven Fähigkeiten, das Selbstbild und das soziale Umfeld einbezieht. Das Mehrebenenmodell nach Rosebrock/Nix wird detailliert erläutert.
Welche Lesefördermethoden werden beschrieben?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Methoden und Strategien zur Leseförderung, einschließlich Laut- und Vielleseverfahren und konkreter Lesestrategien. Der Fokus liegt auf der Unterstützung leseschwacher Schüler in heterogenen Lerngruppen.
Welche Rolle spielt die Lesesozialisation?
Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Sozialisationsinstanzen (Familie, Schule, Peers) in der Leseentwicklung und zeigt, wie der Umgang mit dem Medium Buch in der Kindheit die Lesegewohnheiten prägt.
Wie ist der Unterrichtspraktische Teil aufgebaut?
Der Unterrichtspraktische Teil beschreibt die Planung und Durchführung einer Unterrichtseinheit zum Thema Sachtextanalyse für die siebte Jahrgangsstufe. Er umfasst didaktische Vorüberlegungen, die Beschreibung der Lerngruppe, die äußeren Rahmenbedingungen, die Lernvoraussetzungen und die Legitimation des gewählten Themas. Die Planung, Durchführung und Reflexion der einzelnen Unterrichtsstunden werden detailliert dokumentiert, inklusive Teilzielen und Reflexionen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Lehrkräfte im Deutschunterricht, insbesondere an Schulen mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache, sowie für alle, die sich mit Leseförderung und der didaktischen Arbeit mit Sachtexten auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Leseförderung, heterogene Klasse, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Sachtextanalyse, Lesekompetenz, Lesesozialisation, Lesestrategien, Fördermethoden, Unterrichtsplanung, Reflexion.
- Citation du texte
- Anja Harnisch (Auteur), 2014, Sachtextanalyse zur Leseförderung in einer heterogenen Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356432