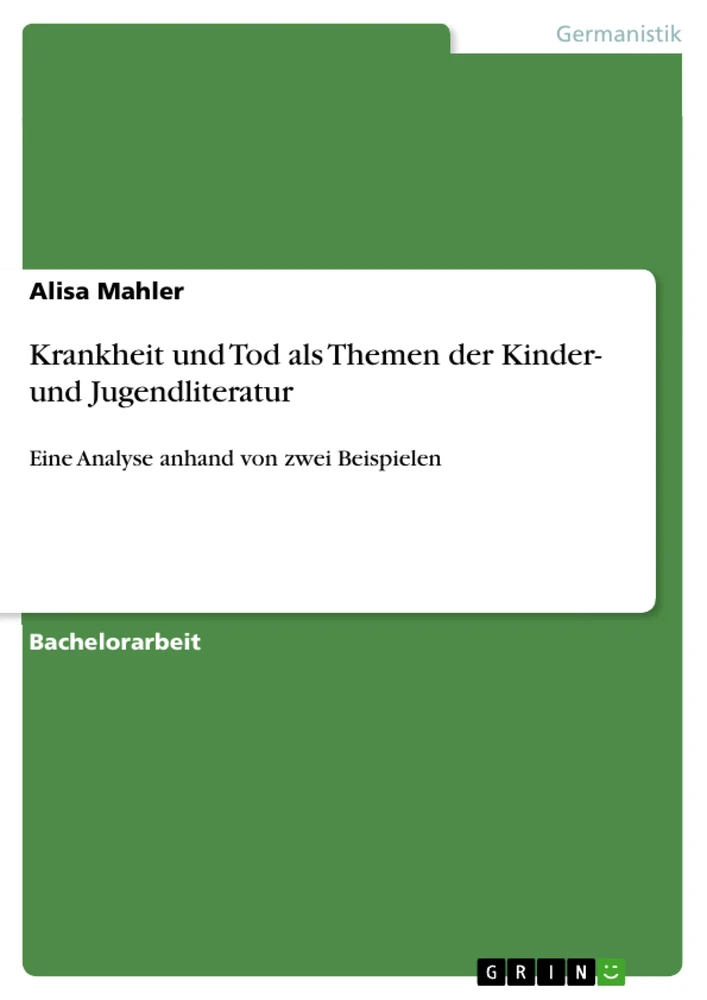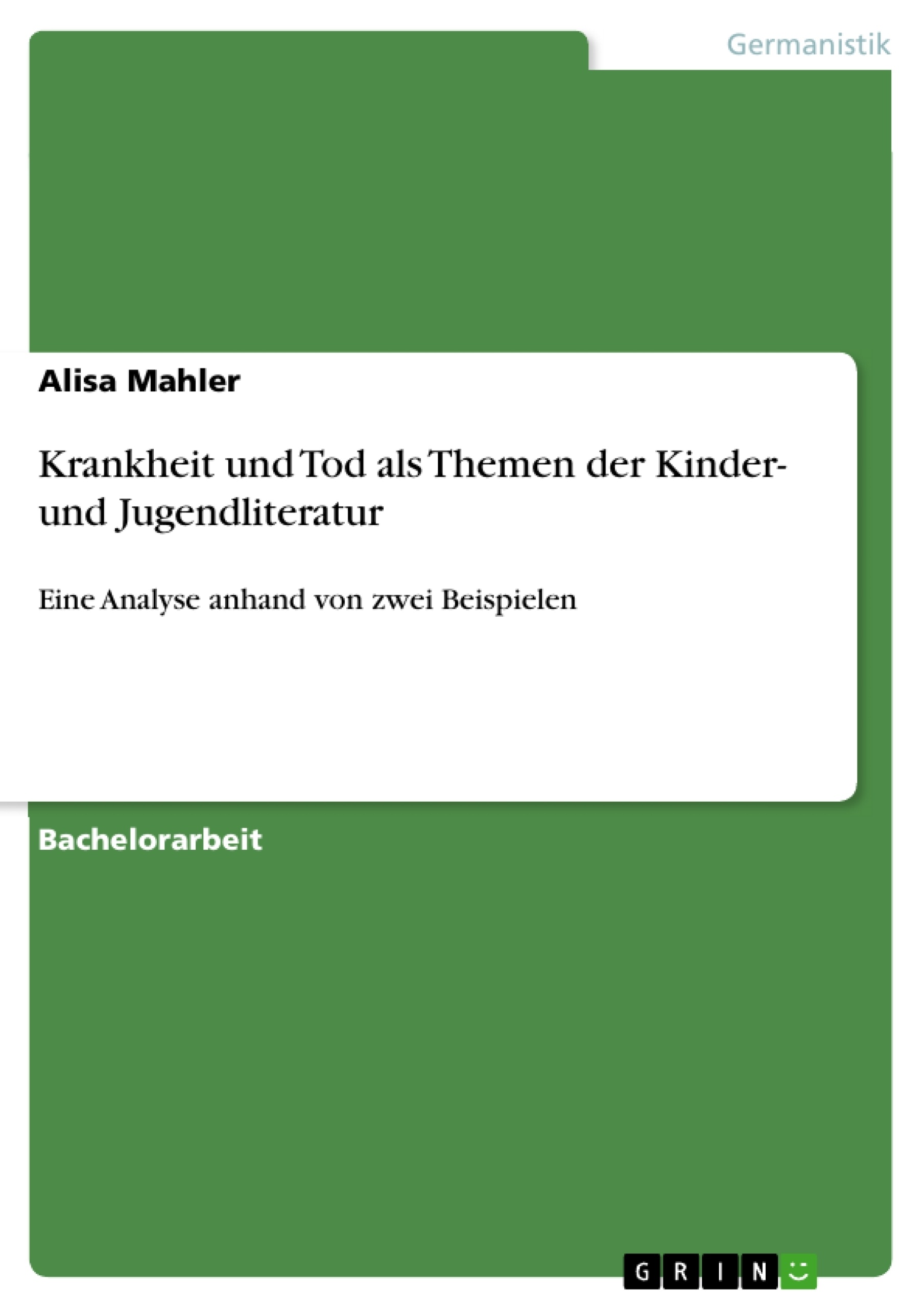Diese Bachelorarbeit analysiert die Darstellung des Themenkomplexes Krankheit und Tod in der Kinder- und Jugendliteratur anhand von zwei Beispielromanen. Zunächst werden dafür die theoretischen Grundlagen geklärt. Zum einen wird der Begriff der Kinder- und Jugendliteratur erläutert, zum anderen werden wesentliche erzähltheoretische Methoden beleuchtet, die nachfolgend zur Analyse der beiden Beispielromane dienen. Es werden Aspekte verschiedener Theoretiker herangezogen, um verschiedene wissenschaftlich fundierte Sichtweisen auf die ausgewählten Romane zu gewinnen.
Anschließend werden pädagogisch und entwicklungspsychologisch fundierte Aspekte verschiedener Theoretiker verwendet, um einen Einblick in die Entwicklung von Todeskonzepten und -vorstellungen bei Kindern und Jugendlichen zu geben. Diese Entwicklung wird gemäß verschiedener Altersgruppen dargestellt.
Schließlich erfolgt die Analyse der ausgewählten Romane. Es handelt sich hierbei um John Greens "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" und Sally Nicholls Roman "Wie man unsterblich wird".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Zum Begriff der Kinder- und Jugendliteratur
- 2.2 Erzähltheoretische Grundlagen der Kinder- und Jugendliteratur
- 2.2.1 Das,,Wie\" des Erzählens
- 2.2.1.1 Zeit, Modus, Stimme
- 2.2.1.2 Erzählinstanzen
- 2.2.2 Das,,Was“ des Erzählens
- 2.2.2.1 Die Handlung
- 2.2.2.2 Die Figuren
- 2.2.2.3 Der Raum
- 2.2.2.4 Spannung und Spannungsaufbau
- 2.2.1 Das,,Wie\" des Erzählens
- 3. Kinder begegnen dem Tod
- 3.1 Todeskonzepte und -vorstellungen von Kindern und Jugendlichen
- 3.1.1 Todesvorstellungen von Kindern bis sechs Jahre
- 3.1.2 Todesvorstellungen von Kindern zwischen sechs und zehn Jahren
- 3.1.3 Todesvorstellungen von Kindern ab zehn Jahren und Jugendlichen
- 3.2 Zur Selbst- und Fremderfahrung von tödlichen Erkrankungen
- 3.2.1 Selbsterfahrung von Kindern in Krankheit und Sterben
- 3.2.2 Das Erleben der Krankheit durch Kinder und ihr Umfeld
- 3.1 Todeskonzepte und -vorstellungen von Kindern und Jugendlichen
- 4. Analyse ausgewählter Romane aus der Kinder- und Jugendliteratur
- 4.1 Analyse von John Greens Das Schicksal ist ein mieser Verräter
- 4.1.1 Analyse der Ebene des „Wie“ des Erzählens
- 4.1.1.1 Analyse der Zeit
- 4.1.1.2 Analyse des Modus
- 4.1.1.3 Analyse der Stimme und Erzählinstanz
- 4.1.2 Analyse der Ebene des „Was\" des Erzählens
- 4.1.2.1 Analyse der Hauptfigur Hazel
- 4.1.2.2 Analyse der Räume
- 4.1.2.3 Analyse des Spannungsaufbaus
- 4.1.3 Das Erleben von Krankheit und Tod im Roman
- 4.1.3.1 Hazels Selbsterfahrung
- 4.1.3.2 Die Fremderfahrung durch Hazels Umfeld
- 4.1.1 Analyse der Ebene des „Wie“ des Erzählens
- 4.2 Analyse von Sally Nicholls Wie man unsterblich wird
- 4.2.1 Analyse der Ebene des „Wie“ des Erzählens
- 4.2.1.1 Analyse der Zeit
- 4.2.1.2 Analyse des Modus
- 4.2.1.3 Analyse der Stimme und Erzählinstanz
- 4.2.2 Analyse der Ebene des „Was\" des Erzählens
- 4.2.2.1 Analyse der Hauptfigur Sam
- 4.2.2.2 Analyse des Raums
- 4.2.2.3 Analyse des Spannungsaufbaus
- 4.2.3 Das Erleben von Krankheit und Tod im Roman
- 4.2.3.1 Sams Selbsterfahrung
- 4.2.3.2 Die Fremderfahrung durch Sams Umfeld
- 4.2.1 Analyse der Ebene des „Wie“ des Erzählens
- 5. Fazit und Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Darstellung von Krankheit und Tod in der Kinder- und Jugendliteratur. Im Mittelpunkt stehen die Romane „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ von John Green und „Wie man unsterblich wird“ von Sally Nicholls. Ziel der Arbeit ist es, die jeweiligen Darstellungsperspektiven auf Krankheit und Tod in beiden Romanen zu analysieren und zu vergleichen.
- Analyse der erzähltheoretischen Ebene des "Wie" und des "Was"
- Untersuchung der Selbsterfahrung von Krankheit und Tod aus der Perspektive der Protagonisten
- Betrachtung der Fremderfahrung von Krankheit und Tod durch das Umfeld der Protagonisten
- Vergleich der Darstellungsperspektiven in den beiden Romanen
- Einordnung der Romane in den Kontext pädagogischer und entwicklungspsychologischer Erkenntnisse über Todeskonzepte von Kindern und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Darstellung von Krankheit und Tod in der Kinder- und Jugendliteratur ein. Es werden die beiden zu analysierenden Romane, „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ von John Green und „Wie man unsterblich wird“ von Sally Nicholls, vorgestellt und die Fragestellung der Arbeit definiert.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Romane. Es behandelt den Begriff der Kinder- und Jugendliteratur sowie wichtige erzähltheoretische Methoden. Die zwei Ebenen des Erzählens, das „Wie“ und das „Was“, werden anhand verschiedener Theoretiker analysiert.
Kapitel 3: Kinder begegnen dem Tod
Dieses Kapitel gibt einen Einblick in die Entwicklung von Todeskonzepten und -vorstellungen bei Kindern und Jugendlichen. Es betrachtet verschiedene Altersgruppen und untersucht die Selbst- und Fremderfahrung von tödlichen Erkrankungen aus pädagogisch-entwicklungspsychologischer Sicht.
Kapitel 4: Analyse ausgewählter Romane aus der Kinder- und Jugendliteratur
Dieses Kapitel analysiert die beiden Romane, „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ und „Wie man unsterblich wird“, auf die zuvor definierten erzähltheoretischen und inhaltlichen Ebenen. Es untersucht die Selbsterfahrung von Krankheit und Tod der Protagonisten sowie die Fremderfahrung durch ihr Umfeld.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendliteratur, Krankheit, Tod, Erzähltheorie, Selbsterfahrung, Fremderfahrung, Todeskonzepte, Jugendroman, Analyse, Vergleich.
- 4.1 Analyse von John Greens Das Schicksal ist ein mieser Verräter
- Arbeit zitieren
- Alisa Mahler (Autor:in), 2016, Krankheit und Tod als Themen der Kinder- und Jugendliteratur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356579