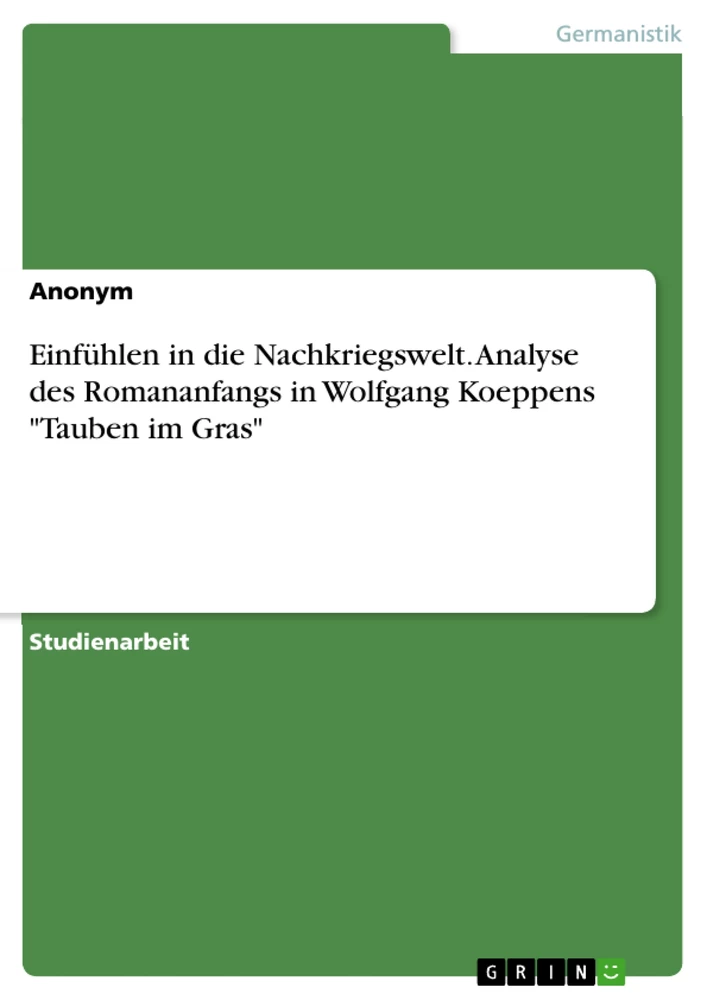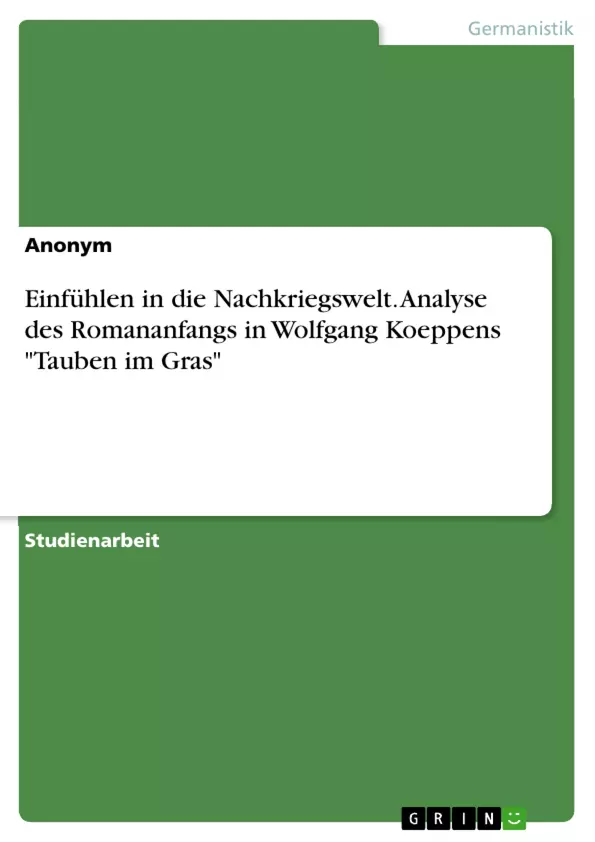In dieser Arbeit wird analysiert, wie bereits der Anfang des Romans "Tauben im Gras" von Wolfgang Koeppen den Leser auf der einen Seite in die Thematik der Nachkriegswelt einführt und auf der anderen Seite mit den stilistischen Mitteln Koeppens vertraut macht.
1951 ist der Krieg bereits vorbei und die Menschen sollten aufatmen können. Doch in "Tauben im Gras", der bedeutendsten literarischen Gestaltung der Nachkriegszeit, zeigt Wolfgang Koeppen die Realität. In mehr als hundert kürzeren und längeren Episoden fängt er aus unterschiedlichsten Perspektiven einerseits die Verwüstung des Krieges und die Traumata der Menschen ein und zeigt andererseits die Rückstände von Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft auf. Die Handlung des Romans beschränkt sich auf die Geschehnisse eines einzigen Tages in einer deutschen Großstadt (vermutlich handelt es sich um München). Dabei treten mehr als dreißig Charaktere aller Schichten und Nationen mit ihren individuellen Problemen wie Armut, Einsamkeit und Zukunftsängsten, die sich teilweise innerhalb der Handlung treffen, teilweise aber auch nicht, auf.
Koeppen beweist stilistisch experimentelle Kühnheit, indem er nicht an den literarischen Hauptstrom der Trümmer- und Kahlschlagliteratur nach 1945 anknüpft, sondern an die Tradition des modernen Romans des 20. Jahrhunderts. Oft wird sein Werk mit dem Roman "Ulysses" von Joyce und Döblins "Berlin Alexanderplatz" vergleichen. Der Einfluss von Joyce und Döblin macht sich bemerkbar, nicht nur, weil es sich bei allen drei Romanen um Großstadtromane handelt, sondern auch, weil das Montageprinzip, die Technik des Bewusstseinsstroms und die Einfügung von Zitaten bei diesen Romanen ähnlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Zur Thematik des Romans
- 2. Einführung in die Welt des Romans im Romananfang
- 2.1 Der erste Abschnitt: Die Grundstimmung
- 2.2 Präzisierung der Thematik im zweiten Abschnitt
- 3. Der Erzähler als Augur
- 4. Das Ende des Romans
- 5. Hintergründe in der Geschichte und zu Wolfgang Koeppen
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Roman „Tauben im Gras“ von Wolfgang Koeppen bietet einen tiefgründigen Einblick in die Nachkriegswelt Deutschlands. Er beleuchtet die Folgen des Krieges, die Traumata der Menschen und die anhaltenden Probleme von Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft.
- Die Folgen des Krieges und die Traumata der Menschen
- Die Präsenz von Antisemitismus und Rassismus in der Nachkriegsgesellschaft
- Die stilistische Experimentierfreude Koeppens und seine Abkehr von der Trümmerliteratur
- Die Verwendung von Montageprinzip, Bewusstseinsstrom und Zitaten als stilistische Mittel
- Die Einbettung der Handlung in eine deutsche Großstadt und die Darstellung der sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Zur Thematik des Romans
Die Einleitung skizziert die Thematik des Romans und stellt die Bedeutung von „Tauben im Gras“ als literarische Darstellung der Nachkriegszeit heraus. Sie beschreibt die Handlung des Romans, die sich auf einen einzigen Tag in einer deutschen Großstadt konzentriert, und stellt die verschiedenen Charaktere und ihre individuellen Probleme vor.
2. Einführung in die Welt des Romans im Romananfang
2.1 Der erste Abschnitt: Die Grundstimmung
Die Analyse des ersten Abschnitts des Romans zeigt, wie die Grundstimmung durch die Metapher der „unheilkündenden Vögel“ (die Flugzeuge) etabliert wird. Der Text beleuchtet die Wiederkehr des Krieges, die Präsenz der Gefahr und die unterschiedlichen Reaktionen der Figuren auf die apokalyptischen Vorzeichen.
2.2 Präzisierung der Thematik im zweiten Abschnitt
Der zweite Abschnitt präzisiert die Thematik, indem er die evolutionäre Entstehungsgeschichte des Erdöls in einer parataktischen Reihung beschreibt. Diese Beschreibung soll auf die Zusammenhänge zwischen Krieg und Natur sowie auf die Wiederholung von Gewalt und Zerstörung hinweisen.
Häufig gestellte Fragen zu „Tauben im Gras“
Was ist das zentrale Thema von Wolfgang Koeppens Roman?
Der Roman thematisiert die traumatische Realität der deutschen Nachkriegsgesellschaft an einem einzigen Tag im Jahr 1951.
Welche stilistischen Mittel verwendet Koeppen?
Koeppen nutzt moderne Techniken wie das Montageprinzip, den Bewusstseinsstrom und die Einfügung von Zitaten.
Wie wird die Nachkriegsstimmung im Romananfang etabliert?
Durch Metaphern wie die „unheilkündenden Vögel“ (Flugzeuge) wird eine Atmosphäre der latenten Gefahr und Unruhe geschaffen.
Warum wird Koeppen oft mit James Joyce verglichen?
Aufgrund seiner experimentellen Erzählweise und der Struktur als Großstadtroman weist sein Werk Parallelen zu Joyce’ „Ulysses“ auf.
Welche gesellschaftlichen Probleme greift der Roman auf?
Er zeigt die Fortexistenz von Rassismus, Antisemitismus sowie die Einsamkeit und Zukunftsangst der Menschen nach dem Krieg.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Einfühlen in die Nachkriegswelt. Analyse des Romananfangs in Wolfgang Koeppens "Tauben im Gras", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356632