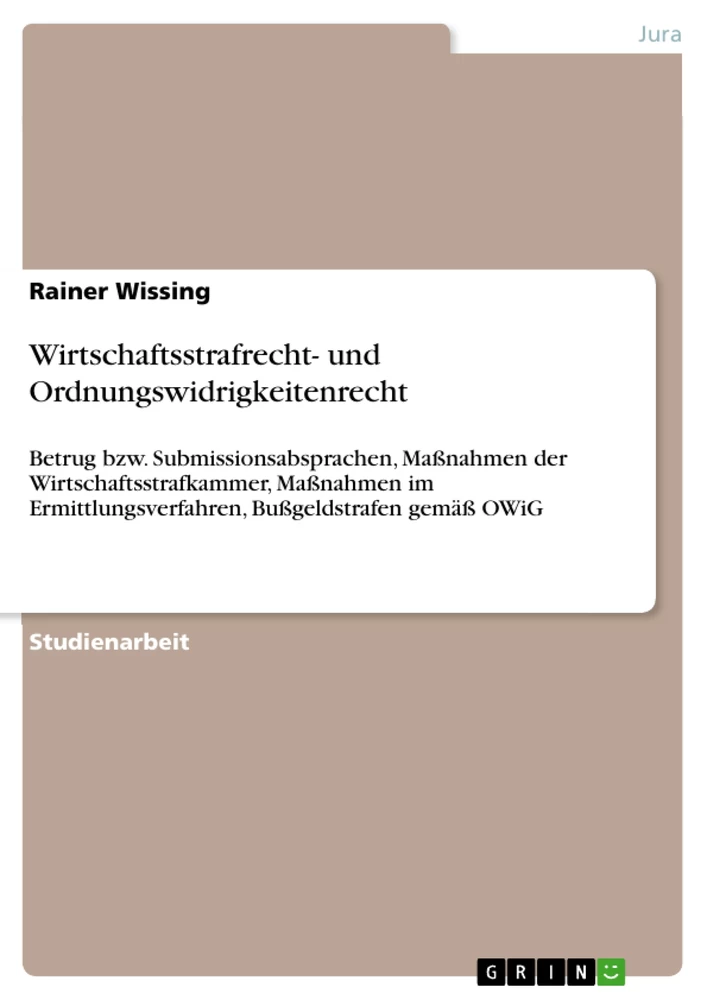Korruption ist der Missbrauch einer Vertrauensstellung in einer Funktion in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Politik u.a., um einen materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen, auf den kein rechtlich begründeter Anspruch besteht. Korruption bezeichnet i.w.S. Bestechlichkeit, Bestechung, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung.
Kernelement von korruptem Verhalten ist das Ausnutzen einer Machtposition für einen persönlichen Vorteil unter Missachtung universalistischer Verhaltensnormen, seien es moralische Standards, Amtspflichten oder Gesetze. Korruption ist eine soziale Interaktion, bei der die Beteiligten vorteilhafte Leistungen austauschen („win-win“-Situation), beispielsweise Entscheidungsbeeinflussung gegen Geldzahlungen. Korruption ist eine Art Kompensationsgeschäft, aber dennoch mehr als nur ein Tausch zwischen zwei Akteuren zu ihrem gegenseitigen Vorteil. Der Zusatz, dass es sich um einen illegalen Tausch handelt, ist nicht eindeutig: Hehlerei ist z.B. auch ein illegaler Tausch, aber keine Korruption. Man kann Korruption von anderen Austauschbeziehungen z.B. auf einem Markt unterscheiden, wenn man sie als ein Phänomen mit drei beteiligten Akteuren betrachtet, nämlich dem Bestechenden, dem Bestochenen und dem Auftraggeber des Bestochenen. Sie werden als Klient, Agent und Prinzipal bezeichnet (s. Prinzipal-Agent-Theorie). Prinzipal und Agent haben eine vertragliche Beziehung, in der der Prinzipal den Agenten mit einer Aufgabe betraut und ihm zur Erfüllung dieser Aufgabe ein Mittel überlässt und einen Spielraum gibt, innerhalb dessen er agieren kann. Dies ist die erwähnte Machtposition. Diese nutzt der Agent aus (oft gegen die Interessen des Prinzipals), um dem Klienten etwas im „Tausch“
anbieten zu können. Korruption bezeichnet die Aktivitäten des „Gebenden“ wie des „Empfängers“ (Vgl. Definition von Myrdal 1989: 405). Gesetzbücher nennen dies „aktive Bestechung“ und „passive Bestechung“ (Bestechlichkeit). Mindestens einer der Kooperationspartner missbraucht eine Macht- bzw. Vertrauensposition und gerät deshalb in einen Normkonflikt zwischen partikularistischen Normen und offiziellen und/oder universalistischen Normen. Die Beteiligten müssen abwägen, ob sie den erzielbaren Vorteil durch Korruption höher gewichten als die Risiken (die erwartbaren negativen Sanktionen) bei einer möglichen Aufdeckung.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- A. Strafbarkeit des L
- I. § 266 StGB, Untreue, Mißbrauchstatbestand, Treubruchtatbestand
- II. § 299 StGB, Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
- III. § 263 StGB, Betrug bzw. § 298 StGB Submissionsabsprachen
- B. Strafbarkeit des V
- I. § 266 StGB, Untreue
- C. Strafbarkeit des I
- I. § 266 StGB, Untreue, Mißbrauchstatbestand, Treubruchtatbestand
- II. § 299 StGB, Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
- III. § 263 StGB, Betrug bzw. § 298 StGB Submissionsabsprachen
- D. Maßnahmen der Wirtschaftsstrafkammer
- E. Maßnahmen während des Ermittlungsverfahren
- F. Bußgeldstrafen gemäß OWiG gegen V und die Bau AG
- Fazit
- Rechtsprechungsliste
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die strafrechtlichen und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Aspekte von Korruption im geschäftlichen Verkehr. Sie analysiert die Strafbarkeit von Personen, die in Korruptionspraktiken verwickelt sind, unter Berücksichtigung relevanter Strafgesetzbuchbestimmungen wie § 266 StGB (Untreue), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung) und § 263 StGB (Betrug). Darüber hinaus werden die möglichen Maßnahmen der Wirtschaftsstrafkammer und die Ordnungswidrigkeitenrechtlichen Konsequenzen für Unternehmen beleuchtet.
- Strafbarkeit von Korruption im geschäftlichen Verkehr
- Anwendung relevanter Strafgesetzbuchbestimmungen
- Maßnahmen der Wirtschaftsstrafkammer
- Ordnungswidrigkeitenrechtliche Konsequenzen für Unternehmen
- Analyse von Korruptionspraktiken im Kontext von Scheinrechnungen und Wettbewerbsbeeinflussung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Korruption im geschäftlichen Verkehr ein und erläutert die Bedeutung dieser Thematik.
Kapitel A analysiert die Strafbarkeit des L im Zusammenhang mit Scheinrechnungen und der Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht. Es werden die Tatbestandsmerkmale der Untreue gemäß § 266 StGB geprüft und die Voraussetzungen für eine Strafbarkeit des L im Kontext der Akquisitionsprämie beleuchtet.
Kapitel B befasst sich mit der Strafbarkeit des V, der im vorliegenden Fall die Scheinrechnungen genehmigt hat. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, ob V die Vermögensbetreuungspflicht verletzt hat und ob er sich damit strafbar gemacht hat.
Kapitel C untersucht die Strafbarkeit des I, dem die Scheinrechnungen ausgestellt wurden. Die Analyse beleuchtet die Tatbestandsmerkmale der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr sowie die Frage, ob I sich durch die Annahme der Scheinrechnungen strafbar gemacht hat.
Kapitel D befasst sich mit den möglichen Maßnahmen der Wirtschaftsstrafkammer, die im Falle von Korruptionspraktiken ergriffen werden können. Es werden die verschiedenen Sanktionsmöglichkeiten der Wirtschaftsstrafkammer vorgestellt.
Kapitel E analysiert die Maßnahmen, die während des Ermittlungsverfahrens in Korruptionsfällen ergriffen werden können. Es werden die verschiedenen Ermittlungsmöglichkeiten und die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung von Ermittlungen beleuchtet.
Kapitel F erläutert die Bußgeldstrafen, die gemäß dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) gegen V und die Bau AG verhängt werden können. Die Analyse betrachtet die Voraussetzungen für die Verhängung von Bußgeldern und die Höhe der möglichen Strafen.
Schlüsselwörter
Korruption, Wirtschaftsstrafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Untreue, Bestechlichkeit, Bestechung, Scheinrechnungen, Wettbewerbsbeeinflussung, Vermögensbetreuungspflicht, Wirtschaftsstrafkammer, Bußgeldstrafen, OWiG.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Korruption im juristischen Sinne definiert?
Korruption ist der Missbrauch einer Vertrauensstellung (in Verwaltung, Wirtschaft oder Politik), um einen unrechtmäßigen Vorteil zu erlangen. Sie umfasst Bestechung, Bestechlichkeit sowie Vorteilsannahme und -gewährung.
Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Bestechung?
Aktive Bestechung bezeichnet das Geben eines Vorteils (Bestechen), während passive Bestechung das Annehmen eines Vorteils (Bestechlichkeit) beschreibt.
Welche Rolle spielt § 266 StGB bei Korruptionsfällen?
Dieser Paragraph regelt den Tatbestand der Untreue. Er wird relevant, wenn eine Person ihre Vermögensbetreuungspflicht verletzt, beispielsweise durch die Genehmigung von Scheinrechnungen.
Was versteht man unter der Prinzipal-Agent-Theorie?
Es ist ein Modell mit drei Akteuren: Der Prinzipal (Auftraggeber) betraut den Agenten (Beauftragten) mit einer Aufgabe. Korruption tritt auf, wenn der Agent seine Machtposition nutzt, um mit einem Klienten zum Nachteil des Prinzipals zu kooperieren.
Welche Konsequenzen drohen Unternehmen bei Korruption?
Neben strafrechtlichen Verfolgungen von Einzelpersonen können gegen Unternehmen Bußgelder nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) verhängt werden.
- Arbeit zitieren
- Rainer Wissing (Autor:in), 2014, Wirtschaftsstrafrecht- und Ordnungswidrigkeitenrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356698