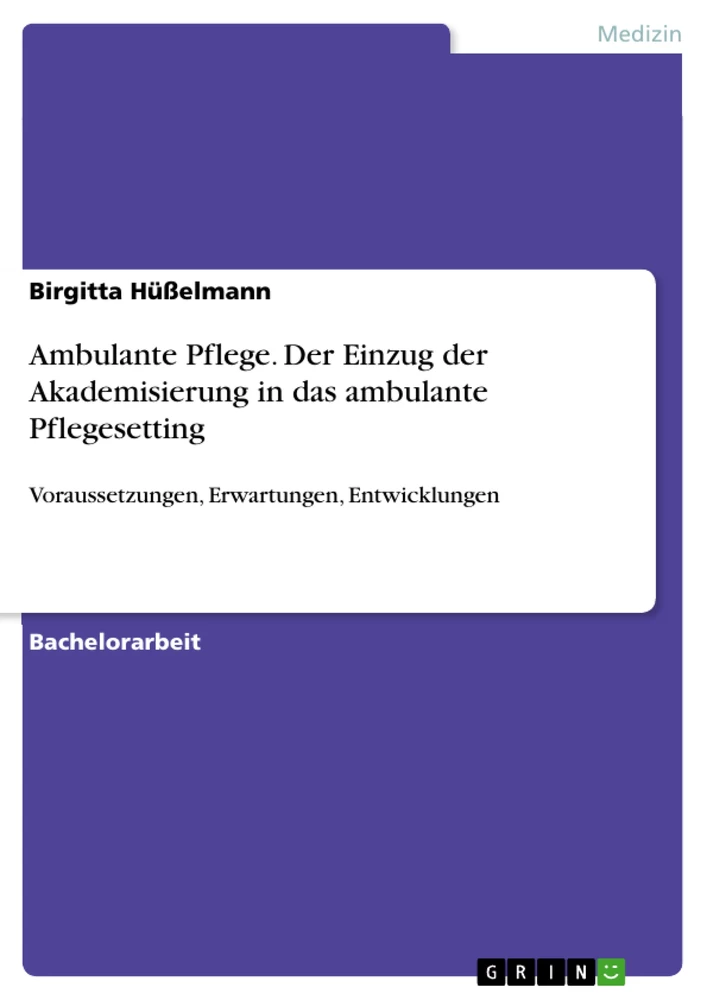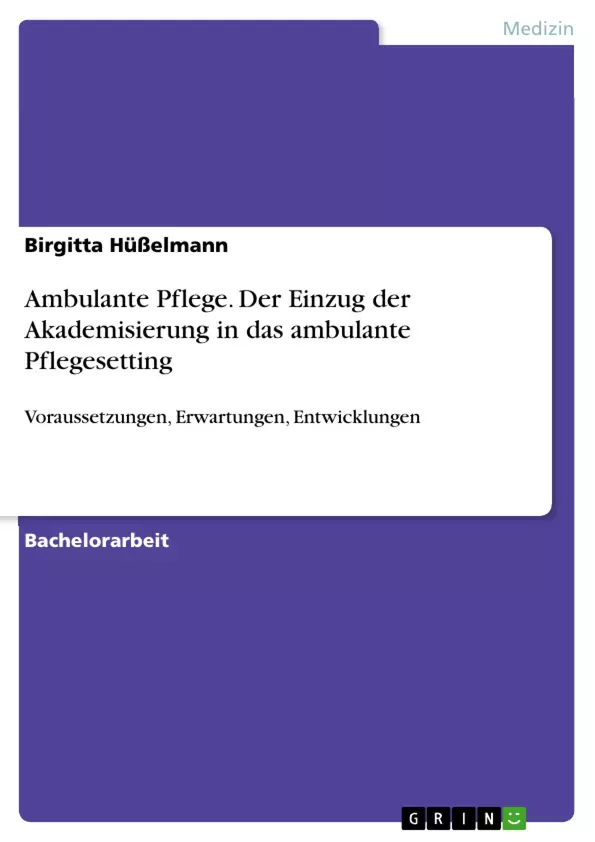Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, zu erkennen, ob akademisierte Pflegefachkräfte im ambulanten Pflegesetting einen zukünftigen Arbeitsbereich für sich sehen. Die Erwartungen, die sie mitbringen, und Chancen, die sich in Zukunft daraus ergeben können, vervollständigen die Zielerwartung an diese Arbeit.
Um dieses Ziel zu erreichen, unternimmt die Verfasserin zunächst einen Ausflug in das Qualitätsmanagement. Im Besonderen hier die Geschichte des Qualitätsmanagements, um aufzuzeigen, wie wichtig eine Qualitätsentwicklung ist, um sich im weiteren Verlauf überhaupt mit Akademisierung zu befassen. Methodisch bedient sich die Verfasserin der Literaturanalyse sowie der Forschungsmethode des Experteninterviews. Hier wurden sechs Studierende aus dem dualen Studiengang Pflege mit neun Fragen bezüglich des ambulanten Pflegesettings befragt, nachdem die Studierenden dort jeweils ein mehrwöchiges Praktikum absolviert hatten. Die Ergebnisse der Experteninterviews wurden mithilfe der Auswertungsmethode nach Meuser und Nagel durchgeführt.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird erkennbar, wie groß der Einfluss der Rahmenbedingungen ist, dem das ambulante Pflegesetting unterliegt. Die Entwicklung der Pflegeakademisierung in Deutschland und der ambulanten Pflege selbst schaffen Grundlagen, die es der Akademisierung in der ambulanten Pflege nicht besonders einfach machen. Dass es trotzdem Möglichkeiten gibt und die Akademisierung der ambulanten Pflege unabdingbar notwendig ist, kann in dieser Arbeit gezeigt werden. Mit Ideen zur Umsetzung schließt diese Arbeit im Ausblick ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschichte der Qualitätsentwicklung
- Theoretische Perspektiven zur Profession der Pflege nach Ulrich Oevermann
- Professionalisierung und Akademisierung der Pflege in Deutschland
- Der duale Studiengang Pflege
- Rahmenbedingungen im ambulanten Setting
- Rahmenverträge und Zulassung
- Finanzierung
- Methode
- Literaturanalyse
- Forschungsmethode: Experteninterviews
- Hauptfrage
- Methodisches Design und Forschungsprozess und Sample
- Fragen des Interviews und Leitfaden
- Auswertungsmethode und Analyse
- Methoden Kritik
- Ergebnisse
- Auswertung der Experteninterviews – Kategorienübersicht
- Beschreibung der Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Stressoren unter dem Blickwinkel der Salutogenese
- Diskussion
- Fazit und Handlungsempfehlungen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob akademisierte Pflegefachkräfte im ambulanten Pflegesetting einen zukünftigen Arbeitsbereich für sich sehen. Die Arbeit analysiert die Erwartungen, die diese Fachkräfte mitbringen, und die Chancen, die sich aus der Akademisierung in diesem Bereich ergeben könnten.
- Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen
- Professionalisierung und Akademisierung der Pflege
- Rahmenbedingungen im ambulanten Pflegesetting
- Erwartungen und Chancen der Akademisierung für Pflegefachkräfte
- Zukunftsperspektiven der ambulanten Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus der Arbeit und die Forschungsfrage definiert. Anschließend werden die Geschichte der Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen und die theoretischen Perspektiven zur Profession der Pflege nach Ulrich Oevermann beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit der Professionalisierung und Akademisierung der Pflege in Deutschland, insbesondere mit dem dualen Studiengang Pflege. Kapitel 5 analysiert die Rahmenbedingungen im ambulanten Setting, wie Rahmenverträge, Zulassung und Finanzierung. Die Methodik der Arbeit wird in Kapitel 6 vorgestellt, wobei die Literaturanalyse und die Forschungsmethode der Experteninterviews im Detail erläutert werden. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Experteninterviews, die in Kategorien zusammengefasst und interpretiert werden. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, Handlungsempfehlungen und einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Akademisierung, ambulantes Pflegesetting, Pflegefachkraft, Qualitätsmanagement, Professionalisierung, Rahmenbedingungen, Experteninterviews, Erwartungen, Chancen, Zukunftsperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Akademisierung in der Pflege?
Akademisierung bezeichnet die Einführung von Hochschulstudiengängen für Pflegeberufe (z. B. duale Studiengänge), um Pflegefachkräfte für komplexe Aufgaben, Qualitätsmanagement und wissenschaftlich fundierte Praxis zu qualifizieren.
Wollen akademisierte Pflegekräfte in der ambulanten Pflege arbeiten?
Die Forschung zeigt, dass viele Studierende durchaus Potenzial in der ambulanten Pflege sehen, jedoch oft durch schwierige Rahmenbedingungen wie Zeitdruck und mangelnde Vergütungsstrukturen abgeschreckt werden.
Welche Rahmenbedingungen erschweren die Akademisierung im ambulanten Sektor?
Herausforderungen sind unter anderem die Finanzierung über Rahmenverträge, die oft keine höheren Qualifikationsstufen vorsehen, sowie die starren Zulassungsbedingungen der Pflegekassen.
Welche Chancen bietet die Akademisierung für ambulante Pflegedienste?
Akademisierte Fachkräfte können die Versorgungsqualität verbessern, Pflegeprozesse optimieren und eine bessere Schnittstellenkommunikation mit Ärzten und Kliniken sicherstellen.
Was ist das Konzept der Salutogenese in der Pflege?
Salutogenese konzentriert sich auf die Entstehung von Gesundheit statt auf die Krankheit. In der Pflege hilft dieser Blickwinkel, Stressoren zu identifizieren und die Ressourcen von Patienten und Personal zu stärken.
- Arbeit zitieren
- Birgitta Hüßelmann (Autor:in), 2017, Ambulante Pflege. Der Einzug der Akademisierung in das ambulante Pflegesetting, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356726