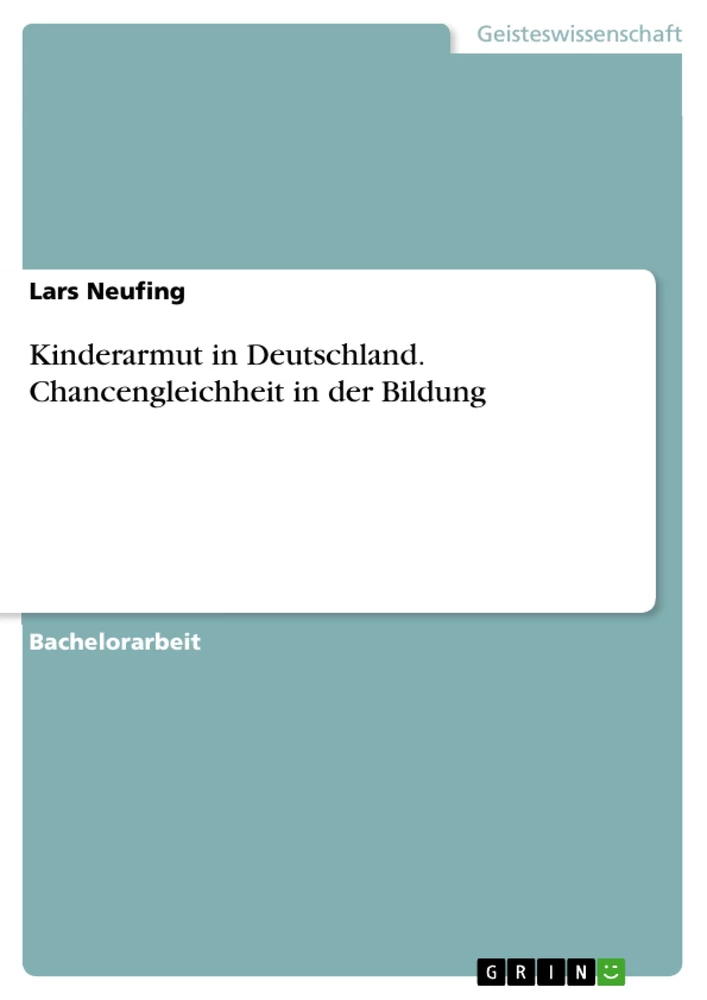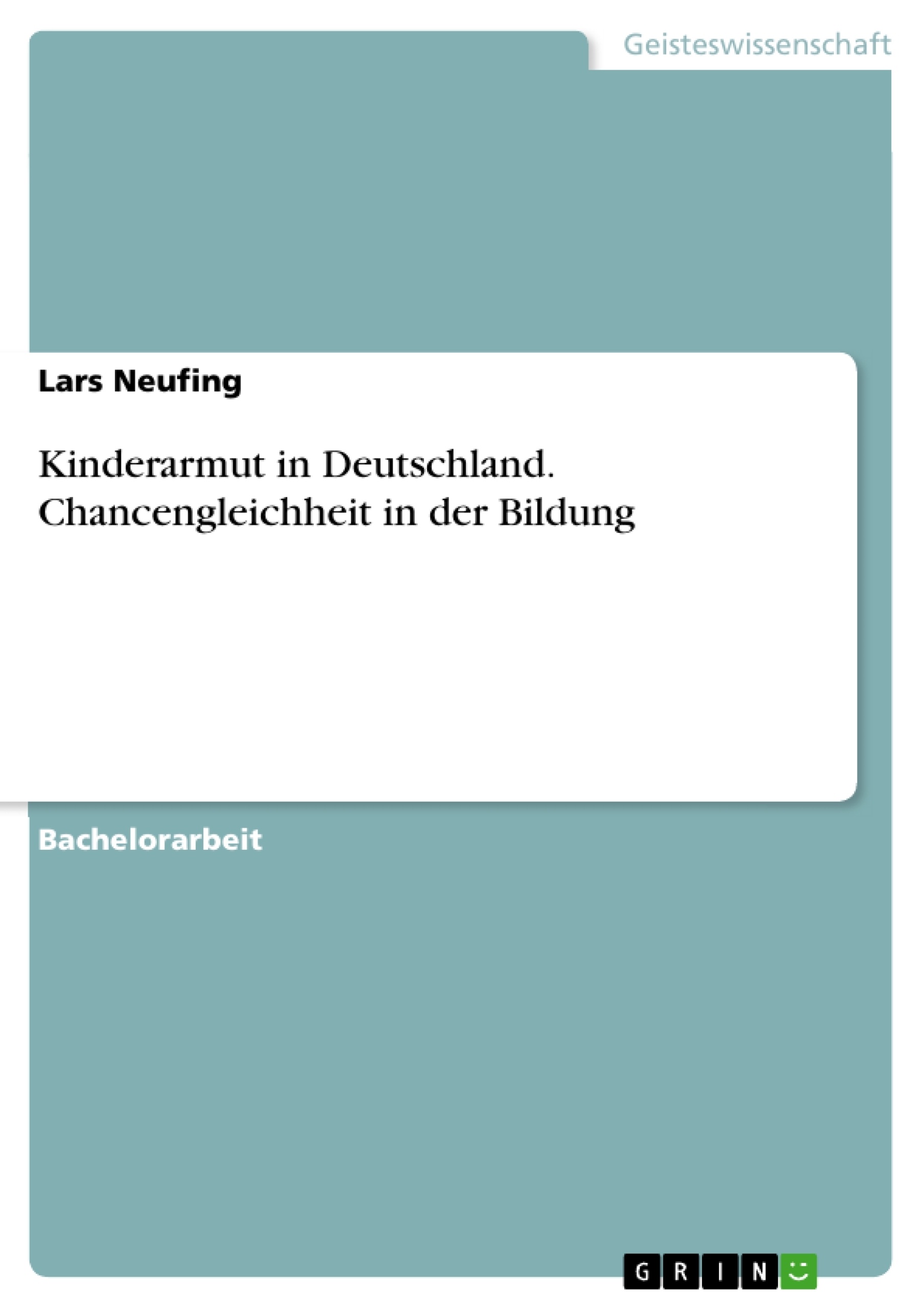Die Intension der vorliegenden Arbeit ist es, die Auswirkung der Kinderarmut auf die Bildung der hiervon betroffenen Kinder darzustellen und die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut in Deutschland kritisch zu hinterfragen.
Bedingt durch viele Spendenaufrufe, schockierende Nachrichten und Dokumentationen, verbinden wir Kinderarmut meist mit menschenunwürdigen Lebensbedingungen für Kinder in Afrika oder Südostasien.
Die Armut in einer Industrienation wie Deutschland, ist mit der Armut in Afrika oder Südostasien nicht vergleichbar. In diesen Gebieten sterben unzählige Menschen durch Hunger und Unterernährung. Um was für eine Art von Armut handelt es sich also in Deutschland und anderen westlichen Industriestaaten?
Zunächst wird in dieser Arbeit der Begriff der Armut definiert und die verschiedenen Ausprägungen aufgezeigt.
Aufbauend auf einer Definition von Bildungsungleichheit erfolgt eine Analyse dieser anhand verschiedener Theorien, bevor abschließend stattliche Maßnahmen wie das Bildungs- und Teilhabepaket sowie das Betreuungsgeld kritisch bewertet werden. Zudem werden alternative Wege der Bekämpfung von Kinderarmut und Bildungsungleichheit aufgezeigt sowie ein Ausblick gegeben, ob in naher Zukunft die Überwindung des Zusammenhangs von Kinderarmut und Bildungsungleichheit möglich erscheint.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsbestimmungen
- II.1. Definition Armut
- II.1.1. Absolute Armut
- II.1.2. Relative Armut
- II.2. Definition soziale Ungleichheit
- II.2.1. Bildungsungleichheit und Chancengleichheit
- II.3. Überblick: Das deutsche Bildungssystem
- II.1. Definition Armut
- III. Kinderarmut in Zahlen
- III.1. Kinderarmut in Deutschland
- III.1.1. Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland
- III.1.2. Urbanisierung der Kinderarmut
- III.1.3. Differenzierung der Kinderarmut nach dem Alter der Betroffenen
- III.2. Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Industriestaaten
- III.1. Kinderarmut in Deutschland
- IV. Ursachen der Kinderarmut
- IV.1. Nichtstrukturelle Faktoren
- IV.2. Strukturelle Faktoren
- V. Folgen der Kinderarmut
- V.1. Differenzierung nach Lebenslagendimensionen
- V.1.1. Materielle Versorgung
- V.1.2. Soziale Lage
- V.1.3. Gesundheitliche Lage
- V.1.4. Kulturelle Lage
- V.1. Differenzierung nach Lebenslagendimensionen
- VI. Theorien zur Bildungsungleichheit
- VI.1. Der Ansatz von Raymond Boudon
- VI.1.1. Primäre Herkunftseffekte
- VI.1.2. Sekundäre Herkunftseffekte
- VI.1.3. Das Modell für die Entstehung und Reproduktion von sozialer Ungleichheit der Bildungschancen nach Raymond Boudon
- VI.2. Die Illusion der Chancengleichheit nach Pierre Bourdieu
- VI.2.1. Bildungsprivileg und Bildungschancen
- VI.2.2. Die Aufrechterhaltung der Ordnung
- VI.1. Der Ansatz von Raymond Boudon
- VII. Darstellung ausgewählter staatlicher Maßnahmen gegen relative Kinderarmut in Deutschland
- VII.1. Das Betreuungsgeld
- VII.2. Das Bildungs- und Teilhabepaket
- VIII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Auswirkungen von Kinderarmut auf die Bildung betroffener Kinder zu analysieren und staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut in Deutschland kritisch zu hinterfragen.
- Definition von Armut und deren Ausprägungen
- Darstellung des deutschen Bildungssystems und der Bildungsungleichheit
- Statistische Analyse der Kinderarmut in Deutschland und Europa
- Ursachen der Kinderarmut, insbesondere in Bezug auf strukturelle und nichtstrukturelle Faktoren
- Folgen von Kinderarmut für die Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Chancengleichheit im Bildungsbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kinderarmut in Deutschland ein und stellt den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet den Begriff der Armut und differenziert zwischen absoluter und relativer Armut. Außerdem wird das deutsche Bildungssystem in seinen Grundzügen dargestellt und der Begriff der Bildungsungleichheit erläutert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition von Armut und ihren verschiedenen Ausprägungen. Es werden die Begriffe absolute und relative Armut definiert und die verschiedenen Ansätze zur Messung von Armut vorgestellt.
Das dritte Kapitel präsentiert statistische Daten zur Kinderarmut in Deutschland und im Vergleich zu anderen westlichen Industrieländern. Es analysiert die Unterschiede in der Kinderarmut zwischen Ost- und Westdeutschland sowie die Urbanisierung der Kinderarmut.
Das vierte Kapitel untersucht die Ursachen der Kinderarmut und unterscheidet zwischen nichtstrukturellen und strukturellen Faktoren. Es werden verschiedene Ursachen wie Arbeitslosigkeit, geringe Bildung und fehlende soziale Integration beleuchtet.
Das fünfte Kapitel analysiert die Folgen von Kinderarmut für die Betroffenen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf die materielle Versorgung, die soziale Lage, die Gesundheit und die kulturelle Lage. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Chancengleichheit im Bereich der Bildung.
Das sechste Kapitel befasst sich mit Theorien zur Bildungsungleichheit und analysiert die Ansätze von Raymond Boudon und Pierre Bourdieu. Es werden die primären und sekundären Herkunftseffekte sowie die Reproduktion von sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich untersucht.
Das siebte Kapitel stellt ausgewählte staatliche Maßnahmen gegen relative Kinderarmut in Deutschland vor, darunter das Betreuungsgeld und das Bildungs- und Teilhabepaket.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Bildungsungleichheit, Chancengleichheit, Bildungssystem, Deutschland, Sozialstaatsprinzip, Ressourcenansatz, Lebenslagenansatz, materielle Versorgung, soziale Lage, Gesundheit, Kultur, Theorien zur Bildungsungleichheit, Raymond Boudon, Pierre Bourdieu, staatliche Maßnahmen, Betreuungsgeld, Bildungs- und Teilhabepaket.
- Citar trabajo
- Lars Neufing (Autor), 2013, Kinderarmut in Deutschland. Chancengleichheit in der Bildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356850