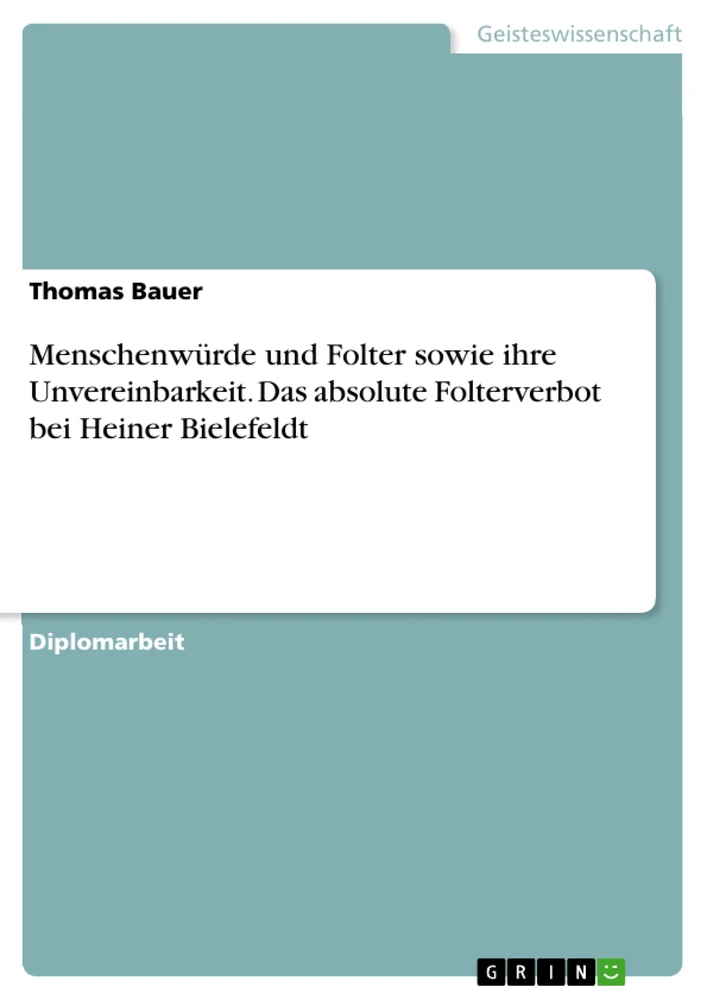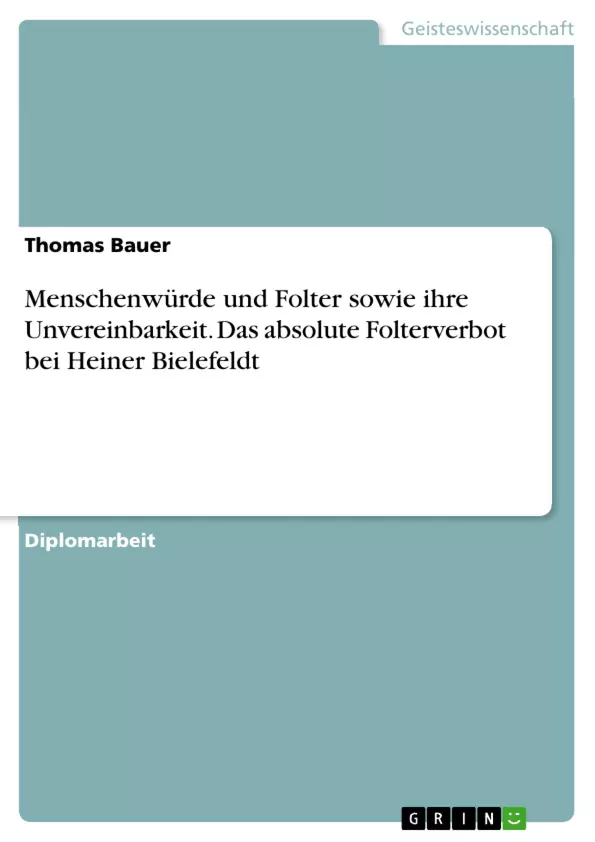In dieser Arbeit soll die Position von Bielefeldt zum absoluten Folterverbot genauer betrachtet werden. Dabei werden im ersten Kapitel die Begriffe „Menschenwürde“ und „Folter“ einer genauen Betrachtung unterzogen. Was auf den ersten Blick trivial erscheint, wird sich bei einer intensiven Untersuchung als eine komplexe geschichtliche Entwicklung erweisen. Der Begriff der Menschenwürde ist zwar schon in der Antike bekannt, jedoch haben sich die Konturen und bestimmte Ansichten über die Würde des Menschen im Verlauf der Menschheitsgeschichte geändert. Hinter den unterschiedlichen Konzepten des Würdebegriffs stehen auch unterschiedliche anthropologische Ansichten. Es gilt, herauszufinden, ob hinter all dem Wandelbaren nicht auch ein unwandelbarer Kern steckt, der die Unantastbarkeit der Menschenwürde nach unserem heutigen Verständnis rechtfertigt. Dabei sollen im Hinblick auf die Position von Heiner Bielefeldt unterschiedliche Standpunkte diskutiert werden.
Im zweiten Kapitel stelle der Autor die Position von Bielefeldt dar. Dabei bezieht er sich hauptsächlich auf das Policy Paper „Das Folterverbot im Rechtsstaat“ und den Essay „Menschenwürde und Folterverbot“. Für Heiner Bielefeldt folgt das absolute Folterverbot aus den zwei wesentlichen Prämissen: Erstens, die Würde des Menschen ist unantastbar, und zweitens, Folter ist gegen die Würde des Menschen. Nachdem die Position von Bielefeldt dargestellt wurde, wird im dritten Kapitel die Position von Bielefeldt diskutiert. Dabei zieht der Autor unterschiedliche Autoren zurate, die sich für, aber auch gegen das Folterverbot einsetzen. Abschließend werde ich Anfragen an Heiner Bielefeldt stellen. Diese Anfragen werden nicht beantwortet. Ich bin davon überzeugt, dass in dieser schwierigen Frage – ‚Folter, ja/nein? – keine endgültige Antwort gefunden werden kann. Jede Person muss sich diese Frage selbst stellen und jeder muss seine Antwort vor seinem Gewissen verantworten können. Diese Antwort kann ihm niemand abnehmen.
Der Autor ist der Auffassung, dass es einen großen Unterschied macht, Extremfälle in akademischen Beträgen zu diskutieren und sie dann in der Realität selber miterleben zu müssen. Das soll aber niemanden von der Pflicht entbinden, sich akademisch mit der wichtigen Frage nach dem Folterverbot auseinander zu setzen, um damit aktiv den Meinungsbildungsprozess mitgestalten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A)
- Begriffsklärung
- Menschenwürde und Menschenrechte
- Philosophiegeschichtliche Entwicklung
- Rechtsgeschichtliche Entwicklung
- Die Konkretisierung der Menschenwürde im Grundgesetz
- Wann wird konkret die Würde des Menschen verletzt?
- Der Begriff der Menschenwürde bei Heiner Bielefeldt
- Freiheit der Unwandelbare Kern der Menschenrechte
- Der Begriff der Folter
- Entstehung der Menschenrechte im historischem Kontext
- Folter in der Geschichte der Menschheit
- Die UN-Antifolterkonvention
- Das Folterverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention
- B)
- Die Position von Heiner Bielefeldt
- Menschenwürde, ein Apriori des modernen Rechtsstaats
- Folter, eine Negierung der Menschenwürde
- Die Absolutheit des Folterverbots
- Wie im Konfliktfall handeln?
- Moralischer Absolutismus, Tabu oder vernünftige Begründung?
- C)
- Argumentative Auseinandersetzung mit Bielefeldt
- Unbedingter normativer Vorrang der Menschenwürde
- Folter immer eine Verletzung der Menschenwürde?
- D)
- Abschließende Anfragen an die Position von Heiner Bielefeldt
- Abschließende Bemerkungen
- Die Unantastbarkeit der Menschenwürde als Grundprinzip
- Die Geschichte der Folter und ihre Entwicklung im historischen Kontext
- Das absolute Folterverbot als Ausdruck des Rechtsstaates
- Die ethische und rechtliche Problematik des Folterverbots in extremen Situationen
- Die Frage nach der Gültigkeit des absoluten Folterverbots im Kontext der Terrorismusbekämpfung
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik der Folter im historischen Kontext dar und führt in die Position von Heiner Bielefeldt ein. Sie beleuchtet die Ambivalenz des Menschen und seine Fähigkeit zu Grausamkeit, die im Fall der Folter deutlich wird.
- A) Begriffsklärung: Dieses Kapitel analysiert die Begriffe „Menschenwürde“ und „Folter“ in ihrer historischen Entwicklung und ihren philosophischen und rechtlichen Grundlagen. Es untersucht verschiedene Ansichten und Konzepte der Menschenwürde und hinterfragt, ob ein unwandelbarer Kern in der Definition der Menschenwürde steckt.
- B) Die Position von Heiner Bielefeldt: Dieses Kapitel stellt die Argumentation von Heiner Bielefeldt dar, die sich für ein absolutes Folterverbot ausspricht. Er argumentiert, dass Folter immer eine Verletzung der Menschenwürde darstellt, die unantastbar ist.
- C) Argumentative Auseinandersetzung mit Bielefeldt: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Argumentationen, die für oder gegen das absolute Folterverbot sprechen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Dilemmata, die mit der Frage nach dem Folterverbot im Kontext der Terrorismusbekämpfung und anderen extremen Situationen verbunden sind.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem absoluten Folterverbot, wie es von Heiner Bielefeldt vertreten wird. Ziel ist es, die Position Bielefeldts im Kontext der Menschenwürde und der Geschichte der Folter zu analysieren und zu bewerten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik des absoluten Folterverbots und bezieht sich dabei auf die zentrale Position von Heiner Bielefeldt. Im Zentrum stehen die Begriffe „Menschenwürde“, „Folter“, „Rechtstaat“, „Terrorismusbekämpfung“, „ethische Dilemmata“ und „rechtsphilosophische Argumentationen“
Häufig gestellte Fragen
Warum vertritt Heiner Bielefeldt ein absolutes Folterverbot?
Bielefeldt argumentiert, dass die Menschenwürde unantastbar ist und Folter die radikalste Negierung dieser Würde darstellt. Daher kann es im Rechtsstaat keine Ausnahme geben.
Ist das Konzept der Menschenwürde zeitlos?
Obwohl sich die Vorstellungen von Würde historisch gewandelt haben, sucht die Arbeit nach einem unwandelbaren Kern – der Freiheit –, der die Unantastbarkeit heute rechtfertigt.
Was sagt die UN-Antifolterkonvention aus?
Sie ist ein völkerrechtliches Instrument, das Folter verbietet. Die Arbeit bettet Bielefeldts Position in diesen rechtshistorischen Kontext ein.
Wie soll man laut Bielefeldt in extremen Konfliktfällen handeln?
Bielefeldt hält am absoluten Verbot fest, auch in Dilemmata wie der Terrorismusbekämpfung, da jede Aufweichung das Fundament des modernen Rechtsstaats gefährden würde.
Gibt es Gegenargumente zum absoluten Folterverbot?
Ja, die Arbeit diskutiert auch Positionen anderer Autoren, die in extremen Gefahrensituationen (z.B. Rettungsfolter) Abwägungen für zulässig halten, was Bielefeldt jedoch ablehnt.
- Citar trabajo
- Thomas Bauer (Autor), 2009, Menschenwürde und Folter sowie ihre Unvereinbarkeit. Das absolute Folterverbot bei Heiner Bielefeldt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356853