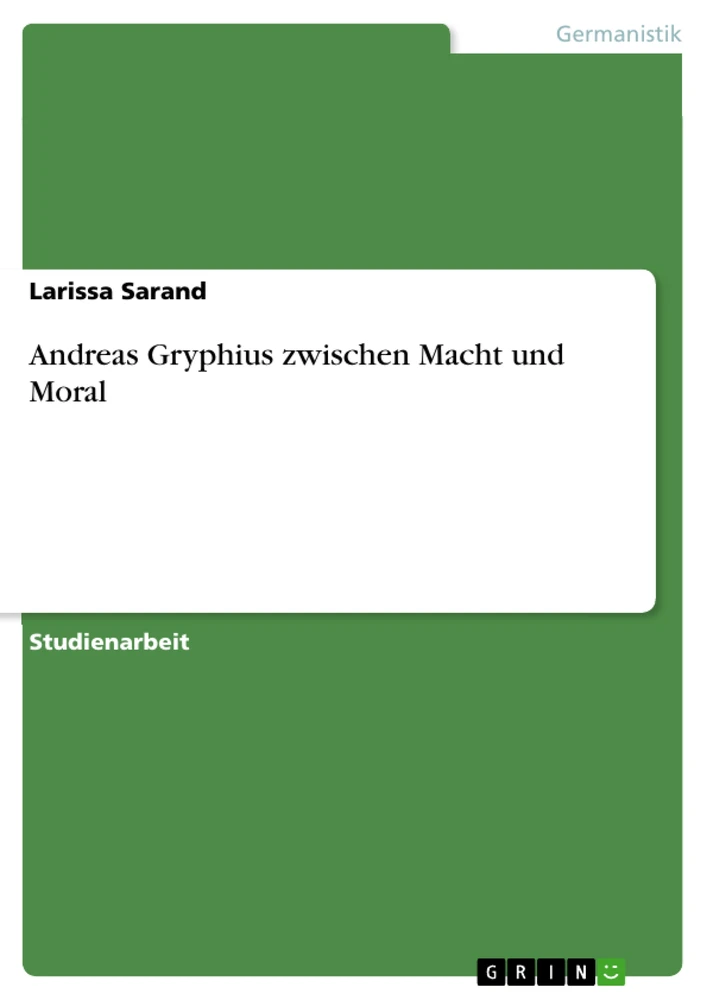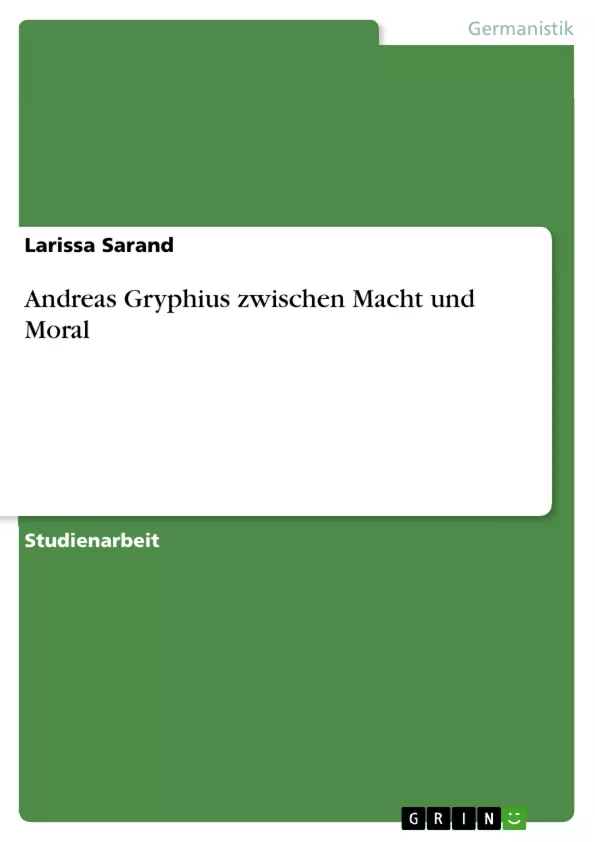Diese Hausarbeit befasst sich mit der Thematik des Märtyrertods in den Trauerspielen von Andreas Gryphius. Die Arbeit setzt sich dabei vor allem mit dem von Peter J. Brenner verfassten Aufsatz "Der Tod des Märtyrers – 'Macht' und 'Moral' in den Trauerspielen von Andreas Gryphius" und dessen Thesen auseinander.
Zunächst beleuchtet die Arbeit die Eigenschaften des barocken Trauerspiels, um sich anschließend mit Brenners Zugang zu den Trauerspielen von Gryphius und den darin enthaltenen Themen "Macht" und "Moral" zu befassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des barocken Trauerspiels
- Themen des Trauerspiels und die äußere Form
- Spezifizierung des Inhalts und Abgrenzung zur Tragödie
- Das Trauerspiel bei Gryphius
- Brenners Zugang zu den Trauerspielen von Andreas Gryphius.
- Brenners Thesen und Lesart
- Staatsrechtstheorie im 17. Jahrhundert: Hobbes und sein Einfluss auf Andreas Gryphius
- „Macht“ und „Moral“ bei Gryphius.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Thematik des Märtyrertods in den Trauerspielen von Andreas Gryphius, insbesondere im Kontext des Aufsatzes von Professor Peter J. Brenner. Brenner argumentiert, dass Gryphius durch die Darstellung der Hinrichtung von Märtyrern ein unauflösliches Dilemma zwischen den moralischen Ansprüchen des Individuums und den juristischen Ansprüchen des Absolutismus aufzeigt.
- Die Eigenschaften des barocken Trauerspiels
- Brenners Analyse der Trauerspiele von Gryphius
- Die Rolle der Staatsrechtstheorie im 17. Jahrhundert
- Das Spannungsfeld zwischen „Macht“ und „Moral“ bei Gryphius
- Das Dilemma zwischen individueller Moral und absolutistischer Macht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den Fokus auf die Untersuchung des Märtyrertods in den Trauerspielen von Andreas Gryphius, insbesondere im Kontext des Aufsatzes von Professor Peter J. Brenner dar.
2. Definition des barocken Trauerspiels
Dieses Kapitel beschreibt die äußere und innere Form des barocken Trauerspiels. Es werden die Themen, die äußere Form, die Spezifizierung des Inhalts und die Abgrenzung zur Tragödie beleuchtet.
2.1 Themen des Trauerspiels und die äußere Form
Es werden die Bezeichnungen „barockes“, „deutsches“ und „schlesisches“ Trauerspiel erläutert. Die Thematik des barocken Trauerspiels konzentriert sich auf hohe Stoffe und große Fallhöhen. Es werden vor allem historische Stoffe behandelt und die Aufführungen fanden in Schultheatern statt.
2.2 Spezifizierung des Inhalts und Abgrenzung zur Tragödie
Dieses Unterkapitel beleuchtet die thematischen Inhalte des Trauerspiels anhand der Ausführungen von Martin Opitz und Walter Benjamin. Es werden die Unterschiede zwischen Tragödie und Trauerspiel im Hinblick auf die Thematik, die dramatis personae und den historischen Kontext betrachtet.
2.3 Das Trauerspiel bei Gryphius
Dieses Unterkapitel beleuchtet Gryphius' eigene Aussagen über das Trauerspiel und seine Überlegungen zum Umgang mit Macht und deren Gebrauch in seinen Dramen.
3. Brenners Zugang zu den Trauerspielen von Andreas Gryphius
Dieses Kapitel setzt sich mit Brenners Analyse der Trauerspiele von Gryphius auseinander. Brenner kritisiert die ältere Forschung, die sich zu sehr an Gryphius' eigener Weltsicht orientierte. Er kritisiert zudem die neuere Forschung, die die heilsgeschichtliche Dimension der Dramen außer Acht lässt.
3.1 Brenners Thesen und Lesart
Brenner stellt die Frage nach der Funktion der Einbettung traditioneller Elemente in eine moderne Gesellschaft und argumentiert, dass Gryphius durch die Darstellung der Hinrichtung von Märtyrern ein unauflösliches Dilemma zwischen individueller Moral und absolutistischer Macht aufzeigt.
3.2 Staatsrechtstheorie im 17. Jahrhundert: Hobbes und sein Einfluss auf Andreas Gryphius
Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Staatsrechtstheorie des 17. Jahrhunderts, insbesondere mit dem Einfluss von Hobbes auf Gryphius' Werk. Die Auseinandersetzung mit der Staatsrechtstheorie dient als Grundlage für die Analyse von Gryphius' Dramen.
3.3 „Macht“ und „Moral“ bei Gryphius
Dieses Unterkapitel untersucht die Beziehung zwischen „Macht“ und „Moral“ in Gryphius' Dramen im Kontext der Staatsrechtstheorie des 17. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieser Hausarbeit sind: Andreas Gryphius, barockes Trauerspiel, Märtyrertod, Macht, Moral, Absolutismus, Staatsrechtstheorie, Hobbes, Peter J. Brenner, heilsgeschichtliche Weltsicht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema in den Trauerspielen von Andreas Gryphius?
Ein zentrales Thema ist der Märtyrertod und das daraus resultierende Spannungsfeld zwischen individueller Moral und absolutistischer Macht.
Wie definiert sich das barocke Trauerspiel?
Das barocke Trauerspiel behandelt hohe historische Stoffe, zeigt große Fallhöhen der Protagonisten und reflektiert oft eine heilsgeschichtliche Weltsicht.
Welchen Einfluss hatte Thomas Hobbes auf Gryphius?
Gryphius setzte sich mit der Staatsrechtstheorie des 17. Jahrhunderts, insbesondere mit Hobbes' Vorstellungen von Macht und Souveränität, in seinen dramatischen Werken auseinander.
Was ist die Kernthese von Peter J. Brenner zu Gryphius?
Brenner argumentiert, dass Gryphius durch die Darstellung der Hinrichtung von Märtyrern ein unauflösliches Dilemma zwischen den moralischen Ansprüchen des Individuums und den juristischen Ansprüchen des Absolutismus aufzeigt.
Was unterscheidet das Trauerspiel von der klassischen Tragödie?
Die Unterschiede liegen vor allem in der Thematik, den dramatis personae und dem spezifischen historischen Kontext des Barocks, wie er unter anderem von Walter Benjamin beschrieben wurde.
- Citar trabajo
- Larissa Sarand (Autor), 2012, Andreas Gryphius zwischen Macht und Moral, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357317