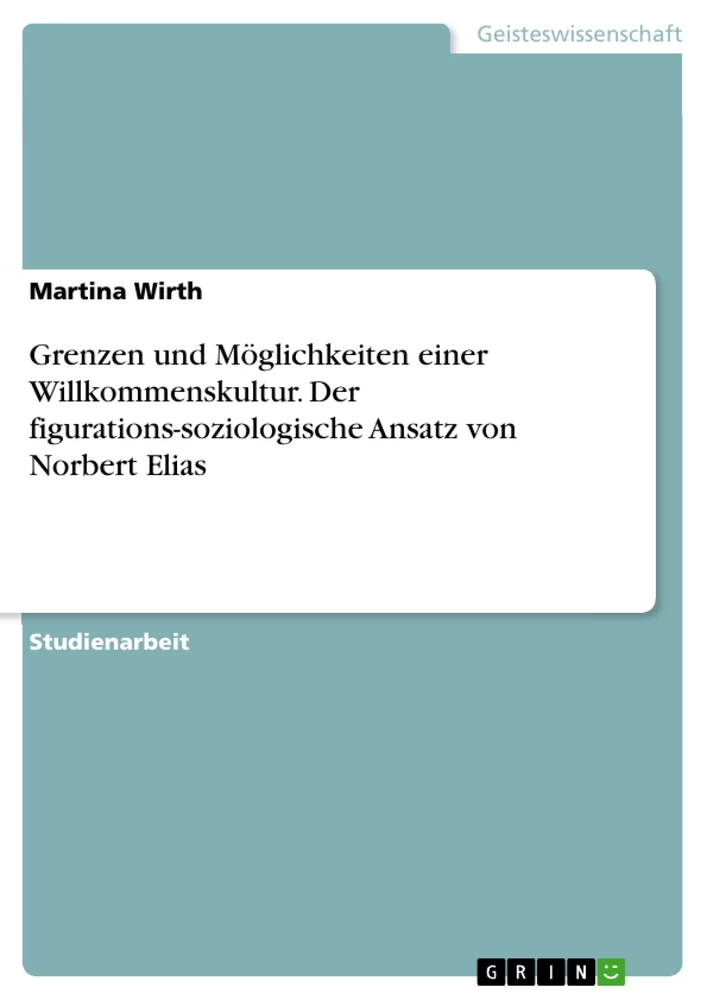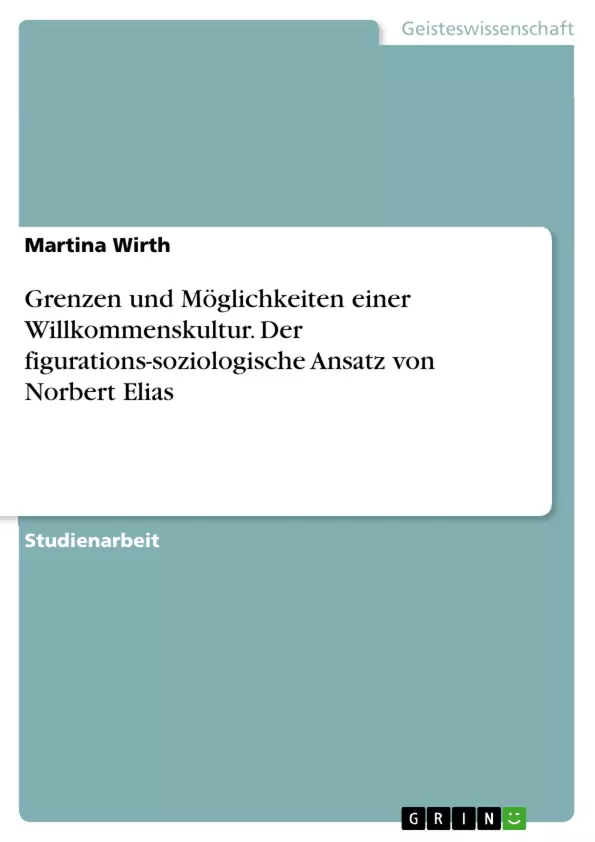Im Zuge des fortschreitenden demografischen Wandels und der angestrebten Fachkräftesicherung für die Wirtschaft sollen die Rahmenbedingungen für die Zuwanderung nach Deutschland neu ausgerichtet werden. Ziel ist es – im Gegensatz zu der Gastarbeiteranwerbung in den 1960er Jahren – Zuwanderer zu gewinnen, die langfristig und dauerhaft zum Wohlstand Deutschlands beitragen. Willkommenskultur kann jedoch nicht per Gesetz verordnet werden, sondern findet auf mehreren Ebenen statt: auf der Ebene des Individuums, der Ebene interpersonaler Beziehungen, der Ebene von Organisationen und Institutionen und der Ebene der Gesamtgesellschaft (Heckmann, 2012).
In dieser Arbeit sollen die Grenzen und Möglichkeiten einer Willkommenskultur in Deutschland nach Norbert Elias ́ Erkenntnissen beleuchtet werden.
Mit der Idee einer Willkommenskultur möchte Deutschland den erforderlichen Perspektivenwechsel in der Aufnahmegesellschaft steuern und gestalten. Einen Perspektivenwechsel in Richtung interkultureller Öffnung, Wertschätzung und Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt und langfristiger Teilhabe sowie Gleichstellung aller Menschen in der Gesellschaft.
Auch wenn „Willkommenskultur“ als Schlagwort, als Marketingbegriff unreflektiert übernommen wurde und wird, bietet der entstandene Diskurs die Möglichkeit, Einwanderung in Deutschland auf breiterer Ebene zum Thema zu machen. Nach Hubertus Schröer markiert die für die angestrebte Willkommenskultur erforderliche interkulturelle Orientierung eine sozialpolitische Haltung von Personen und Organisationen, die Verschiedenheit und Vielfalt respektiert.
Dieser Paradigmenwechsel von Integration zur Inklusion würde auch die Haltung bewirken, dass die Zugehörigkeit der Zuwanderer, Fremden, Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund zur Gesellschaft von Anfang an postuliert ist. Der bisher von der Aufnahmegesellschaft unter dem Begriff „Integration“ einseitig geforderten Anpassungsleistung der Zuwanderer müsste eine „Grundhaltung der Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt als eine Art neuer Staatsräson“ in Deutschland folgen.
„Die realen Herausforderungen etwa durch den demografischen Wandel könnten zu einem gesellschaftlichen Diskurs führen, der die perspektivischen Aspekte der Zukunftssicherung mit der existentiellen Notwendigkeit von Zuwanderung verbindet und die gesellschaftliche Stimmung und die Akzeptanz von Zuwanderung langfristig verändern hilft.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. GEGENSTAND: WILLKOMMENSKULTUR IN DEUTSCHLAND
- 2.1. Willkommenskultur - was ist das?
- 2.2. Unterscheidet sich Anerkennungskultur von Willkommenskultur?
- 2.3. Zielgruppe der Willkommenskultur
- 2.4. Kritik zur Willkommenskultur
- 2.5. Chancen für gesellschaftlichen Wandel
- 3. THEORETISCHER HINTERGRUND: NORBERT ELIAS' FIGURATIONSANALYSE
- 3.1. Figuration
- 3.2. Struktureigentümlichkeit
- 3.3. Machtbalance
- 3.4. Gruppencharisma
- 3.5. Selbstzwang
- 3.6. Wir-Ideal
- 3.7. Stigmatisierung
- 3.8. Rangordnung
- 3.9. Langfristige Prozesssoziologie
- 4. ANALYSE
- 4.1. Analyse der deutschen Willkommenskultur und deren Grenzen und Möglichkeiten
- 4.1.1. Figuration
- 4.1.2. Struktureigentümlichkeit
- 4.1.3. Machtbalance
- 4.1.4. Wir-Ideal
- 4.1.5. Selbstzwang
- 4.1.6. Stigmatisierung
- 4.1.7. Rangordnung
- 4.1.8. Langfristige Prozesssoziologie
- 5. BILDUNGSWISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE
- 6. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Grenzen und Möglichkeiten einer Willkommenskultur in Deutschland vor dem Hintergrund der figurations-soziologischen Ansätze von Norbert Elias. Die Arbeit untersucht, wie die theoretischen Konzepte von Elias auf die deutsche Willkommenskultur angewendet werden können und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben.
- Die Definition und Relevanz der Willkommenskultur in Deutschland
- Die Analyse der deutschen Willkommenskultur im Lichte der Figurationsanalyse von Norbert Elias
- Die Herausforderungen und Chancen der Willkommenskultur im Kontext von Integration und gesellschaftlichem Wandel
- Die Rolle von Bildung in der Förderung einer Willkommenskultur
- Die Bedeutung von interkultureller Öffnung und Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Willkommenskultur in Deutschland im Kontext von demografischem Wandel und Fachkräftesicherung dar und führt in die Fragestellung der Arbeit ein.
- Kapitel 2: Gegenstand: Willkommenskultur in Deutschland: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Willkommenskultur“ und beleuchtet verschiedene Aspekte, wie z. B. die Zielgruppe, die Kritik an der Willkommenskultur und die Chancen für gesellschaftlichen Wandel.
- Kapitel 3: Theoretischer Hintergrund: Norbert Elias' Figurationsanalyse: Kapitel 3 stellt die wichtigsten Konzepte der Figurationsanalyse von Norbert Elias vor, die für die Analyse der Willkommenskultur relevant sind. Dazu gehören Begriffe wie Figuration, Struktureigentümlichkeit, Machtbalance, Selbstzwang, Wir-Ideal, Stigmatisierung und Rangordnung.
- Kapitel 4: Analyse: In diesem Kapitel wird die deutsche Willkommenskultur anhand der in Kapitel 3 vorgestellten Konzepte von Norbert Elias analysiert. Die Analyse beleuchtet die Grenzen und Möglichkeiten der Willkommenskultur in Deutschland.
- Kapitel 5: Bildungswissenschaftliche Perspektive: Dieses Kapitel diskutiert die Rolle von Bildung in der Förderung einer Willkommenskultur und der Integration von Zuwanderern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Willkommenskultur, Integration, gesellschaftlicher Wandel, Figurationsanalyse, Norbert Elias, interkulturelle Öffnung, Anerkennung, Diskriminierung, Machtbalance, Stigmatisierung, Bildung, Fachkräftesicherung, demografischer Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Willkommenskultur in Deutschland?
Ziel ist ein Perspektivenwechsel hin zur interkulturellen Öffnung, Wertschätzung von Vielfalt und langfristigen Teilhabe von Zuwanderern an der Gesellschaft.
Was bedeutet Figurationsanalyse nach Norbert Elias?
Elias betrachtet Gesellschaft als Geflecht von Interdependenzen (Figurationen), in denen Machtbalancen und soziale Beziehungen das Verhalten des Einzelnen prägen.
Warum ist Stigmatisierung ein Problem für die Integration?
Stigmatisierung schafft soziale Rangordnungen zwischen "Etablierten" und "Außenseitern", was die Anerkennung und Inklusion von Zuwanderern behindert.
Was versteht Elias unter dem "Wir-Ideal"?
Es beschreibt das kollektive Selbstbild einer Gruppe, das oft zur Abgrenzung gegenüber Fremden genutzt wird und die Akzeptanz von Zuwanderung beeinflusst.
Welche Rolle spielt Bildung für die Willkommenskultur?
Bildung ist ein zentrales Instrument, um Vorurteile abzubauen, interkulturelle Kompetenzen zu fördern und die Gleichstellung in der Gesellschaft zu unterstützen.
Ist Willkommenskultur nur ein Marketingbegriff?
Obwohl der Begriff oft unreflektiert genutzt wird, bietet der Diskurs die Chance, Einwanderung auf breiter gesellschaftlicher Ebene neu zu bewerten.
- Citation du texte
- Martina Wirth (Auteur), 2014, Grenzen und Möglichkeiten einer Willkommenskultur. Der figurations-soziologische Ansatz von Norbert Elias, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357344