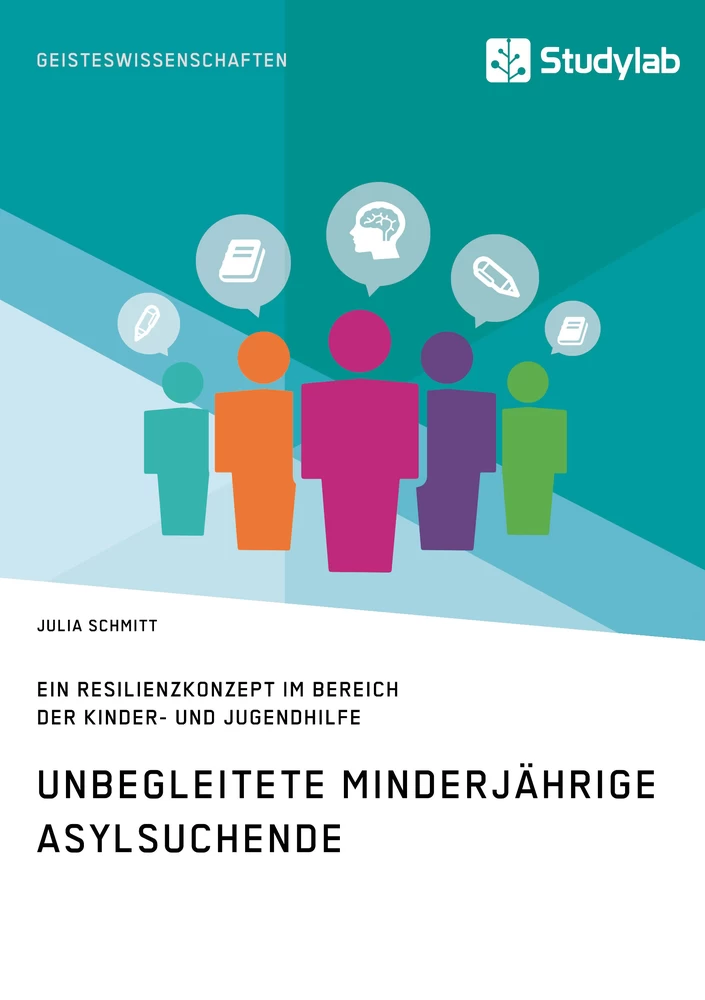Die hohe Fluchtzuwanderung hat seit dem Jahr 2015 zur intensiven Auseinandersetzung im Umgang mit schutzsuchenden Menschen in Deutschland geführt. Für Asylsuchende ist die Ankunft in Deutschland zwar oft das Ende einer langen Fluchtodyssee, doch diese birgt oftmals neue Herausforderungen und Probleme. Im Rahmen der Flüchtlingsdebatte 2015 lag der Fokus auf der Versorgung und Unterbringung aller Flüchtlinge. Doch unter der Zahl der Asylbewerber_innen stellen Kinder und Jugendliche einen nicht unerheblichen Anteil dar. Diese besonders hilfebedürftige Gruppe von Asylsuchenden verlässt das Heimatland ohne Begleitung einer Bezugsperson oder wird während der Flucht von ihnen getrennt. 14.439 unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmA) zählen daher zu den besonders schutzbedürftigen Personen und sollten nicht länger Randthema der aktuellen Debatte sein.
Ziel dieses Buches ist es, unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmA) dahingehend zu unterstützen, ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben in Deutschland führen zu können. So haben sie die Chance der Integration, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren. Die Frage „Wie resilienzfördernd arbeitet die Kinder- und Jugendhilfe mit Unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden?” ist eine der Hauptfragen, mit welcher sich die Autorin in dieser Thesis beschäftigt. In diesem Buch werden schwerpunktmäßig empirische Forschungsergebnisse auf die Erkenntnisfrage und somit die Relevanz und den Nutzen der Resilienz in Bezug auf die genannte Zielgruppe aufgezeigt. Im Theorieteil des Buchs wird die Bedeutung von Resilienz dargestellt. Wie gelingt es ressourcenorientiert mit dieser jungen Zielgruppe zu arbeiten, statt Probleme zu fokussieren? Die praktische Umsetzung von theoretischen Merkmalen der Resilienzförderung wird im Hauptteil empirisch untersucht.
Aus dem Inhalt:
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge;
- Aufnahmeverfahren in Deutschland;
- Resilienz;
- Resilienzförderung
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Zielgruppe: Unbegleitete minderjährige Asylsuchende
- 2.1 UmA - Eine Begriffserklärung
- 2.2 UmA auf der Flucht
- 2.3 Zahlen, Daten, Fakten in Deutschland
- 2.4 Rechtliche Rahmenbedingungen für UmA
- 2.5 Aufnahmeverfahren in Deutschland
- 2.6 Besonderheiten für UmA im Asylverfahren
- 2.7 Spannungsfeld: Kinder- und Jugendhilferecht und Asylrecht
- 3 Theorieteil: Das Resilienzkonzept
- 3.1 Resilienz - Eine Systematisierung des Begriffs
- 3.2 Resilienzförderung
- 3.3 Risiko- und Schutzfaktoren im Vergleich
- 3.4 Resilienzforschung – Studien der Entwicklungspsychologie
- 3.5 Theoretische Handlungsempfehlung zur Resilienzförderung in der Kinder- und Jugendhilfe
- 3.6 Kritik am Resilienzkonzept
- 4 Hauptteil: Eine empirische Untersuchung der Resilienzförderung mit UmA in der Kinder- und Jugendhilfe
- 4.1 Methodische Vorgehensweise
- 4.2 Die praktische Umsetzung resilienzfördernder Merkmale
- 4.3 Forschungserkenntnis und Handlungsempfehlung für die Kinder- und Jugendhilfe
- 5 Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Situation unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender (UmA) in Deutschland und entwickelt ein Resilienzkonzept zur Unterstützung ihrer Integration. Ziel ist es, UmA dabei zu helfen, ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben in Deutschland zu führen und ihre Integration zu fördern, ohne dabei ihre Identität zu verlieren.
- Die Herausforderungen und Besonderheiten der Situation unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender in Deutschland.
- Das Konzept der Resilienz und seine Anwendung in der Kinder- und Jugendhilfe.
- Risiko- und Schutzfaktoren für die psychosoziale Entwicklung von UmA.
- Empirische Untersuchung zur Resilienzförderung bei UmA.
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Unterstützung von UmA in der Kinder- und Jugendhilfe.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Situation von Flüchtlingen in Deutschland, insbesondere die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UmA) als besonders vulnerable Gruppe. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, diese Gruppe gezielt zu unterstützen, um eine erfolgreiche Integration zu ermöglichen und ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Bedeutung sozialpädagogischer Maßnahmen und der Zusammenarbeit verschiedener Akteure im Kontext von Aufenthalts- und Jugendhilferecht.
2 Die Zielgruppe: Unbegleitete minderjährige Asylsuchende: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Unbegleitete minderjährige Asylsuchende" (UmA), beleuchtet ihre Fluchterfahrungen, präsentiert statistische Daten zu ihrer Situation in Deutschland, und analysiert die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie das Aufnahmeverfahren. Es untersucht das Spannungsfeld zwischen Asylrecht und Kinder- und Jugendhilferecht und die spezifischen Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Die komplexe rechtliche Situation und die damit verbundenen Hürden für eine erfolgreiche Integration werden ausführlich dargestellt.
3 Theorieteil: Das Resilienzkonzept: Dieses Kapitel behandelt das Konzept der Resilienz, systematisiert den Begriff und erläutert verschiedene Ansätze zur Resilienzförderung. Es werden Risiko- und Schutzfaktoren im Detail betrachtet und die Relevanz von resilienten Entwicklungspsychologischen Studien wird herausgestellt. Abschließend wird eine theoretische Handlungsempfehlung zur Resilienzförderung in der Kinder- und Jugendhilfe gegeben und kritische Aspekte des Resilienzkonzepts diskutiert.
4 Hauptteil: Eine empirische Untersuchung der Resilienzförderung mit UmA in der Kinder- und Jugendhilfe: Dieser Abschnitt beschreibt die methodische Vorgehensweise einer empirischen Untersuchung zur Resilienzförderung bei UmA. Die praktische Umsetzung resilienzfördernder Maßnahmen wird detailliert dargestellt, wobei die Ergebnisse und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen für die Kinder- und Jugendhilfe im Fokus stehen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zur Optimierung der Unterstützung von UmA beitragen.
Schlüsselwörter
Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmA), Resilienz, Integration, Kinder- und Jugendhilfe, Asylrecht, Flucht, Trauma, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Entwicklungspsychologie, empirische Untersuchung, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Resilienzförderung bei unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Situation unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender (UmA) in Deutschland und entwickelt ein Resilienzkonzept zur Unterstützung ihrer Integration. Das Ziel ist es, UmA dabei zu helfen, ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben in Deutschland zu führen und ihre Integration zu fördern, ohne dabei ihre Identität zu verlieren.
Welche Zielgruppen werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmA) in Deutschland. Das Kapitel 2 beleuchtet die Definition von UmA, ihre Fluchterfahrungen, statistische Daten, rechtliche Rahmenbedingungen, Aufnahmeverfahren und die Besonderheiten im Asylverfahren.
Welches theoretische Konzept steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Das zentrale theoretische Konzept ist die Resilienz. Kapitel 3 systematisiert den Begriff der Resilienz, erläutert Ansätze zur Resilienzförderung, betrachtet Risiko- und Schutzfaktoren und diskutiert relevante Studien der Entwicklungspsychologie. Es wird eine theoretische Handlungsempfehlung zur Resilienzförderung in der Kinder- und Jugendhilfe gegeben und das Konzept kritisch reflektiert.
Wie wird die Resilienzförderung empirisch untersucht?
Kapitel 4 beschreibt eine empirische Untersuchung zur Resilienzförderung bei UmA. Es werden die methodische Vorgehensweise, die praktische Umsetzung resilienzfördernder Maßnahmen, die Forschungsergebnisse und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen für die Kinder- und Jugendhilfe dargestellt.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen für UmA in Deutschland, insbesondere das Spannungsfeld zwischen Asylrecht und Kinder- und Jugendhilferecht. Die komplexen rechtlichen Aspekte und die damit verbundenen Hürden für eine erfolgreiche Integration werden ausführlich dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmA), Resilienz, Integration, Kinder- und Jugendhilfe, Asylrecht, Flucht, Trauma, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Entwicklungspsychologie, empirische Untersuchung, Handlungsempfehlungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Zielgruppe: Unbegleitete minderjährige Asylsuchende, Theorieteil: Das Resilienzkonzept, Hauptteil: Eine empirische Untersuchung der Resilienzförderung mit UmA in der Kinder- und Jugendhilfe, und Resümee und Ausblick.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit liefert empirische Erkenntnisse zur Resilienzförderung bei UmA und entwickelt daraus Handlungsempfehlungen für die Kinder- und Jugendhilfe zur Optimierung der Unterstützung dieser besonders vulnerablen Gruppe. Die Ergebnisse sollen zu einer erfolgreichen Integration und einem selbstbestimmten Leben der UmA in Deutschland beitragen.
- Citation du texte
- Julia Schmitt (Auteur), 2016, Unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Ein Resilienzkonzept im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358058