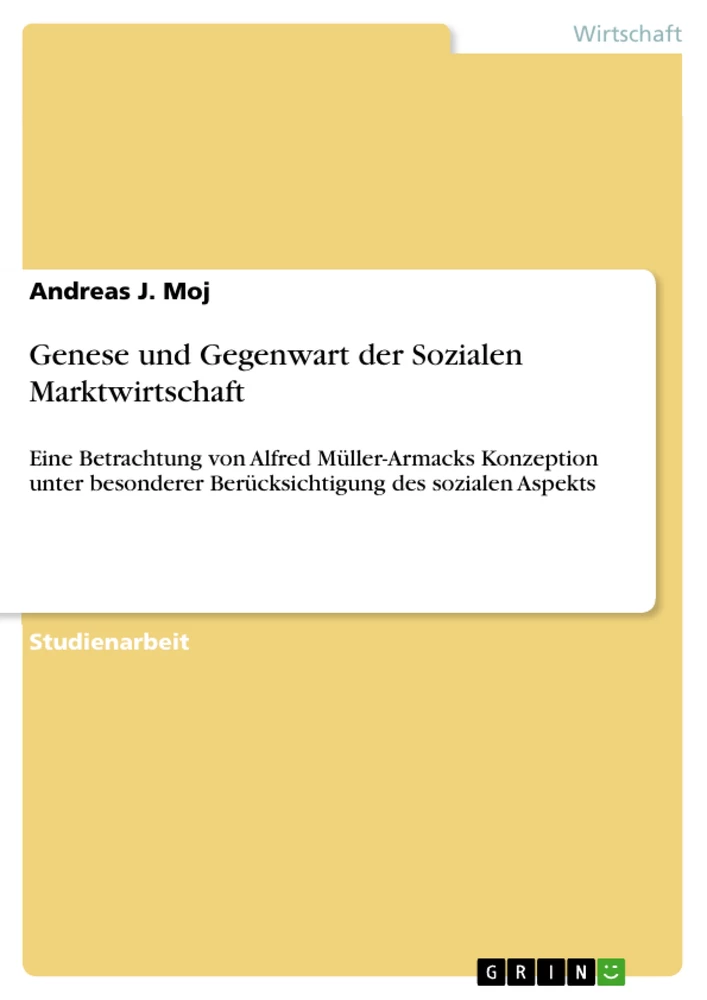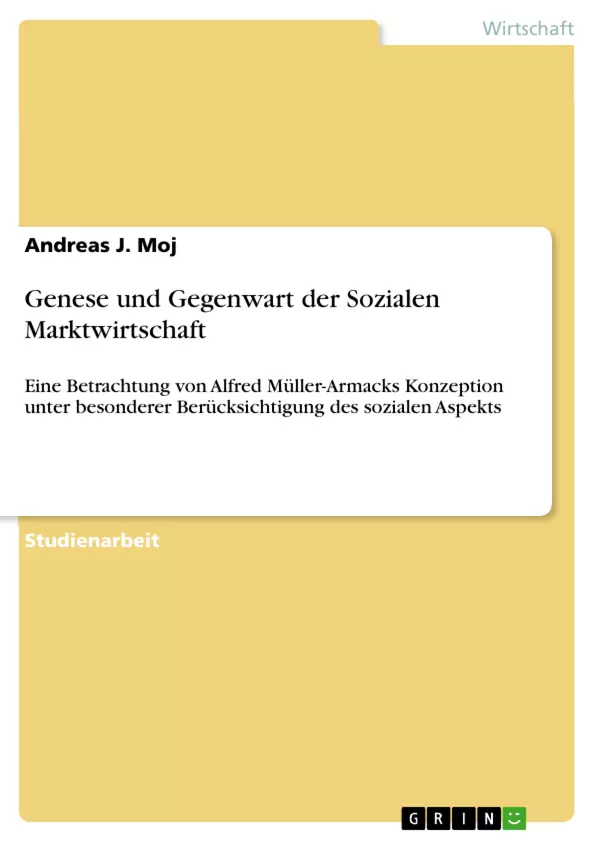Die Soziale Marktwirtschaft nach Vorstellungen Alfred Müller-Armacks gilt im internationalen Vergleich gemeinhin als deutsche Besonderheit. Dieser vielzitierte "Dritte Weg", der zweifellos eine historische Erfolgsgeschichte darstellt, wird heutzutage von allen politischen Strömungen für sich vereinnahmt, insbesondere unter Herausstellung der sozialen Komponente, im Gegensatz zum oft gescholtenen "Raubtierkapitalismus". Doch es stellt sich die Frage, wie sozial die Soziale Marktwirtschaft in ihrer ursprünglichen Konzeption tatsächlich angelegt war.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland in Hinblick auf ihre ideengeschichtliche Basis darzustellen. Dafür soll zunächst das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft näher untersucht und spezifiziert werden. Im weiteren Verlauf sollen historische Leitlinien sowie wichtige handelnde Akteure beleuchtet werden. Dies betrifft einerseits politisch Handelnde wie Alfred Müller-Armack und Ludwig Erhard, die im Nachkriegsdeutschland entsprechende Fundamente legten. Andererseits sollen die verwandten Wirtschaftskonzepte von Ordo- bzw. Neoliberalismus betrachtet werden, auf deren Konzeptionen die Soziale Marktwirtschaft fußt.
Nachdem die historischen und theoretischen Hintergründe geklärt wurden, folgt eine Betrachtung der jüngeren Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das ideengeschichtliche Fundament
- Neoliberalismus
- Ordoliberalismus
- Das Wesen der Sozialen Marktwirtschaft nach Müller-Armack
- Die historische Genese
- Leitbild und Konzept der Sozialen Marktwirtschaft
- Das Soziale der Sozialen Marktwirtschaft nach Müller-Armack
- Soziale Marktwirtschaft und Ordoliberalismus
- Die Gegenwart der Sozialen Marktwirtschaft
- Die soziale Marktwirtschaft im Systemwettbewerb
- Die INMS als Beispiel für Begriffsbesetzung
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Genese und Gegenwart der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert insbesondere die Konzeption von Alfred Müller-Armack unter besonderer Berücksichtigung des sozialen Aspekts. Die Arbeit untersucht das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft, ihre historischen Leitlinien und die wichtigsten handelnden Akteure. Zudem werden die verwandten Wirtschaftskonzepte des Neoliberalismus und Ordoliberalismus betrachtet, auf denen die Soziale Marktwirtschaft basiert.
- Die ideengeschichtliche Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft
- Die Rolle des Neoliberalismus und Ordoliberalismus als Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft
- Die zentralen Elemente des Leitbildes der Sozialen Marktwirtschaft
- Die historische Genese der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland
- Die Bedeutung des sozialen Aspekts in der Sozialen Marktwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sozialen Marktwirtschaft ein und beleuchtet deren Bedeutung für den Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem ideengeschichtlichen Fundament der Sozialen Marktwirtschaft und stellt die Konzepte des Neoliberalismus und Ordoliberalismus vor. Das dritte Kapitel analysiert das Wesen der Sozialen Marktwirtschaft nach Müller-Armack, einschließlich ihrer historischen Genese, ihres Leitbildes und des sozialen Aspekts. Das vierte Kapitel untersucht die Gegenwart der Sozialen Marktwirtschaft im Kontext des Systemwettbewerbs und betrachtet die INMS als Beispiel für eine neue Interpretation des Begriffs.
Schlüsselwörter
Soziale Marktwirtschaft, Alfred Müller-Armack, Neoliberalismus, Ordoliberalismus, Walter Eucken, Friedrich Hayek, Wirtschaftspolitik, Systemwettbewerb, INMS, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Väter der Sozialen Marktwirtschaft?
Zentrale Akteure waren Alfred Müller-Armack, der den Begriff prägte, und Ludwig Erhard, der das Konzept politisch in der Nachkriegszeit umsetzte.
Was unterscheidet die Soziale Marktwirtschaft vom Neoliberalismus?
Während der Neoliberalismus den freien Markt betont, integriert die Soziale Marktwirtschaft gezielt soziale Ausgleichsmechanismen als „Dritten Weg“.
Welche Rolle spielt der Ordoliberalismus?
Der Ordoliberalismus (z.B. nach Walter Eucken) liefert das theoretische Fundament, indem er einen starken Staat fordert, der den Ordnungsrahmen für den Wettbewerb setzt.
Wie „sozial“ war das ursprüngliche Konzept von Müller-Armack?
Die Arbeit untersucht, ob die soziale Komponente von Anfang an zentral war oder ob sie eher als Ergänzung zur Marktfreiheit gedacht war.
Was ist die INMS und welche Rolle spielt sie heute?
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INMS) wird als Beispiel dafür angeführt, wie der Begriff heute politisch neu interpretiert und besetzt wird.
- Quote paper
- Andreas J. Moj (Author), 2017, Genese und Gegenwart der Sozialen Marktwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358170