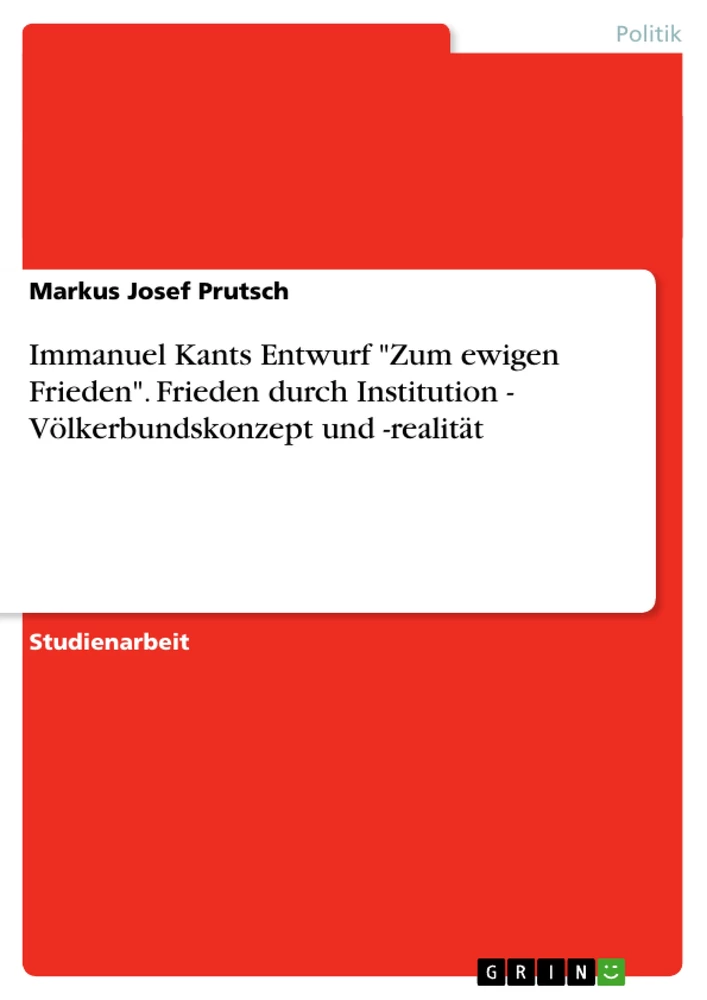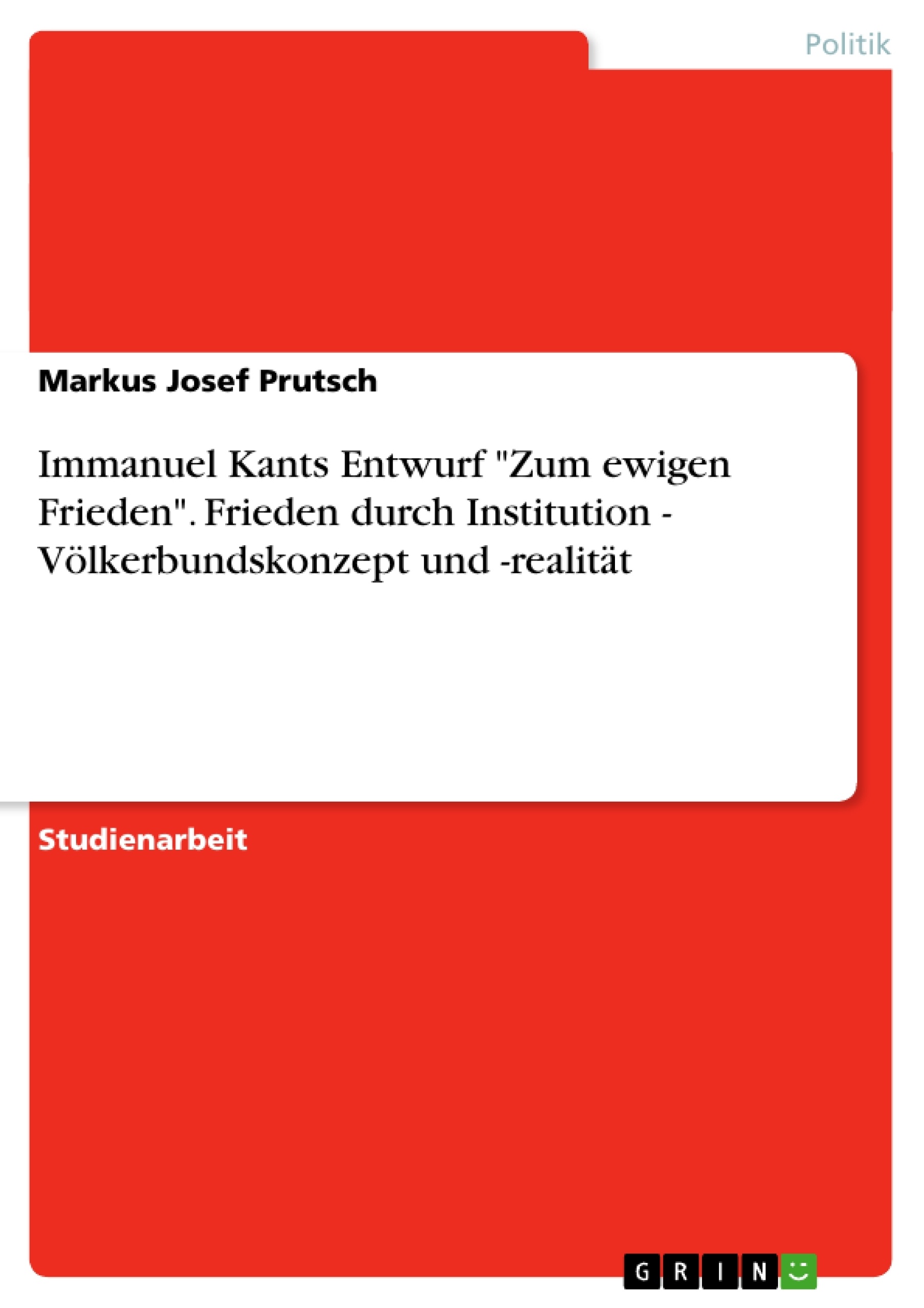Der Friede, wiewohl einer der ältesten Wunschträume der Menschheit - er verkörpert doch in jeder Hinsicht ein „vernachlässigtes Ideal“ (Vgl. Höffe 1995a, 5). Denn wie oft er auch beschworen worden sein mag, wie emphatisch man ihn zum Durchbruch verhelfen suchte , so oft konterkarierte doch die Realität das hehre Bemühen, zeigte sich die Welt hoffnungslos in Gewalt, Hass und Krieg verstrickt. Umso mehr aber gilt es, der Frage nach dem „Warum“ und dem „Wie“ nachzugehen: „Warum“ der Versuch der Friedensstiftung sic h als solch schwieriger, nur allzu oft von Misserfolg begleiteter erweist, beziehungsweise „wie“ Auswege zu finden sind und eine dauerhafte Friedensordnung etabliert zu werden vermag. Beide Fragen standen auch für Immanuel Kant, jenen Königsberger Denker, der sich als Wegbereiter der „Aufklärung“ - vielleicht die nachhaltigste der europäischen Geistesbewegungen - einen dauerhaften Platz unter den großen Philosophen zu sichern vermochte, im Raum, als er 1795 unter dem Eindruck der Aufbruch wie Unsicherheit gleichermaßen verkörpernden Französischen Revolution zum Entwurf für einen Frieden gelangte, der sogar den Anspruch auf „Ewigkeit“ erhob. Mit seiner Abhandlung „Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant“, 1796 erweitert in zweiter Au flage erschienen, ordnete der sich der zum damaligen Zeitpunkt bereits über 70jährige nicht nur in die Reihe maßgeblicher „politischer Denker“ ein, sondern konnte eingedenk dessen, dass „Pax“ erstmals explizit in den Rang eines philosophischen Grundbegriff es gehoben wurde, sogar den Anspruch einer Vorreiterrolle erheben. Tatsächlich stellt denn auch Kants Schrift bis heute den vielleicht wichtigsten „klassischen“ Text zu Frieden als eine der vordringlichsten - wenngleich allzu oft nur wenig geachteten - Aufgaben der Politik dar. Sich diesem wirkungsmächtigen Text in knapper Form unter dem doppelten Gesichtspunkt von „formaler“ Gestalt und Relevanz für die Ausgestaltung einer „realen“ internationalen Ordnung anzunehmen, mag ebenfalls Aufgabe vorliegender Proseminararbeit sein. Dementsprechend stehen zwei Hauptfragestellungen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses: I) Wie stellt sich Immanuel Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ in Form und Inhalt dar? II) [...]
Inhaltsverzeichnis
- 0. EINLEITUNG
- FRIEDENSBEGRIFF UND FRIEDENSKONZEPTION VOR KANT – EIN ÜBERBLICK
- 1. „ZUM EWIGEN FRIEDEN“
- 2.1. „PRÄLIMINARARTIKEL“
- 2.2. „DEFINITIVARTIKEL“
- 2.3. „ZUSÄTZE“
- 2.4. „ANHANG“
- 3. KANTS FRIEDENSENTWURF – ANTIZIPATION ODER UTOPIE?
- 4. KANT UND DIE HEUTIGE INTERNATIONALE STAATENORGANISATION
- 4.1. „ZUM EWIGEN FRIEDEN“, DIE VEREINTEN NATIONEN UND IHR DILEMMA.
- 4.2. ZUR REVISION DES KANT'SCHEN VölkerbundskoNZEPTES
- 5. RESÜMEE UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Proseminararbeit ist es, Immanuel Kants Entwurf „Zum ewigen Frieden“ im Hinblick auf seine formale Gestalt und seine Relevanz für die Gestaltung einer internationalen Ordnung, insbesondere für die Struktur und Wirkung eines „Völkerbundes“, zu untersuchen. Dabei stehen zwei Hauptfragestellungen im Mittelpunkt:
- Wie stellt sich Immanuel Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ in Form und Inhalt dar?
- Welchen Stellenwert nimmt dieser „philosophische Entwurf“ für das Konzept einer internationalen Ordnung, insbesondere Struktur und Wirkung eines „Völkerbundes“, ein?
Die Arbeit widmet sich folgenden zentralen Themen:
- Kants Vorstellung von einem ewigen Frieden und seine Kritik an der bestehenden internationalen Ordnung.
- Die Rolle von Institutionen und Rechtsnormen in Kants Friedenskonzeption.
- Die Bedeutung des Völkerbundes als Garant für Frieden und Sicherheit.
- Die aktuelle internationale Staatenorganisation im Spiegel des Kant'schen Entwurfs.
- Die Frage nach einer möglichen Revision des Kant'schen Völkerbundmodells.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Friedensdiskussion im 18. Jahrhundert beleuchtet und die zentralen Fragestellungen der Arbeit einführt. Im ersten Hauptkapitel wird ein Überblick über die Geschichte des Friedensbegriffs und verschiedener Friedenskonzeptionen vor Kant gegeben, um die Thematik in einen übergeordneten Bedeutungszusammenhang zu stellen.
Das zweite Kapitel widmet sich Kants Friedenskonzeption in Form und Inhalt. Die Arbeit analysiert die „Präliminarartikel“ und „Definitivartikel“ des „Ewigen Friedens“, um Kants Vorstellungen von einer dauerhaften Friedensordnung zu ergründen.
In Kapitel drei wird die Frage aufgeworfen, inwiefern Kants „Ewiger Frieden“ als ein „praktikabler“ Entwurf für eine internationale Ordnung anzusehen ist oder ob seine Ansichten eher als Utopie einzuordnen sind.
Kapitel vier untersucht die heutige internationale Staatenorganisation im Spiegel des „Ewigen Friedens“ und thematisiert, inwiefern die Vereinten Nationen Elemente des von Kant entwickelten Völkerbundideals verkörpern und ob die heutigen Erfahrungen eine Revision des Kant'schen Modells erfordern, um Frieden in globaler Dimension zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Frieden und Sicherheit im Kontext der internationalen Politik. Zentrale Schlüsselwörter sind: „Ewiger Frieden“, „Völkerbund“, „Friedensordnung“, „Staatenorganisation“, „Krieg“, „Recht“, „Institutionen“, „Vereinte Nationen“, „Utopie“, „Realpolitik“, „Antizipation“ und „Revision“. Die Arbeit analysiert Immanuel Kants „Zum ewigen Frieden“ als ein klassisches Werk der politischen Philosophie und untersucht seine Relevanz für die heutige internationale Politik.
Häufig gestellte Fragen
Wann verfasste Immanuel Kant seinen Entwurf „Zum ewigen Frieden“?
Kant veröffentlichte die Schrift 1795 unter dem Eindruck der Französischen Revolution; eine erweiterte zweite Auflage erschien 1796.
Was sind die „Präliminarartikel“ in Kants Werk?
Es handelt sich um sechs vorläufige Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein dauerhafter Friede zwischen Staaten überhaupt möglich wird.
Was ist das Ziel von Kants Völkerbundskonzept?
Kant schlägt einen Bund freier Staaten vor, der durch Rechtsnormen und Institutionen den Frieden sichert, ohne eine Weltrepublik zu sein.
Wie aktuell ist Kants Friedensentwurf für die heutigen Vereinten Nationen?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die UN Elemente von Kants Ideal verkörpern und wo das Dilemma zwischen Kants Theorie und der heutigen Realpolitik liegt.
Ist der „ewige Friede“ nach Kant eine Utopie?
Kant sah ihn nicht als bloße Utopie, sondern als eine notwendige, vernunftrechtliche Aufgabe der Politik, die schrittweise realisiert werden muss.
- Citation du texte
- Markus Josef Prutsch (Auteur), 2003, Immanuel Kants Entwurf "Zum ewigen Frieden". Frieden durch Institution - Völkerbundskonzept und -realität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35834