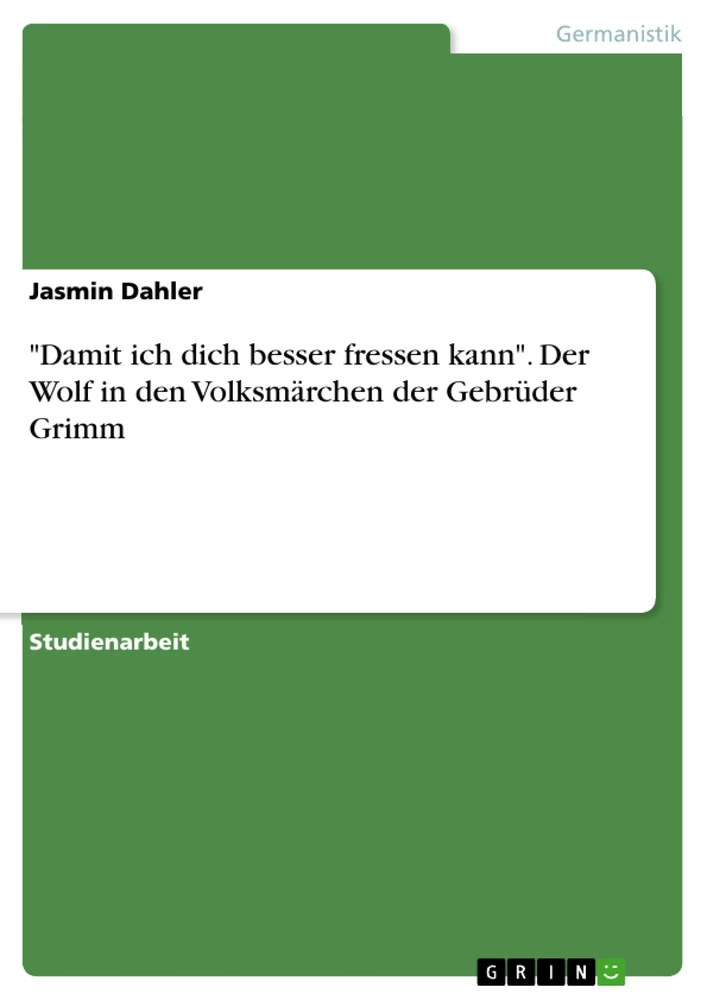Diese Arbeit wird sich gezielt mit dem Wolf in den Märchen der Gebrüder Grimm befassen, um zu zeigen, dass es in den Märchen nicht nur den bösen Wolf gibt, sondern dass der Wolf auch anders dargestellt wird. Das Augenmerk soll dabei auf den Kinder- und Hausmärchen liegen, in denen der Wolf eine größere Rolle einnimmt und das Geschehen mit beeinflusst. Märchen, in denen der Wolf nur eine kurze Erwähnung findet und Lügenmärchen werden nicht mit einbezogen
Der Wolf kommt in vielen Märchen der Welt vor und nimmt bei den meisten, in denen er eine Erwähnung findet, eine zentrale Rolle ein. Auch in den deutschen Märchen und besonders bei den Brüdern Grimm tritt der Wolf oft in Erscheinung. Dennoch hat er in der Forschung, wie die meisten Tiere in Märchen, noch keine große Beachtung gefunden. Zwar wird er bei Interpretationen von Märchen, wie Rotkäppchen mit einbezogen, wird dabei aber nur als Nebenrolle betrachtet und rückt nicht in den Mittelpunkt. Er wird als unterstützendes Interpretationsmittel verwendet, um andere Aspekte in den Märchen besser zu verstehen. Dabei wird der Wolf oft als das Böse angesehen, dass den Protagonisten Schaden zufügen will.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Volksmärchen - Aufbau und Struktur
- 2. Die Arten des Wolfes
- 2.1. Der große böse Wolf
- 2.2. Der dumme gierige Wolf
- 2.3. Der neutrale Wolf
- 3. Rotkäppchen und die Interpretationsmöglichkeiten des Wolfes
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Wolfes in den Märchen der Brüder Grimm und zeigt, dass die Figur des Wolfes in den Märchen nicht nur auf das Böse reduziert werden kann.
- Analyse der Darstellung des Wolfes in den Märchen der Brüder Grimm
- Untersuchung der verschiedenen Arten des Wolfes in den Märchen
- Interpretation der vielschichtigen Bedeutung der Darstellung des Wolfes in den Märchen
- Betrachtung der Beziehung des Wolfes zu den anderen Figuren in den Märchen
- Einbezug von mythologischen und historischen Kontexten zur Erhellung der Darstellung des Wolfes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des Wolfes in den Märchen der Brüder Grimm. Sie hebt die unzureichende Forschungslage zum Thema des Wolfes in Märchen hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
1. Das Volksmärchen - Aufbau und Struktur
Dieses Kapitel bietet einen Einblick in die Struktur und den Aufbau des Volksmärchens. Es beleuchtet die Entstehung der Märchen der Brüder Grimm sowie die Merkmale des Volksmärchens, wie die Haupthandlung, die Präsensform, das glückliche Ende und die eindimensionalen Figuren.
2. Die Arten des Wolfes
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der vielfältigen Darstellung des Wolfes in den Märchen. Es werden drei Unterarten des Wolfes vorgestellt: der große böse Wolf, der dumme gierige Wolf und der neutrale Wolf. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Rollen, die der Wolf in den Märchen einnimmt, sowie die Beziehung des Wolfes zu anderen Figuren.
3. Rotkäppchen und die Interpretationsmöglichkeiten des Wolfes
Dieses Kapitel widmet sich dem Märchen „Rotkäppchen“ und untersucht die vielschichtigen Interpretationsmöglichkeiten des Wolfes in diesem Märchen. Es geht auf die Funktion des Wolfes in der Geschichte ein und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf seine Darstellung.
Schlüsselwörter
Volksmärchen, Brüder Grimm, Wolf, Darstellung, Mythologie, Geschichte, Rotkäppchen, Interpretation, Figuren, Beziehung, Protagonist, Antagonist, Symbol
Häufig gestellte Fragen
Wird der Wolf in Grimms Märchen immer als böse dargestellt?
Nein, die Arbeit zeigt, dass es neben dem "bösen Wolf" auch den "dummen gierigen" und sogar "neutrale" Wölfe in den Volksmärchen gibt.
Welche drei Arten des Wolfes unterscheidet die Arbeit?
Es werden der große böse Wolf, der dumme gierige Wolf und der neutrale Wolf unterschieden.
Welche Rolle spielt der Wolf im Märchen "Rotkäppchen"?
Im Rotkäppchen dient der Wolf oft als Interpretationsmittel für das Böse oder als Symbol für Gefahren, die über die reine Tiergestalt hinausgehen.
Warum wurde der Wolf in der Forschung bisher vernachlässigt?
Tiere in Märchen werden oft nur als Nebenfiguren oder unterstützende Symbole betrachtet, anstatt sie als eigenständige Charaktere in den Mittelpunkt zu rücken.
Was sind typische Merkmale von Volksmärchen?
Dazu gehören eine klare Struktur, eindimensionale Figuren, die Präsensform und ein meist glückliches Ende.
- Quote paper
- Jasmin Dahler (Author), 2013, "Damit ich dich besser fressen kann". Der Wolf in den Volksmärchen der Gebrüder Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358806