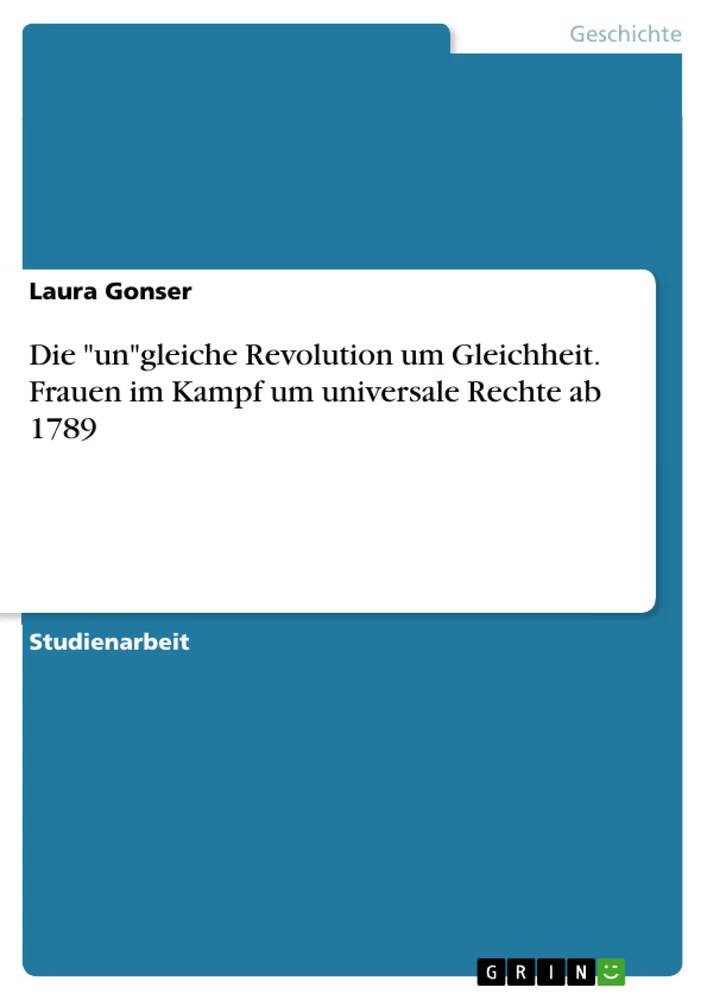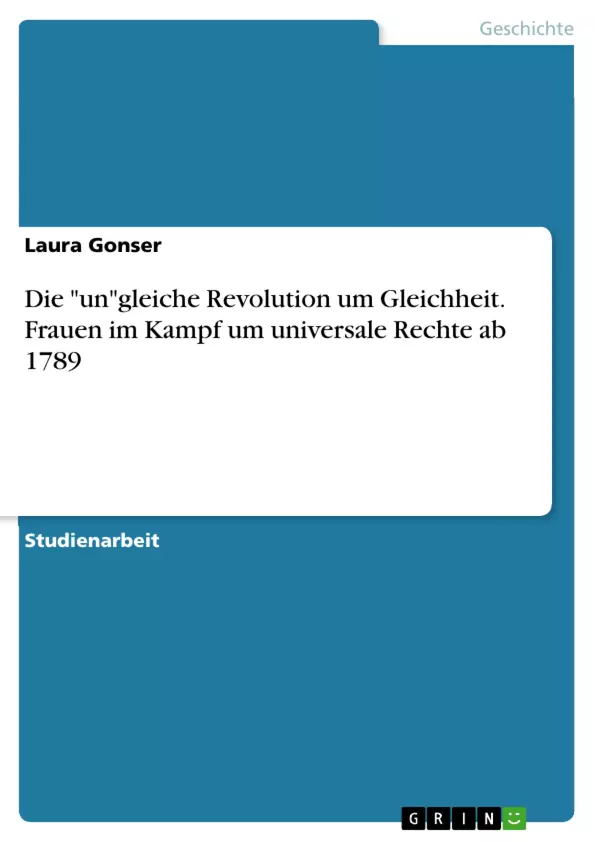Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Rechte und Gleichheit in Frankreich um 1789
2.1 Das Konzept von Gleichheit und Gleichberechtigung
3. Frauen am Vorabend und während der Revolution
3.1 Das Geschlechterrollenverständnis Ende des 18. Jahrhunderts
3.2 Aktivitäten
3.2.1 Aufstände und Demonstrationen
3.2.2 Klubs - La Societé des Citoyennes Républicaines Révolutionaires
4. Olympe de Gouges
4.1 Person
4.2 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
Die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ von Olympe de Gouges
Ziel dieser Arbeit ist es, die Aktivität der Frauen und ihre Rolle in und für die Revolution herauszuarbeiten. Um diesen Aspekt der Jahre 1789-1793 besser zu verstehen, ist es hilfreich zunächst ein Grundverständnis zu der damaligen rechtlichen Lage zu schaffen.Was besagten die Menschen- und Bürgerrechte aus dem Jahr 1789 und wer legte diese fest? Erst wenn auf dieser Ebene ein Grundwissen geschaffen wurde, kann sich der Thematik um Frauen und ihrer Motivationen in der Bestrebung um Geschlechtergleicheit sowie ihrem Kampf um politisches Mitwirken gewidmet werden.
Dafür spielt das damalige Geschlechterverständnis selbstverständlich eine wichtige Rolle, denn müssen Werte und Ideale immer in einem zeithistorischen Kontext betrachtet werden. Dann auch lässt sich diskutieren ob es womöglich zu einer eher unbewussten und nicht mutwillig bösartigen Exklusion von Frauen während der Verfassungsdiskussionen 1789 gekommen ist.
Außerdem ist es relevant zu analysieren wie die Rolle der Frau im öffentlichen Leben als auch intern im privaten Bereich verordnet wurde, denn daran ist die Vorstellung von Frauen auf der politischen Bühne gebunden. Zu betrachten ist auch, in welchem Ausmaß und in welcher Form Frauen während der Jahre 1789-1793 aktiv wurden. Dabei sollen die Teilnahme an Demonstrationen sowie die Gründung von politischen Klubs vorgestellt werden. Das politische Engagement der Frauen in Form von Schriften und Publikationen wird dann im letzten Abschnitt durch Olympe de Gouges Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne illustriert und im Gesamtkontext bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Rechte und Gleichheit in Frankreich um 1789
- Das Konzept von Gleichheit und Gleichberechtigung
- Déclaration des droits de l'homme et de citoyen
- Frauen am Vorabend und während der Revolution
- Das Geschlechterrollenverständnis Ende des 18. Jahrhunderts
- Aktivitäten
- Aufstände und Demonstrationen
- Klubs - La Société des Citoyennes Répubilcaines Révolutionaires
- Olympe de Gouges
- Person
- Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Rolle von Frauen in der Französischen Revolution und untersucht die Herausforderungen, die sie im Kampf um universale Rechte und Gleichberechtigung im Kontext einer revolutionären Umbruchphase erlebten.
- Das Konzept von Gleichheit und Gleichberechtigung in Frankreich um 1789
- Die Rolle von Frauen im revolutionären Aufbruch und deren Forderungen
- Die Aktivitäten von Frauen, wie Aufstände, Demonstrationen und die Gründung von politischen Klubs
- Die Bedeutung von Olympe de Gouges und ihrer "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne"
- Die Frage, inwieweit der Kampf von Frauen während der Revolution als ein geschlossener Kampf gegen Geschlechterungleichheit betrachtet werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik im Kontext der heutigen Zeit dar und zeigt, wie Frauen in der Vergangenheit für Gleichberechtigung kämpften. Sie führt die Ziele der Arbeit sowie die Forschungsmethode ein.
- Kapitel 2 untersucht das Konzept von Gleichheit und Gleichberechtigung in Frankreich um 1789 und erklärt die "Déclaration des droits de l'homme et de citoyen".
- Kapitel 3 analysiert die gesellschaftliche Rolle von Frauen im 18. Jahrhundert und beschreibt die Aktivitäten von Frauen während der Revolution, einschließlich Aufständen, Demonstrationen und der Gründung von politischen Klubs.
- Kapitel 4 widmet sich der Person Olympe de Gouges und analysiert ihre "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" im Kontext des Kampfes um Frauenrechte.
Schlüsselwörter
Französische Revolution, Frauenrechte, Gleichberechtigung, Geschlechterrollen, politische Partizipation, Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Aktivisten, Klubs, Aufstände, Demonstrationen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Frauen in der Französischen Revolution?
Frauen waren aktiv an Aufständen und Demonstrationen beteiligt und gründeten politische Klubs wie „La Société des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires“, um für politische Mitwirkung zu kämpfen.
Wer war Olympe de Gouges?
Olympe de Gouges war eine Aktivistin und Autorin, die 1791 die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ verfasste, um auf die Exklusion der Frauen aus den universalen Menschenrechten aufmerksam zu machen.
Schlossen die Menschenrechte von 1789 Frauen mit ein?
Nein, die „Déclaration des droits de l'homme et du citoyen“ war faktisch auf Männer beschränkt. Frauen blieben von politischen Rechten und der Verfassungsdiskussion weitgehend ausgeschlossen.
Wie war das Geschlechterrollenverständnis im späten 18. Jahrhundert?
Frauen wurden primär dem privaten Bereich zugeordnet. Ihr Engagement im öffentlichen oder politischen Leben stieß auf starken gesellschaftlichen Widerstand.
Was forderte Olympe de Gouges in ihrer Erklärung?
Sie forderte die vollständige rechtliche und politische Gleichstellung von Frauen und Männern, basierend auf dem Prinzip, dass Frauen dieselben Pflichten und somit auch dieselben Rechte haben sollten.
War der Kampf der Frauen ein geschlossener Widerstand?
Die Arbeit untersucht kritisch, inwieweit die Aktivitäten der Frauen als einheitliche Bewegung gegen Geschlechterungleichheit oder als vielfältige, teils isolierte Proteste zu betrachten sind.
- Quote paper
- Laura Gonser (Author), 2017, Die "un"gleiche Revolution um Gleichheit. Frauen im Kampf um universale Rechte ab 1789, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358970