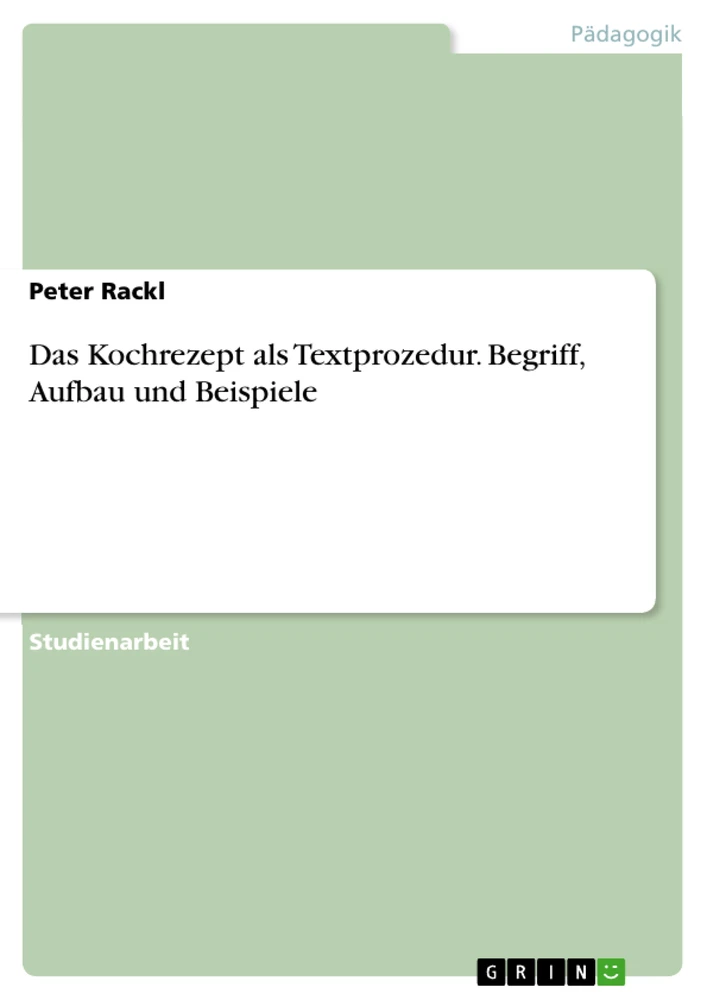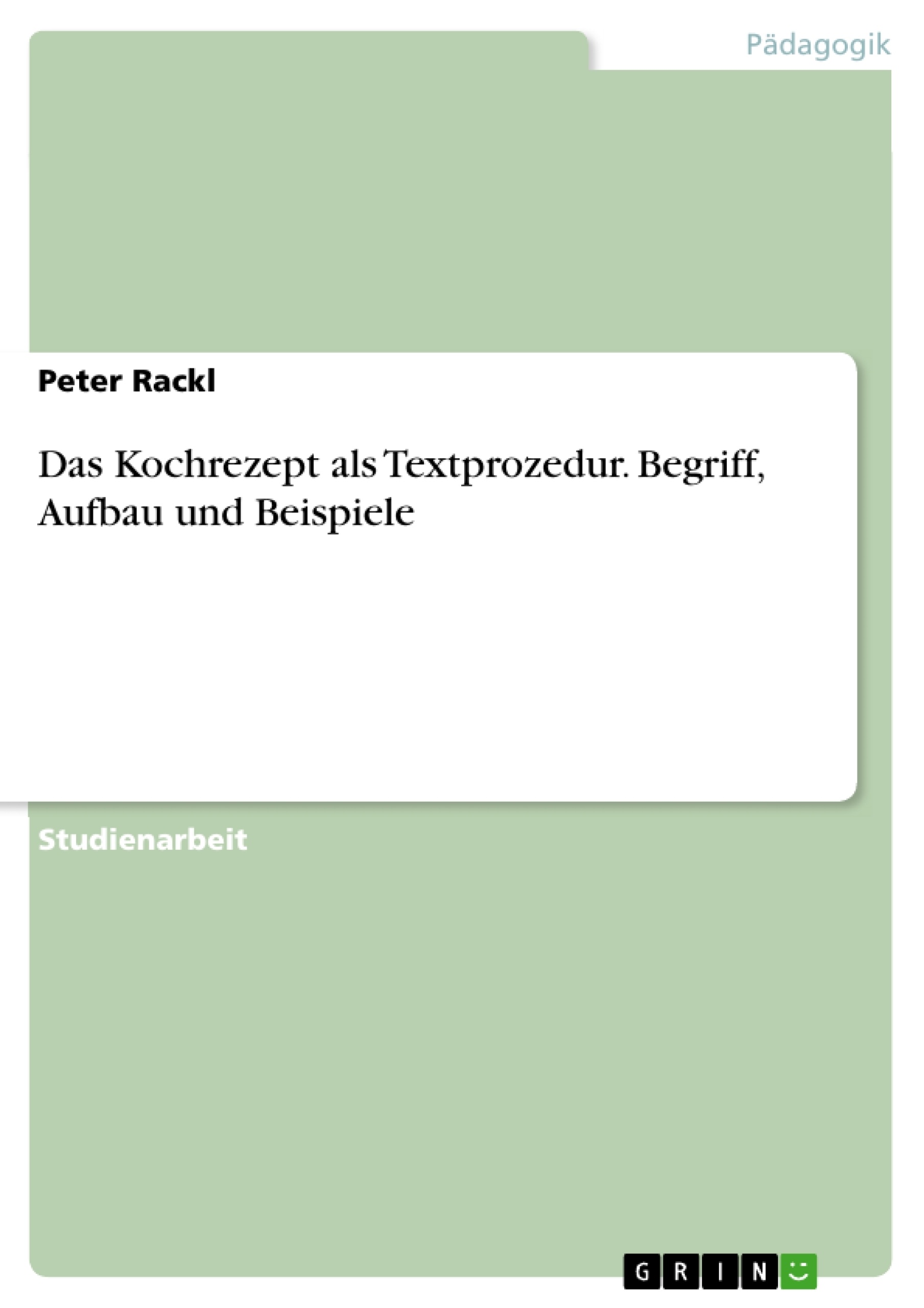In dieser Arbeit soll näher auf Kochrezepte bzw. Kochanleitungen eingegangen werden. Hierzu bedarf es zunächst einer Abgrenzung und einer Zuordnung zu einer Textsorte.
Im Alltag liest man oft verschiedene Kochrezepte, welche heutzutage auch in den neuen Medien, wie zum Beispiel dem Internet, gut vertreten sind. Wenn man genauer darüber nachdenkt, kann man zu dem Entschluss kommen, ein Kochrezept könnte eine Art Gebrauchsanleitung sein. Es wird vermittelt, wie, mit welchen Hilfsmitteln oder auf welche Art ein Ziel, beispielsweise ein fertiger Kuchen, erfolgreich erlangt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Textsorten
- Allgemeine Begriffsbestimmung
- Abgrenzung des Gegenstandsbereiches „Kochrezept“
- Der Schreibprozess
- Die Instruktion
- Aufbau einer Kochanleitung/eines Kochrezeptes
- Der Aufbau
- Textprozeduren
- Text- und Satzlänge
- Die Syntax
- Die Fachsprache
- Lernaufgabe
- Thematischer Rahmen
- Die Lernaufgabe „Das Verfassen einer Kochanleitung“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Textsortenwandel und die spezifischen Charakteristika von Kochrezepten im Kontext von Gebrauchsanweisungen. Ziel ist es, die strukturellen und sprachlichen Besonderheiten von Kochrezepten zu analysieren und ihren Schreibprozess zu beleuchten.
- Textsortenwandel und Definition des Begriffs „Textsorte“
- Abgrenzung von Kochrezepten zu anderen Textsorten, insbesondere Gebrauchsanweisungen
- Der Schreibprozess von instruktiven Texten wie Kochanleitungen
- Strukturelle und sprachliche Merkmale von Kochrezepten (Textlänge, Syntax, Fachsprache)
- Didaktische Aspekte des Schreibens von Kochanleitungen
Zusammenfassung der Kapitel
Textsorten: Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der allgemeinen Begriffsbestimmung von Textsorten und deren Wandel im Laufe der Zeit. Es wird die Schwierigkeit einer präzisen Definition von „Textsorte“ im wissenschaftlichen und alltäglichen Sprachgebrauch diskutiert und verschiedene Definitionen, beispielsweise die von Frohnes, vorgestellt. Der Hauptteil des Kapitels widmet sich der Abgrenzung von Kochrezepten und ihrer Zuordnung zu einer Textsorte. Es wird die Frage untersucht, ob Kochrezepte als Gebrauchsanweisungen betrachtet werden können, und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kochrezepten, Anleitungen und Anweisungen werden detailliert analysiert. Die Diskussion umfasst verschiedene Ansätze und Perspektiven von Linguisten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wobei die Problematik der eindeutigen Kategorisierung im Vordergrund steht.
Der Schreibprozess: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Schreibprozess von instruktiven Texten, insbesondere Kochanleitungen. Der Begriff „Instruktion“ wird erläutert und die beiden zentralen Funktionen – Appellfunktion (Handlungsanregung) und Informations- und Darstellungsfunktion (Aufklärung über Handlungsschritte) – werden detailliert beschrieben. Am Beispiel des Kuchenbackens werden die Anforderungen an den Instruierenden verdeutlicht: Schrittweise Anleitung zum Ziel, Selektion relevanter Informationen, isolierte, geordnete und verknüpfte Beschreibung der einzelnen Schritte. Der Fokus liegt auf der klaren und verständlichen Darstellung der Handlungsanweisungen für den Rezipienten.
Schlüsselwörter
Textsorten, Kochrezepte, Kochanleitungen, Gebrauchsanweisungen, Instruktion, Schreibprozess, Appellfunktion, Informationsfunktion, Textstruktur, Syntax, Fachsprache, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Kochrezepten als Textsorte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Kochrezepte als Textsorte. Sie untersucht den Textsortenwandel, die spezifischen Charakteristika von Kochrezepten im Kontext von Gebrauchsanweisungen und beleuchtet deren Schreibprozess. Der Fokus liegt auf der strukturellen und sprachlichen Analyse sowie den didaktischen Aspekten des Schreibens von Kochanleitungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die allgemeine Begriffsbestimmung von Textsorten und deren Wandel, die Abgrenzung von Kochrezepten zu anderen Textsorten (insbesondere Gebrauchsanweisungen), den Schreibprozess instruktiver Texte (mit Fokus auf die Appell- und Informationsfunktion), die strukturellen und sprachlichen Merkmale von Kochrezepten (Textlänge, Syntax, Fachsprache) und die didaktischen Aspekte des Schreibens von Kochanleitungen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Textsorten (mit allgemeiner Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Kochrezepten), dem Schreibprozess (inkl. Instruktion und deren Funktionen), dem Aufbau von Kochanleitungen (inkl. Textprozeduren wie Text- und Satzlänge, Syntax und Fachsprache) und einer Lernaufgabe zum Verfassen einer Kochanleitung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Textsorten werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht hauptsächlich Kochrezepte mit anderen Gebrauchsanweisungen. Es wird die Frage diskutiert, ob Kochrezepte als Gebrauchsanweisungen betrachtet werden können und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden detailliert analysiert.
Welche Aspekte des Schreibprozesses werden untersucht?
Der Schreibprozess instruktiver Texte, insbesondere von Kochanleitungen, wird untersucht. Dabei werden die Appellfunktion (Handlungsanregung) und die Informations- und Darstellungsfunktion (Aufklärung über Handlungsschritte) detailliert beschrieben. Die Anforderungen an den Instruierenden (Schritt-für-Schritt-Anleitung, Selektion relevanter Informationen, geordnete Beschreibung der Schritte) werden am Beispiel des Kuchenbackens verdeutlicht.
Welche sprachlichen Merkmale von Kochrezepten werden analysiert?
Analysiert werden Textlänge, Syntax und Fachsprache von Kochrezepten. Es wird untersucht, wie diese Merkmale zur Klarheit und Verständlichkeit der Anweisungen beitragen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Textsorten, Kochrezepte, Kochanleitungen, Gebrauchsanweisungen, Instruktion, Schreibprozess, Appellfunktion, Informationsfunktion, Textstruktur, Syntax, Fachsprache, Didaktik.
Welche Definitionen von „Textsorte“ werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeit einer präzisen Definition von „Textsorte“ und stellt verschiedene Definitionen, z.B. die von Frohnes, vor. Die Problematik der eindeutigen Kategorisierung von Kochrezepten steht im Vordergrund.
- Quote paper
- Peter Rackl (Author), 2015, Das Kochrezept als Textprozedur. Begriff, Aufbau und Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358983