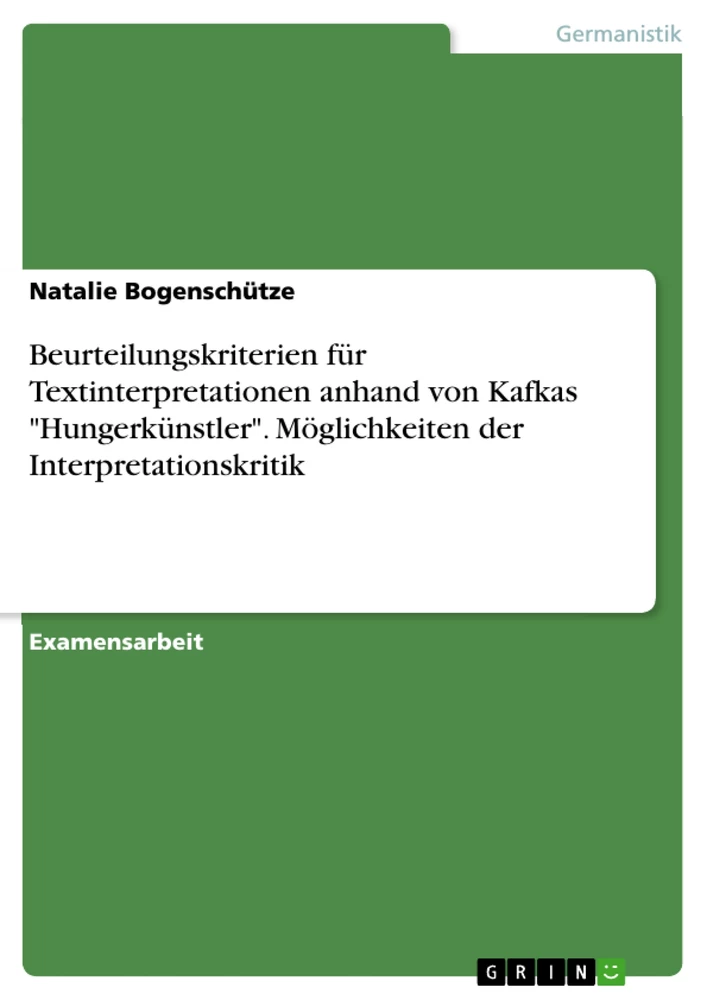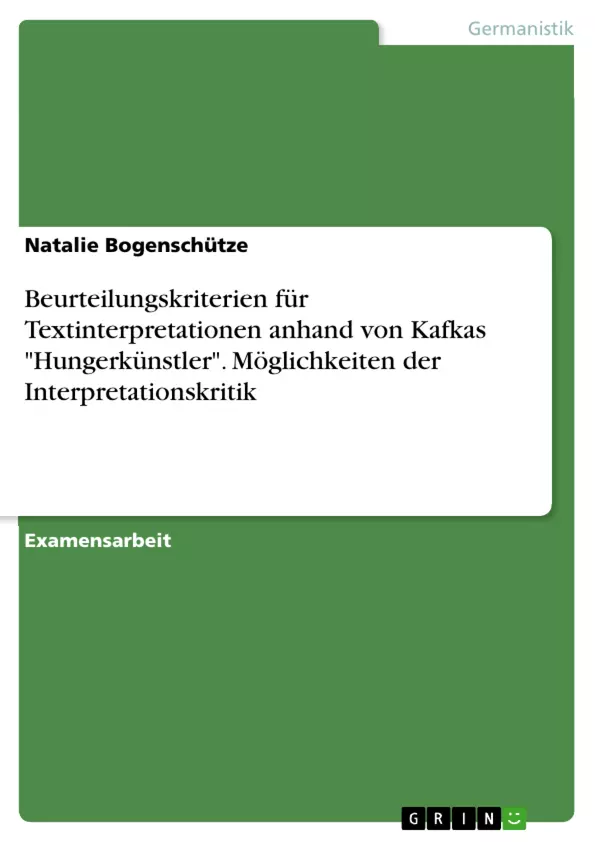Diese Arbeit steht in der Tradition der Analytischen Philosophie der Literaturwissenschaft und ist ein Versuch, Prinzipien für eine "gute Praxis" des Interpretierens zu definieren. Die "Wissenschaftlichkeit" der Literaturwissenschaft hängt entscheidend davon ab, dass sich Kriterien zur Bewertung unterschiedlicher Interpretationen benennen lassen, die idealiter auch definitive Falsifikationskriterien beinhalten.
Im ersten Teil der Arbeit wird in Anlehnung an Konzepte der analytischen Literaturwissenschaft - die rekonstruiert und synthetisiert, aber auch eigenständig korrigiert, reformuliert und ergänzt werden - ein Kriterienkatalog zur Bewertung von Interpretationen entwickelt. Dessen Grundlage ist die Unterscheidung der Sprachhandlungen "Beschreibung", "Auslegung", "Gesamtdeutung" und "Argumentation" sowie die Formulierung von Kriterien für die "geglückte" literaturwissenschaftliche Durchführung dieser Sprachhandlungen.
Im zweiten Hauptteil wird der so gewonnene Kriterienkatalog auf zwei Interpretationen von Kafkas Erzählung "Ein Hungerkünstler" angewendet; Verstöße gegen die festgelegten "Glückensbedingungen" werden aufgezeigt und diskutiert.
Abschließend werden die Ergebnisse der Interpretationsevaluationen genutzt, um den aufgestellten Kriterienkatalog zu überprüfen und zu modifizieren. Die Modifikation führt vor allem zu seiner Stärkung der Kriterien "Differenziertheit" und "Spezifität".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Konzepte und Intentionen der Analytischen Literaturwissenschaft.
- 2. Überlegungen zum Status von Textinterpretationen:
- 2.1 Die literaturwissenschaftliche Beschreibung.
- 2.2 Die Auslegung.
- 2.3 Die Deutung
- 2.4 Die literaturwissenschaftliche Argumentation.
- 2.5 Zusammenfassung.
- 3. Evaluationskriterien der Textinterpretation
- 4. Die Evaluationskriterien in der Praxis
- 4.1 Vorüberlegungen
- 4.2 Modifikationen
- 4.3 Anwendung.
- 4.3.1 Michael Müller: Ein Hungerkünstler
- 4.3.2 R. W. Stallmann: A Hunger-Artist
- 5. Evaluationstheoretische Konsequenzen
- 5.1 Differenziertheit der Begründung
- 5.2 Differenziertheit der Beschreibung
- 5.3 Differenziertheit der Auslegung
- 5.4 Spezifität der Auslegung.
- 5.5 Plausibilität der Deutung.
- Schlussbemerkung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Evaluierung von Textinterpretationen anhand der Kriterien Werner Strubes zu untersuchen. Sie will dabei ergründen, ob diese Kriterien in der Praxis anwendbar und sinnvoll sind und welche Weiterentwicklungen aus der Anwendung auf konkrete Interpretationsbeispiele resultieren.
- Bewertungskriterien für Textinterpretationen
- Analytische Literaturwissenschaft
- Kriteriologische und deskriptive Herangehensweise
- Anwendung auf Kafkas „Ein Hungerkünstler“
- Evaluationstheoretische Konsequenzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik der Interpretationskritik ein und erläutert die theoretischen Grundlagen der Analytischen Literaturwissenschaft.
- Kapitel 1: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Konzepte und Intentionen der Analytischen Literaturwissenschaft dar.
- Kapitel 2: Hier werden Überlegungen zum Status von Textinterpretationen angestellt, insbesondere hinsichtlich der Begriffe "objektiv" und "literaturwissenschaftliche Methoden".
- Kapitel 3: Die Evaluierungskriterien von Textinterpretationen werden vorgestellt, wobei die Erkenntnisse von Werner Strube im Vordergrund stehen.
- Kapitel 4: Die Anwendung der Evaluationskriterien auf konkrete Textinterpretationen wird untersucht, wobei die Reichweite des Modells und die Modifizierung eines Kriteriums im Vordergrund stehen.
- Kapitel 5: Die Ergebnisse der Analyse werden zusammengefasst und die evaluationstheoretischen Konsequenzen werden gezogen.
Schlüsselwörter
Analytische Literaturwissenschaft, Textinterpretation, Bewertungskriterien, Werner Strube, Kriteriologische Herangehensweise, Kafkas „Ein Hungerkünstler“, Evaluationstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der analytischen Literaturwissenschaft?
Sie versucht, Prinzipien für eine "gute Praxis" des Interpretierens zu definieren und Kriterien zur Bewertung unterschiedlicher Interpretationen aufzustellen.
Welche Sprachhandlungen werden bei der Interpretation unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Beschreibung, Auslegung, Gesamtdeutung und Argumentation innerhalb einer literaturwissenschaftlichen Analyse.
Wie wird Kafkas "Hungerkünstler" in der Arbeit genutzt?
Anhand zweier Interpretationen dieser Erzählung (u.a. von Michael Müller) wird ein Kriterienkatalog zur Bewertung von Interpretationsqualität in der Praxis getestet.
Was sind die wichtigsten Evaluationskriterien für Interpretationen?
Zentrale Kriterien sind die Differenziertheit der Begründung, die Spezifität der Auslegung und die Plausibilität der Deutung.
Wer ist Werner Strube im Kontext dieser Arbeit?
Die Arbeit stützt sich maßgeblich auf die von Werner Strube entwickelten Evaluationskriterien für Textinterpretationen.
- Quote paper
- Natalie Bogenschütze (Author), 2007, Beurteilungskriterien für Textinterpretationen anhand von Kafkas "Hungerkünstler". Möglichkeiten der Interpretationskritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359030