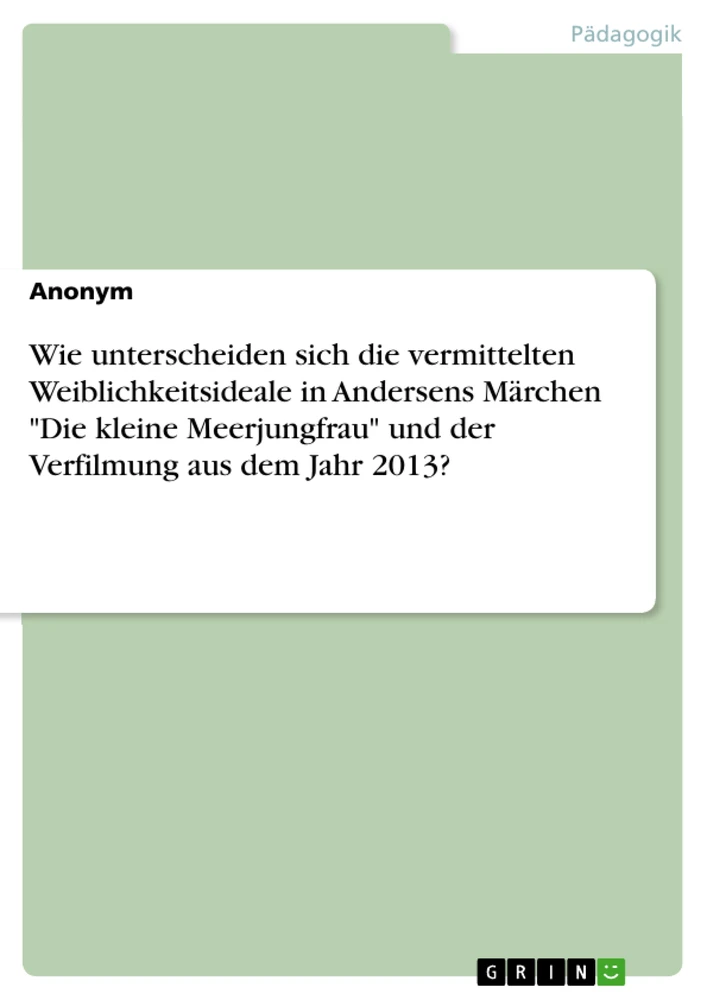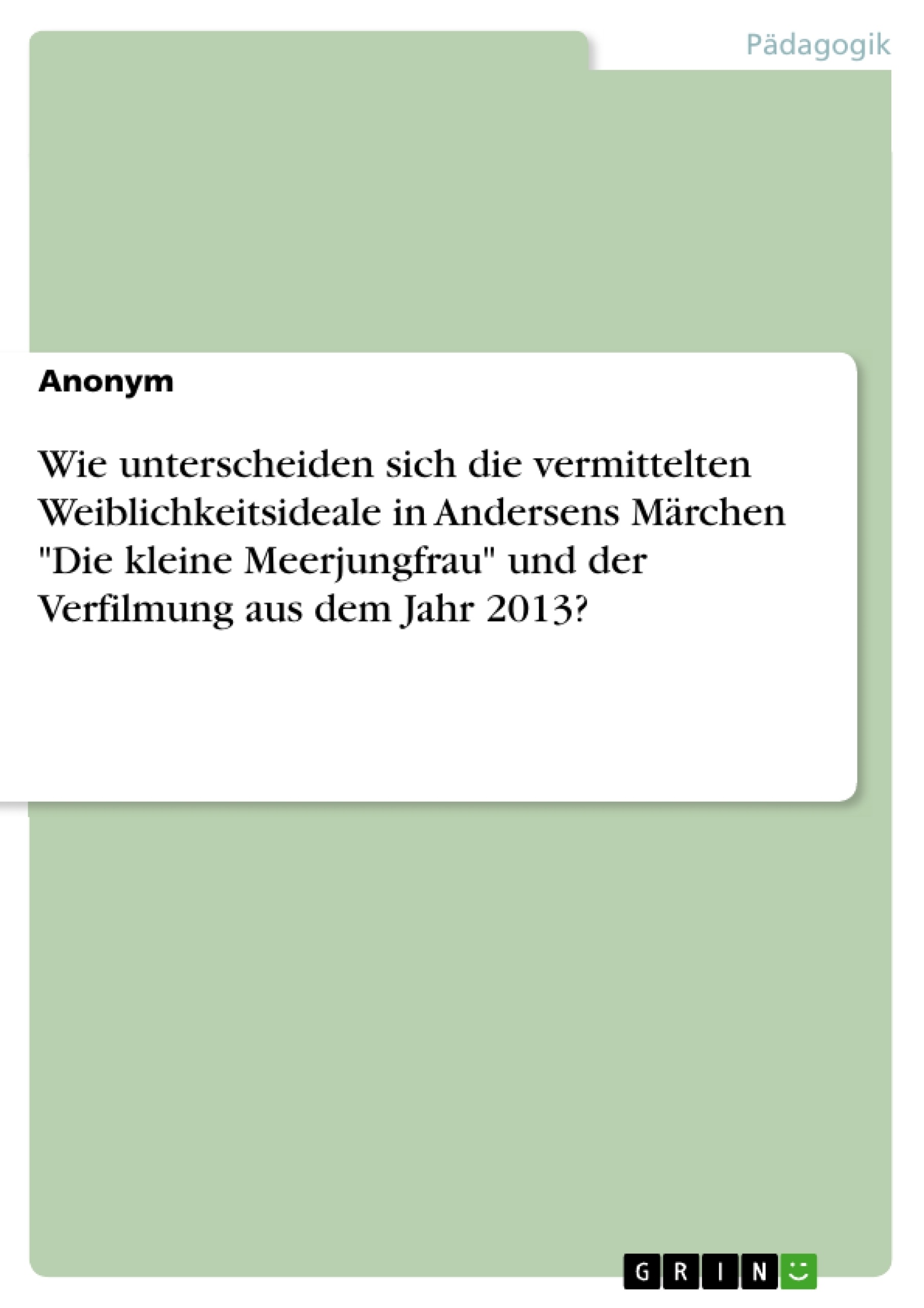Das Kunstmärchen „Die kleine Meerjungfrau“ ist eine der bekanntesten Geschichten über die Welt der Wasserwesen. In meiner Ausarbeitung möchte ich mich mit diesem Märchen und ganz besonders mit dem Weiblichkeitsideal, welches darin vermittelt wird, beschäftigen.
Zunächst gehe ich kurz auf das vorherrschende Frauenbild in der Entstehungszeit des Märchens ein und zeige auf, wie sich dieses Ideal im Märchen und besonders in der Hauptfigur der kleinen Meerjungfrau widerspiegelt. Anschießend vergleiche ich die ARD-Verfilmung aus dem Jahr 2013 im Hinblick auf die Darstellung der Hauptfigur und ihre Vorbildfunktion mit der Märchenvorlage, bevor ich zum Schluss ein Fazit ziehe, in dem es auch um didaktische Möglichkeiten des Märchens und des Films gehen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Andersens Kunstmärchen „Die kleine Seejungfrau“
- Das Frauenbild im frühen 19. Jahrhundert
- Die kleine Meerjungfrau als Weiblichkeitsideal
- Die Verfilmung von 2013
- Die Figur Undine als moderne Variante der kleinen Seejungfrau
- Fazit und didaktischer Ausblick
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung untersucht das Weiblichkeitsideal, das in Andersens Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ und seiner Verfilmung aus dem Jahr 2013 vermittelt wird. Dabei wird ein Vergleich der beiden Werke anhand des Frauenbilds des frühen 19. Jahrhunderts durchgeführt.
- Das Frauenbild des frühen 19. Jahrhunderts
- Die Darstellung des Weiblichkeitsideals in Andersens Märchen
- Der Vergleich mit der Verfilmung aus dem Jahr 2013
- Die Vorbildfunktion der Figuren
- Didaktische Möglichkeiten des Märchens und Films
Zusammenfassung der Kapitel
-
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Faszination des Meeres und die Geschichte der Erzählungen über Wasserwesen. Sie stellt das Kunstmärchen „Die kleine Meerjungfrau“ als Beispiel dieser Erzählungen vor und erläutert den Fokus der Ausarbeitung auf das darin vermittelte Weiblichkeitsideal.
-
Andersens Kunstmärchen „Die kleine Seejungfrau“
Dieses Kapitel gibt eine kurze Zusammenfassung des Märchens und erklärt den historischen Kontext der Entstehungszeit, indem es auf das Frauenbild des frühen 19. Jahrhunderts eingeht.
-
Das Frauenbild im frühen 19. Jahrhundert
Der Abschnitt erläutert die Prägung des Frauenbilds durch die bürgerlichen Wertvorstellungen des 19. Jahrhunderts und die damit einhergehende Betonung von Emotionalität und Unterordnung der Frauen.
-
Die kleine Meerjungfrau als Weiblichkeitsideal
Dieser Abschnitt analysiert die Figur der kleinen Meerjungfrau im Hinblick auf ihre Darstellung und ihre Rolle als Verkörperung des Weiblichkeitsideals der damaligen Zeit.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Ausarbeitung sind: Weiblichkeitsideal, Andersens Märchen, „Die kleine Meerjungfrau“, Frauenbild des 19. Jahrhunderts, Verfilmung, Vorbildfunktion, didaktische Möglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Welches Weiblichkeitsideal vermittelt Andersens "Die kleine Meerjungfrau"?
Es spiegelt das bürgerliche Frauenbild des 19. Jahrhunderts wider, das Emotionalität, Aufopferung und die Unterordnung der Frau unter den Mann betonte.
Wie unterscheidet sich die Verfilmung von 2013 vom Original?
Die Verfilmung präsentiert mit der Figur Undine eine modernere Variante, die stärker als Vorbild für heutige Zuschauer fungieren kann und traditionelle Rollenbilder hinterfragt.
Was war das typische Frauenbild im frühen 19. Jahrhundert?
Frauen wurden primär im privaten Raum verortet; Ideale waren Sanftmut, Geduld und die Fähigkeit, für die Liebe große Schmerzen und Opfer zu ertragen.
Welche Rolle spielt die Seele im Märchen von Andersen?
Die Sehnsucht der Meerjungfrau nach einer unsterblichen Seele ist ein zentrales Motiv, das ihre Handlungen und ihr Streben nach einer höheren Existenzebene antreibt.
Welche didaktischen Möglichkeiten bietet der Vergleich von Film und Buch?
Der Vergleich eignet sich, um mit Schülern über den Wandel von Geschlechterrollen, Vorbildfunktionen und die Anpassung von Literatur an moderne Werte zu diskutieren.
Ist die kleine Meerjungfrau bei Andersen eine emanzipierte Figur?
Aus heutiger Sicht eher nicht, da ihr gesamtes Streben von einem Mann und dem Wunsch nach Anpassung an seine Welt abhängig ist, was dem damaligen Ideal entsprach.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Wie unterscheiden sich die vermittelten Weiblichkeitsideale in Andersens Märchen "Die kleine Meerjungfrau" und der Verfilmung aus dem Jahr 2013?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359071