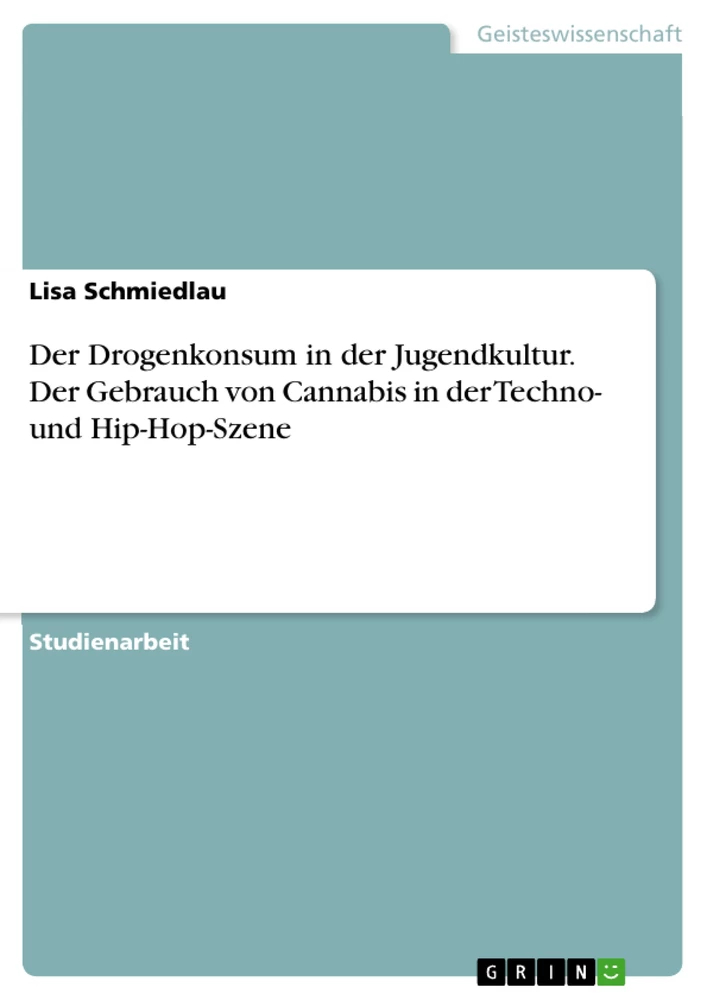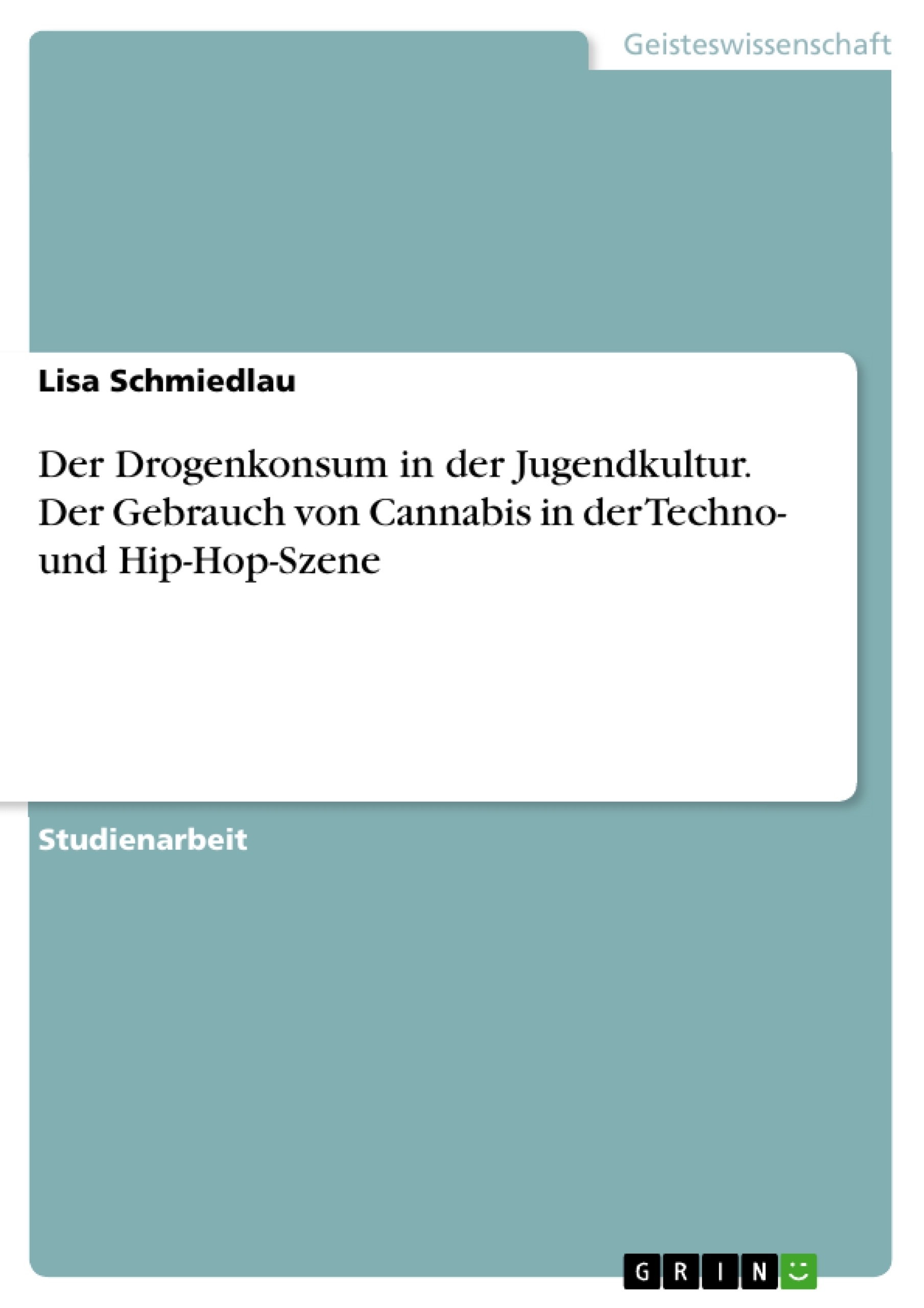Mit dieser Arbeit soll die Frage geklärt werden, welche Bedeutung dem Gebrauch von Cannabis in jugendkulturellen Szenen zukommt. Dabei wird ein Schwerpunkt der Arbeit auf die beiden in Deutschland weit verbreiteten jugendkulturellen Szenen Techno und Hip-Hop gelegt, da mit beiden Szenen häufig eine besondere Affinität zum Cannabisgebrauch assoziiert wird.
In unserer westlichen Gesellschaft existiert eine Vielzahl jugendkultureller Szenen, denen sich Jugendliche zuwenden, um sich auf dem Weg zum Erwachsenwerden von ihrem Elternhaus zu lösen, Gleichgesinnte zu treffen, sich selbst zu finden und Grenzen auszutesten. Vielfach gehört zu dem Austesten der Grenzen der Konsum von illegalen Substanzen (Drogen) in den jugendkulturellen Szenen dazu. Wie groß der Zusammenhang von jugendkulturellen Szenen und Drogen sein kann, zeigte sich zuletzt in der Technoszene, die oft mit der Droge Ecstasy in Verbindung gebracht wird. Eine besondere Stellung in der Thematik des Drogenkonsums in jugendkulturellen Szenen nimmt dabei die weltweit verbreitetste illegale Droge Cannabis ein, welche besonders bei Jugendlichen beliebt ist. Dennoch existiert trotz der Aktualität des Themas nur sehr wenig Fachliteratur, welche sich mit dem Konsum von Drogen in jugendkulturellen Szenen beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugendkulturelle Szenen und ihre Bedeutung
- Drogen: Bedeutung, Verbreitung und Konsumenten
- Cannabis: Historie, Verbreitung, Wirkung und Konsum
- Historie von Cannabis
- Verbreitung in Deutschland und Cannabis als Einstiegsdroge
- Wirkstoff, Konsum, Wirkung und Konsumenten
- Motive und Bedeutungen des Gebrauchs von Cannabis für Jugendliche und jugendkulturelle Szenen
- Bedeutung des Cannabisgebrauchs in der Techno- und Hip-Hop-Szene
- Die jugendkulturelle Technoszene
- Bedeutung des Cannabisgebrauchs in der Technoszene
- Die jugendkulturelle Hip-Hop-Szene
- Bedeutung des Cannabisgebrauchs in der Hip-Hop-Szene
- Vergleich der Bedeutungen von Cannabis in beiden Szenen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Cannabiskonsums in jugendkulturellen Szenen. Der Fokus liegt dabei auf den in Deutschland weit verbreiteten Szenen Techno und Hip-Hop. Die Arbeit untersucht die Motive und Bedeutungen des Cannabiskonsums für die Jugendlichen in diesen Szenen und analysiert den Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Vergemeinschaftung in den jeweiligen Szenen.
- Die Bedeutung von jugendkulturellen Szenen für die Entwicklung von Jugendlichen
- Die Rolle von Drogen im Kontext jugendkultureller Szenen
- Die Geschichte und Verbreitung von Cannabis in Deutschland
- Die Motive und Bedeutungen des Cannabiskonsums in jugendkulturellen Szenen
- Der Vergleich des Cannabiskonsums in der Techno- und Hip-Hop-Szene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Leitfrage der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der "jugendkulturellen Szene" und untersucht die Bedeutung und die Veränderung der Jugendphase in der heutigen Gesellschaft. Kapitel 3 definiert den Begriff "Drogen" und betrachtet die Bedeutung von Drogen für Jugendliche im Allgemeinen. Kapitel 4 widmet sich der illegalen Droge Cannabis und untersucht ihre Geschichte, Verbreitung und Wirkung. Kapitel 5 analysiert die allgemeinen Motive und Bedeutungen des Cannabiskonsums für Jugendliche und jugendkulturelle Szenen. Kapitel 6 untersucht die Bedeutung des Cannabiskonsums in den jugendkulturellen Szenen Techno und Hip-Hop, wobei die Besonderheiten der jeweiligen Szenen und die Motive des Cannabiskonsums innerhalb der Szenen im Mittelpunkt stehen. Abschließend fasst das Fazit die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die Bedeutung des Cannabiskonsums in den jugendkulturellen Szenen Techno und Hip-Hop.
Schlüsselwörter
Jugendkulturelle Szenen, Drogenkonsum, Cannabis, Techno, Hip-Hop, Vergemeinschaftung, Motive, Bedeutungen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Cannabis in der Hip-Hop-Szene?
In der Hip-Hop-Szene dient Cannabis oft als Symbol für Entspannung und Rebellion gegen gesellschaftliche Normen und ist fest in der Szenekultur verankert.
Wie unterscheidet sich der Konsum in der Technoszene?
Während die Technoszene oft mit Ecstasy assoziiert wird, wird Cannabis hier häufig zum "Downkommen" nach langen Partynächten genutzt.
Ist Cannabis eine Einstiegsdroge?
Die Arbeit beleuchtet diese These kritisch. Oft ist nicht die Droge selbst, sondern das soziale Umfeld und die Szenezugehörigkeit entscheidend für den weiteren Konsum.
Warum wenden sich Jugendliche Szenen zu?
Szenen bieten Raum zur Identitätsfindung, Abgrenzung vom Elternhaus und die Möglichkeit, in einer Gruppe von Gleichgesinnten Akzeptanz zu finden.
Welche Wirkung hat Cannabis auf Jugendliche?
Neben Entspannung kann der Wirkstoff THC auch Wahrnehmungsveränderungen hervorrufen, birgt aber Risiken für die psychische Entwicklung in der Wachstumsphase.
- Quote paper
- Lisa Schmiedlau (Author), 2014, Der Drogenkonsum in der Jugendkultur. Der Gebrauch von Cannabis in der Techno- und Hip-Hop-Szene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359110