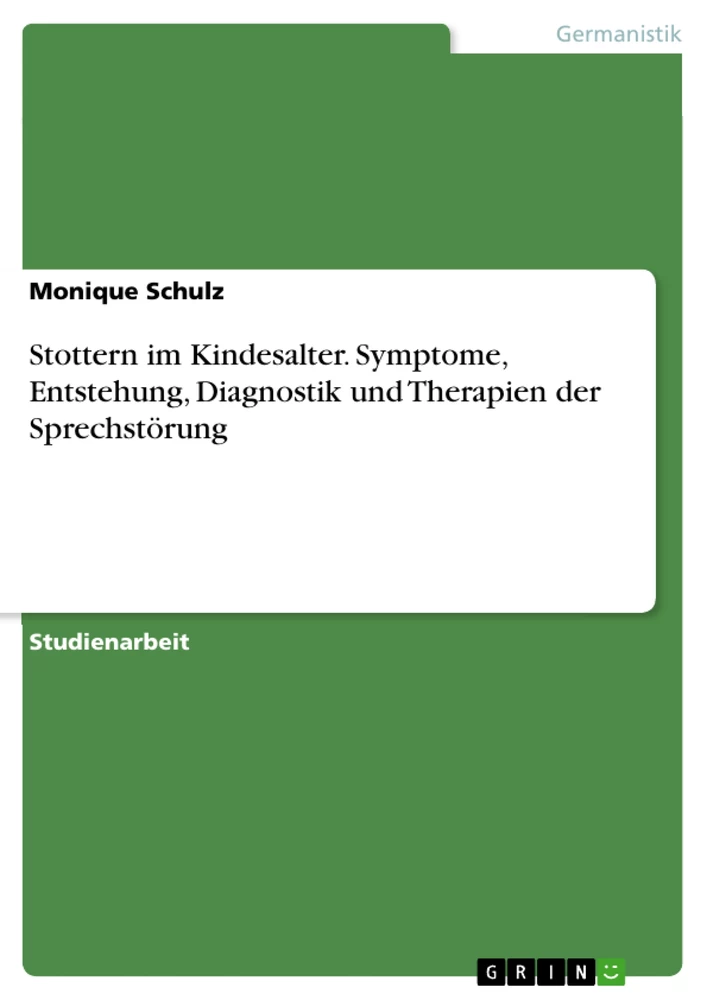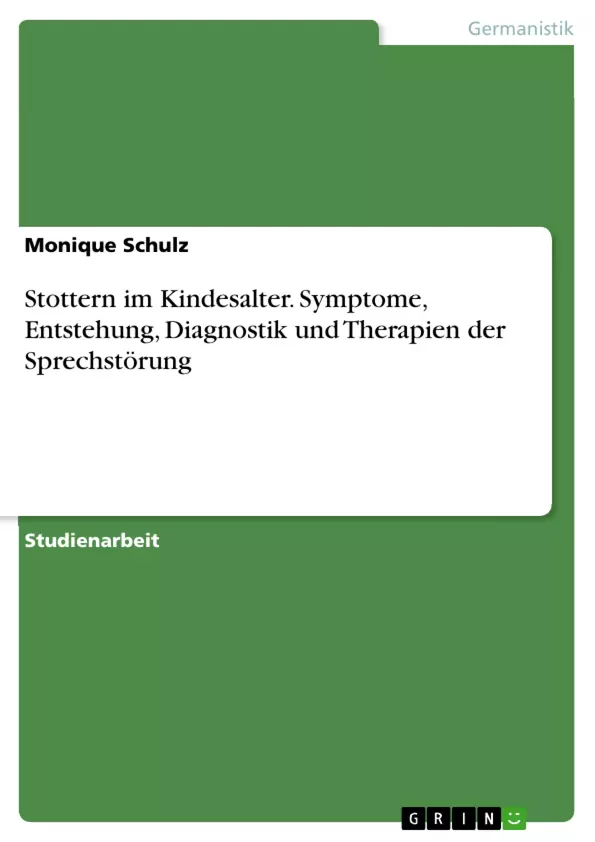In dieser Hausarbeit werden zunächst Sprach- und Sprechstörungen voneinander differenziert und einzelne Sprechstörungen, aber vor allem das Stottern, dargestellt. Im Verlauf der Hausarbeit wird sowohl auf die sprachliche als auch soziale und psychische Entwicklung des Kindes und die Symptome des Stotterns eingegangen. Anschließend werden verschiedene Therapien und Ansätze gegen das Stottern vorgestellt.
Kommunikation aber auch verschiedene Störungen der Kommunikation, wie zum Beispiel Sprach- oder Sprechstörungen, die zwischen Menschen stattfinden, sind in unserer Gesellschaft nicht mehr weg zu denken. Jeden Tag nehmen wir Sprach- oder Sprechstörungen bewusst oder unbewusst wahr und sind oder waren gegebenenfalls von diesen betroffen. Viele dieser Störungen beeinflussen den Charakter des betroffenen Menschen und sein Verhalten, da er sich lediglich darauf begrenzt. Besonders bei der Sprechstörung Stottern ist auffällig, dass die betroffenen Kinder und Erwachsenen sich schämen, kommunikativ sehr eingeschränkt und emotional beeinträchtigt sind. Des Weiteren kann sich die Sprechstörung auf die soziale und psychische Entwicklung des Betroffenen auswirken.
„Ich habe bis heute Vieles in meinem Leben erreicht und auch so manche schwierige Situation gut gemeistert. [...] In meinen jungen Jahren hätte ich nie-mals gedacht, dass ich dies mit meinem Sprachfehler so weit bringen könne.“ Das Zitat von Frank Krüger aus seiner Biographie „Mobbing-Falle Stottern. Habs hinter mir gelassen“ macht deutlich, dass ein Leben mit einer Sprach- oder Sprechstörung nicht ein minderwertigeres Leben bedeuten muss. Aber wie hat Frank Krüger es geschafft, mit seiner Sprechstörung so umzugehen und solch ein Selbstvertrauen aufzubauen? Diese Frage soll als Leitfrage zur Hausarbeit zum Thema Stottern verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprach- und Sprechstörungen im Kindes- und Erwachsenenalter
- 2.1 Lautbildstörungen - Dysarthrie und Sprachapraxie
- 2.2 Redeflussstörungen - Poltern und Stottern
- 3. Stottern im Kindesalter
- 3.1 Sprachliche Entwicklung im Kindesalter
- 3.2 Wann wird ein Kind als Stotterer bezeichnet und wann spricht es unflüssig?
- 4. Symptome des Stotterns
- 4.1 Kern- und Begleitsymptome
- 4.2 Coping-Strategien
- 5. Theorien, Modelle und Ursachen zur Entstehung von Stottern
- 5.1 Johnsons diagnosogene Theorie
- 5.2 Starkweathers Modell von Anforderungen und Fähigkeiten
- 5.3 Ursachenbündel nach Wendlandt
- 6. Stottern und Gesellschaft
- 6.1 Familie
- 6.2 Schule
- 7. Diagnostik
- 8. Therapien und Konzepte
- 8.1 Fluency-Shaping-Therapie
- 8.2 Non-avoidance-Ansatz
- 8.3 Stärker als Stottern (=SAS)
- 9. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Stottern im Kindesalter. Ziel ist es, das Phänomen zu verstehen, seine Symptome zu beschreiben und verschiedene Therapieansätze vorzustellen. Die Arbeit beleuchtet die sprachliche Entwicklung von Kindern, die Kriterien zur Diagnose von Stottern, sowie die sozialen und psychischen Auswirkungen dieser Sprechstörung.
- Sprachliche Entwicklung und Stottern im Kindesalter
- Symptome und Ursachen des Stotterns
- Soziale und psychische Auswirkungen des Stotterns
- Diagnostik von Stottern
- Therapiemöglichkeiten und Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Leitfrage der Arbeit vor: Wie kann man mit einer Sprechstörung wie Stottern ein Leben mit Selbstvertrauen führen? Sie führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Hausarbeit, der sich mit der Differenzierung von Sprach- und Sprechstörungen, dem Stottern im Kindesalter, dessen Symptomen, Theorien, sozialen Auswirkungen, Diagnostik und Therapien befassen wird.
2. Sprach- und Sprechstörungen im Kindes- und Erwachsenenalter: Dieses Kapitel differenziert zwischen Sprach- und Sprechstörungen. Es unterteilt Sprechstörungen im Kindesalter in Lautbildstörungen (Dysarthrie und Sprachapraxie) und Redeflussstörungen (Poltern und Stottern). Die verschiedenen Arten von Stottern (neurogen, psychogen, idiopathisch) werden erläutert, wobei der Fokus auf dem idiopathischen Stottern liegt, da dieses im Kindesalter beginnt. Die Beschreibung der Unterschiede zwischen den Störungsbildern und ihren jeweiligen Ursachen bildet den Kern dieses Kapitels.
3. Stottern im Kindesalter: Dieses Kapitel befasst sich mit der sprachlichen Entwicklung von Kindern und der Frage, wann unflüssiges Sprechen als Stottern diagnostiziert wird. Es legt den Grundstein für das Verständnis der Entwicklung des Stotterns und der Herausforderungen, die mit der frühzeitigen Erkennung und Behandlung dieser Störung verbunden sind. Das Kapitel analysiert den Prozess, der zur Diagnose von Stottern bei Kindern führt und die Komplexität der Unterscheidung zwischen normaler Unflüssigkeit und pathologischem Stottern.
4. Symptome des Stotterns: Hier werden die Kernsymptome und Begleitsymptome des Stotterns detailliert beschrieben, inklusive der Coping-Strategien, die Kinder entwickeln, um mit ihrem Stottern umzugehen. Es wird zwischen klonischem und tonischem Stottern unterschieden, wobei die veraltete Terminologie kritisch betrachtet wird. Die Beschreibung der verschiedenen Ausprägungen des Stotterns und der damit einhergehenden Bewältigungsmechanismen bildet den zentralen Aspekt dieses Kapitels.
5. Theorien, Modelle und Ursachen zur Entstehung von Stottern: In diesem Kapitel werden verschiedene Theorien und Modelle zur Entstehung von Stottern vorgestellt, darunter die diagnosogene Theorie von Johnson, das Modell von Starkweather und das Ursachenbündel nach Wendlandt. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf die Ursachen des Stotterns beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis des komplexen Zusammenspiels von Faktoren zu ermöglichen. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Erklärungsansätze und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen.
6. Stottern und Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss des Stotterns auf die Familie und die Schule des betroffenen Kindes. Es untersucht, wie das Stottern die soziale Integration beeinflusst und welche Herausforderungen sich im familiären und schulischen Kontext ergeben können. Das Kapitel analysiert die verschiedenen sozialen und schulischen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die betroffenen Kinder.
7. Diagnostik: Das Kapitel befasst sich mit den diagnostischen Verfahren, die zur Feststellung von Stottern eingesetzt werden. Es wird die Methodik der Diagnosestellung sowie die Bedeutung einer frühzeitigen und präzisen Diagnose für den Behandlungserfolg beleuchtet. Das Kapitel liefert detaillierte Informationen über den diagnostischen Prozess.
8. Therapien und Konzepte: Dieser Abschnitt stellt verschiedene Therapieansätze vor, darunter die Fluency-Shaping-Therapie, den Non-avoidance-Ansatz und das Konzept „Stärker als Stottern“. Die verschiedenen Therapiemethoden werden detailliert erklärt und ihre jeweilige Wirkungsweise und Anwendung beschrieben. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die verfügbaren Therapiemöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Stottern, Kindesalter, Sprachentwicklung, Sprechstörung, Therapie, Diagnostik, soziale Integration, psychische Auswirkungen, Fluency-Shaping, Non-avoidance, Stärker als Stottern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Stottern im Kindesalter"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht umfassend das Stottern im Kindesalter. Sie beinhaltet eine Einleitung, ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie eine Liste der Schlüsselwörter. Die Arbeit beleuchtet die sprachliche Entwicklung von Kindern, die Kriterien zur Diagnose von Stottern, die sozialen und psychischen Auswirkungen dieser Sprechstörung, verschiedene diagnostische Verfahren und diverse Therapieansätze.
Welche Arten von Sprach- und Sprechstörungen werden behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen Sprach- und Sprechstörungen und konzentriert sich auf Redeflussstörungen, insbesondere das Stottern. Es werden verschiedene Arten von Stottern (neurogen, psychogen, idiopathisch) erläutert, wobei der Schwerpunkt auf dem idiopathischen Stottern liegt, das im Kindesalter beginnt. Zusätzlich werden Lautbildstörungen (Dysarthrie und Sprachapraxie) und Poltern kurz behandelt.
Wann wird unflüssiges Sprechen bei Kindern als Stottern diagnostiziert?
Kapitel 3 befasst sich genau mit dieser Frage. Die Arbeit analysiert den Prozess der Diagnosefindung und die Komplexität der Unterscheidung zwischen normaler Unflüssigkeit und pathologischem Stottern im Kindesalter. Es werden die Kriterien zur Diagnose von Stottern erläutert.
Welche Symptome werden beim Stottern beschrieben?
Kapitel 4 beschreibt detailliert die Kernsymptome und Begleitsymptome des Stotterns, inklusive der Coping-Strategien, die Kinder entwickeln. Es wird zwischen klonischem und tonischem Stottern unterschieden, wobei die veraltete Terminologie kritisch betrachtet wird.
Welche Theorien und Modelle zur Entstehung von Stottern werden vorgestellt?
Kapitel 5 präsentiert verschiedene Theorien und Modelle, darunter die diagnosogene Theorie von Johnson, das Modell von Starkweather und das Ursachenbündel nach Wendlandt. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Erklärungsansätze und deren Stärken und Schwächen.
Wie wirkt sich Stottern auf die Familie und die Schule aus?
Kapitel 6 untersucht den Einfluss des Stotterns auf die soziale Integration des Kindes, sowohl im familiären als auch im schulischen Kontext. Es werden die Herausforderungen im Umgang mit Stottern in diesen Bereichen beleuchtet.
Welche diagnostischen Verfahren werden beschrieben?
Kapitel 7 beschreibt die Methodik der Diagnosestellung von Stottern und betont die Bedeutung einer frühzeitigen und präzisen Diagnose für den Behandlungserfolg.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Kapitel 8 stellt verschiedene Therapieansätze vor, darunter die Fluency-Shaping-Therapie, den Non-avoidance-Ansatz und das Konzept „Stärker als Stottern“. Die jeweiligen Wirkungsweisen und Anwendungen werden detailliert erklärt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Stottern, Kindesalter, Sprachentwicklung, Sprechstörung, Therapie, Diagnostik, soziale Integration, psychische Auswirkungen, Fluency-Shaping, Non-avoidance, Stärker als Stottern.
Welche Leitfrage wird in der Einleitung gestellt?
Die Leitfrage lautet: Wie kann man mit einer Sprechstörung wie Stottern ein Leben mit Selbstvertrauen führen?
- Quote paper
- Monique Schulz (Author), 2015, Stottern im Kindesalter. Symptome, Entstehung, Diagnostik und Therapien der Sprechstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359174