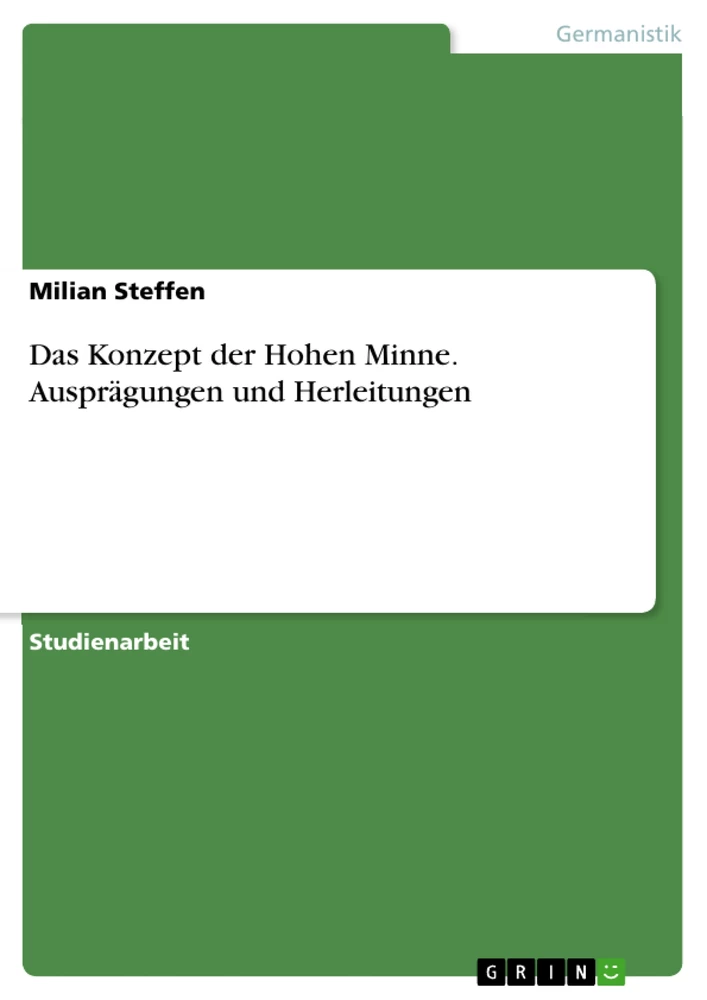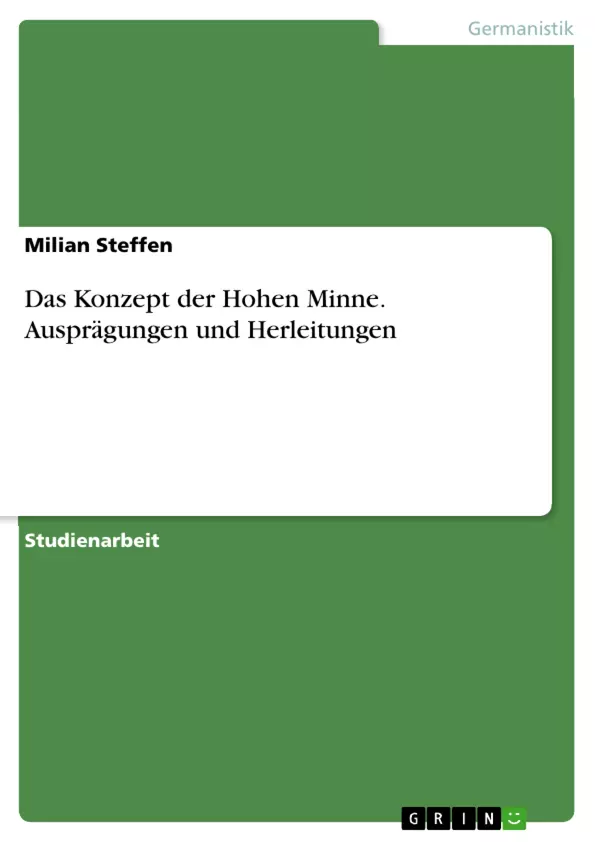Die Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Hohen Minne und setzt sich mit der Hohen Minne in der höfischen Literatur bei Reinmar von Hagenau auseinander.
Der mittelhochdeutsche Ausdruck "minne" kann mit dem heutigen Begriff der Liebe und seiner Bedeutung in etwa gleichgesetzt werden, allerdings ist das Assoziationsfeld heute wie damals sehr vielseitig. Eine Beschreibung, die im Studienbuch von Heinz Sieburg zu finden ist, definiert die Minne unter anderem als „freundliche gedankliche Hinwendung zu einer entfernten Person“ . Es kann aber ebenso „Gottesliebe, Nächstenliebe, Eltern- oder Gattenliebe“ [...] und auch [...] den Akt der sexuellen Vereinigung“ ausdrücken. Die sexuelle Konnotation entstand wohl erst im Spätmittelalter und brachte die Ersetzung von minne durch liebe mit sich, ein Begriff der vorher weniger das Verlangen nach einer Person sondern eher ein Freudegefühl ausdrückte. Über sechs Jahrhunderte später wird in der Romantik der Begriff der minne neu entdeckt und wurde zum spezifischen Ausdruck der höfisch inszenierten Liebe des Mittelalters so wie wir ihn heute kennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zum Begriff der minne
- 2. Der Minnesang im mittelhochdeutschen Zeitalter
- 2.1. Der Donauländische Minnesang
- 2.2. Der Rheinische Minnesang
- 2.3. Der Klassische Minnesang
- 2.4. Der Späte Minnesang
- 3. Das Konzept der Hohen Minne
- 4. Hohe Minne in der höfischen Literatur: Reinmar von Hagenau
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Minne im mittelhochdeutschen Kontext und seiner Darstellung im Minnesang. Ziel ist es, die Entwicklung des Minnesangs von seinen Anfängen bis zum späten Mittelalter nachzuzeichnen und die zentralen Konzepte, insbesondere die Hohe Minne, zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf die formalen und inhaltlichen Aspekte gelegt.
- Der Begriff „Minne“ im mittelhochdeutschen Sprachraum und seine Vielschichtigkeit.
- Die Entwicklung des Minnesangs in verschiedenen Phasen (Donauländisch, Rheinisch, Klassisch, Spät).
- Das Konzept der Hohen Minne und seine literarische Umsetzung.
- Die Rolle der Minnelyrik im höfischen Kontext.
- Der Einfluss französischer Vorbilder auf den deutschen Minnesang.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zum Begriff der minne: Dieser Abschnitt untersucht die vielschichtige Bedeutung des mittelhochdeutschen Begriffs „Minne“. Er wird mit dem modernen Verständnis von Liebe verglichen, wobei die weitaus breitere Palette an Assoziationen im Mittelalter hervorgehoben wird – von freundlicher Hinwendung bis hin zur sexuellen Vereinigung. Der Wandel der Bedeutung im Laufe der Zeit und die spätere Wiederentdeckung des Begriffs in der Romantik werden ebenfalls beleuchtet. Die Ambivalenz des Begriffs wird anhand von Beispielen aus der Literatur verdeutlicht, die sowohl die Freude als auch den Schmerz der Liebe widerspiegeln. Die Minne wird als ein komplexes Konzept vorgestellt, das in der Praxis oft unerreichbar bleibt und zur Inszenierung in der höfischen Lyrik führte.
2. Der Minnesang im mittelhochdeutschen Zeitalter: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Minnesang im mittelhochdeutschen Zeitalter. Es beschreibt die Entstehung und Entwicklung dieser literarischen Gattung, die stark von französischen Einflüssen geprägt ist. Die Gliederung in vier Phasen (Donauländisch, Rheinisch, Klassisch, Spät) ermöglicht eine detaillierte Betrachtung der jeweiligen Besonderheiten hinsichtlich Raum, Zeit, Form und Inhalt. Der Minnesang wird als ein spezifisch höfisches Phänomen dargestellt, das sich deutlich vom Sang- und Sprechspruch der nicht-adligen Spielleute unterscheidet. Die Frage nach der Vortragsweise und der musikalischen Begleitung wird ebenfalls angeschnitten.
2.1 Der Donauländische Minnesang: Die erste Phase des Minnesangs, datiert um 1150 bis 1170/80, ist im bairisch-österreichischen Raum angesiedelt. Charakteristisch sind die Langzeilenstrophe und die dialogische Liedform mit wechselseitigem Vortragen von Mann und Frau. Inhaltlich ähnelt er späteren Ausprägungen, beispielsweise in der Form des Tagelieds, welches den Abschied der Liebenden bei Tagesanbruch nach einer gemeinsamen Nacht beschreibt. Die Akteure sind ständisch festgelegt als Ritter und Dame, mit einem Wächter als zusätzliche Figur. Die Darstellung der Liebe ist hier noch vergleichsweise natürlich und ungekünstelt. Leider existieren nur wenige urkundliche Belege für die Autoren dieser Frühphase.
2.2 Der Rheinische Minnesang: Die zweite Phase, gegen Ende des 12. Jahrhunderts, verlagert sich ins Rheinland und an den Hof des staufischen Adels. Formal orientiert er sich stärker an französischen Vorbildern, erkennbar an der Stollenstrophe und den Kurzzeilen. Inhaltlich verbindet er die Gefühlswelt des Protagonisten mit der Kreuzzugsthematik, was zu einem Spannungsfeld zwischen Liebe und religiöser Pflicht führt. Friedrich von Hausen, der erste urkundlich belegte Dichter des mittelhochdeutschen Minnesangs, wird als wichtiger Vertreter dieser Phase genannt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelhochdeutscher Minnesang
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit behandelt den Begriff der Minne im mittelhochdeutschen Kontext und dessen Darstellung im Minnesang. Sie verfolgt die Entwicklung des Minnesangs vom Beginn bis ins späte Mittelalter und beleuchtet zentrale Konzepte, insbesondere die Hohe Minne, unter Berücksichtigung formaler und inhaltlicher Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Vielschichtigkeit des Begriffs „Minne“, die Entwicklung des Minnesangs in verschiedenen Phasen (Donauländisch, Rheinisch, Klassisch, Spät), das Konzept der Hohen Minne und seine literarische Umsetzung, die Rolle der Minnelyrik im höfischen Kontext und den Einfluss französischer Vorbilder.
Welche Phasen des Minnesangs werden unterschieden?
Die Arbeit gliedert den Minnesang in vier Phasen: den Donauländischen, den Rheinischen, den Klassischen und den Späten Minnesang. Jede Phase wird hinsichtlich Raum, Zeit, Form und Inhalt detailliert beschrieben.
Was ist der Donauländische Minnesang?
Der Donauländische Minnesang (ca. 1150-1170/80) ist im bairisch-österreichischen Raum angesiedelt. Charakteristisch sind die Langzeilenstrophe und die dialogische Liedform. Die Liebe wird vergleichsweise natürlich und ungekünstelt dargestellt. Es existieren jedoch nur wenige urkundliche Belege für die Autoren dieser Frühphase.
Was ist der Rheinische Minnesang?
Der Rheinische Minnesang (gegen Ende des 12. Jahrhunderts) verlagert sich ins Rheinland und an den Hof des staufischen Adels. Er orientiert sich stärker an französischen Vorbildern (Stollenstrophe, Kurzzeilen) und verbindet die Gefühlswelt des Protagonisten mit der Kreuzzugsthematik.
Was ist die Hohe Minne?
Das Konzept der Hohen Minne wird in der Arbeit ausführlich behandelt. Es wird ihre literarische Umsetzung und ihre Rolle im höfischen Kontext beleuchtet. Die Arbeit beschreibt die Hohe Minne als ein komplexes Konzept, oft unerreichbar in der Praxis und zur Inszenierung in der höfischen Lyrik genutzt.
Welche Bedeutung hat der Begriff "Minne"?
Die Arbeit untersucht die vielschichtige Bedeutung des mittelhochdeutschen Begriffs „Minne“, vergleicht ihn mit dem modernen Verständnis von Liebe und hebt die breitere Palette an Assoziationen im Mittelalter hervor – von freundlicher Hinwendung bis zur sexuellen Vereinigung. Der Wandel der Bedeutung im Laufe der Zeit und die spätere Wiederentdeckung in der Romantik werden ebenfalls beleuchtet.
Wer sind wichtige Vertreter des Minnesangs?
Die Arbeit nennt Friedrich von Hausen als wichtigen Vertreter des Rheinischen Minnesangs, den ersten urkundlich belegten Dichter des mittelhochdeutschen Minnesangs. Weitere Autoren werden implizit durch die Beschreibung der verschiedenen Phasen des Minnesangs erwähnt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis (implizit durch die behandelten Themen).
- Citation du texte
- Milian Steffen (Auteur), 2017, Das Konzept der Hohen Minne. Ausprägungen und Herleitungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359200