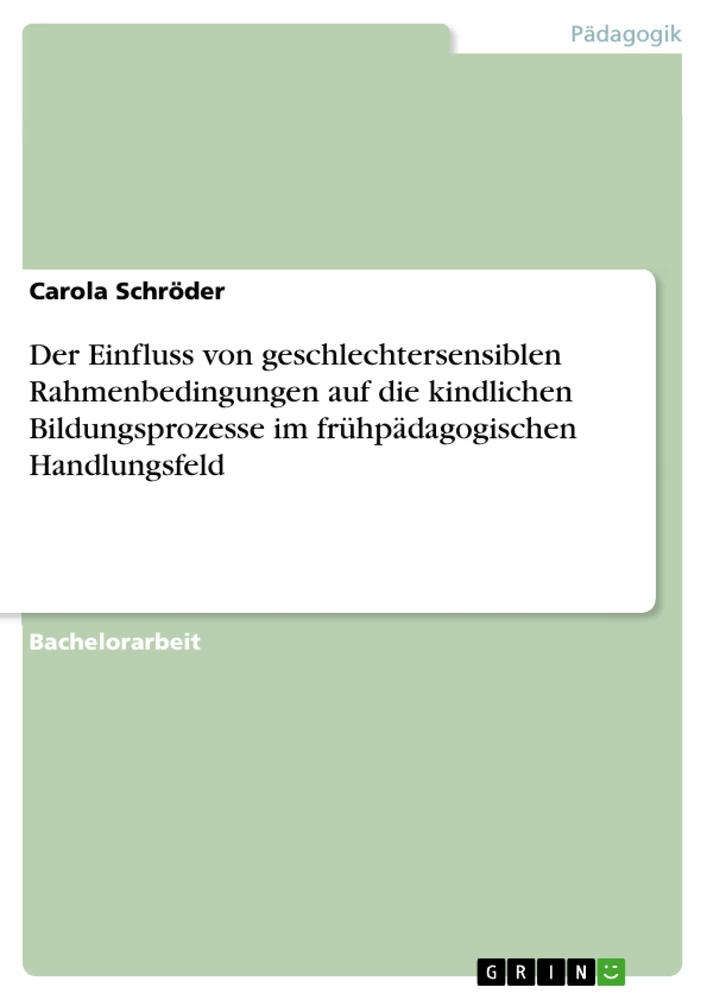Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Forschungsfrage zu beantworten, ob Geschlecht und geschlechtersensible Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die kindlichen Bildungsprozesse und die Fähigkeiten und Kompetenzen haben und falls ja, wie hoch dieser Einfluss ist und welche Rahmenbedingungen im Elementarbereich am günstigsten für Kinder sind.
Nachdem im ersten Kapitel einige Begrifflichkeiten geklärt werden, geht es im dritten Kapitel um die hirnbiologischen, evolutionstheoretischen und die entwicklungspsychologischen Grundlagen im Kontext der sozialen Konstruktion von Geschlechterrollen. Ein besonderes Augenmerk soll in Kapitel vier auf die performativen Sprechakte gelegt werden, welche zur Geschlechterrollenfindung besonders beitragen.
In Kapitel fünf werden die Inhalte der Bildungsbereiche behandelt, die so oder in ähnlicher Weise in allen Bundesländern niedergeschrieben sind und einen Rahmenplan für die Arbeit im Elementarbereich bieten. Gegenstand ist hier jeweils eine kurze Zusammenfassung der allgemeinen Zielstellungen des Bildungsbereichs, eine Zusammenfassung von erkenntnisreichen Studien, die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten von Mädchen und Jungen in diesem Bereich aufweisen und einer Überprüfung, ob und welche Bildungspläne auf diese Unterschiede eingehen. Frauen und Männer in Kindertageseinrichtungen werden in Kapitel sechs beleuchtet, ehe in Kapitel sieben ein Resümee der Ergebnisse dieser Arbeit und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen vor dem Hintergrund des politisch geforderten Gender Mainstreaming folgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 BEGRIFFLICHKEITEN
- 2.1 Gender, Geschlecht, Stereotypen - Im Urwald der Begriffe
- 2.2 Bildungsprozesse
- 3 BIOLOGISCHE, PSYCHOLOGISCHE UND SOZIOLOGISCHE GRUNDLAGEN, VORAUSSETZUNGEN UND UNTERSCHIEDE BEI MÄDCHEN UND JUNGEN
- 3.1 Die Gehirnentwicklung von Mädchen und Jungen
- 3.1.1 Das Gehirn
- 3.1.2 Gehirnbedingte Fähigkeiten
- 3.1.3 Gehirnbedingtes Sozialverhalten
- 3.1.4 Hormonelle Beeinflussung des Gehirns
- 3.1.5 Erfahrungsbedingte und genetische Beeinflussung des Gehirns
- 3.2 Evolutionstheoretische Erklärungsansätze für geschlechtertypisches Verhalten
- 3.2.1 Geschlechtertypische anlagebedingte Disposition
- 3.3 Entwicklungspsychologische Perspektive auf geschlechterunterschiedliches Verhalten - Pränatale Phase und frühe Kindheit
- 3.3.1 Psychologische Theorien der Entwicklung zum Mädchen und Jungen
- 4 PERFORMATIVITÄT
- 4.1 Grundlagen der performativen Sprechakttheorie
- 4.2 Performativität und performative Sprechakte und ihr Einfluss auf die Geschlechteridentität
- 4.3 Performativität in Kindertageseinrichtungen
- 5 BILDUNGSBEREICHE IM KONTEXT DER FRÜHPÄDAGOGISCHEN UND GESCHLECHTERBEWUSSTEN ARBEIT
- 5.1 Bewegung
- 5.2 Körper, Gesundheit und Ernährung
- 5.3 Sprache und Kommunikation
- 5.4 Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung
- 5.5 Musisch-ästhetische Bildung
- 5.6 Religion und Ethik
- 5.7 Mathematische Bildung
- 5.8 Naturwissenschaftlich-technische Bildung
- 5.9 Ökologische Bildung
- 5.10 Medien
- 6 DIE FACHKRÄFTE
- 6.1 Frauen in Kindertageseinrichtungen
- 6.2 Männer in Kindertageseinrichtungen
- 6.3 Die Bedeutung des Geschlechts der pädagogischen Fachkräfte für die Entwicklung der Kinder und die Arbeit in Kindertageseinrichtungen
- 7 RESÜMEE
- 7.1 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie geschlechtersensible Rahmenbedingungen Einfluss auf die Bildungsprozesse von Kindern im frühpädagogischen Handlungsfeld haben. Die Arbeit untersucht, welche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen existieren, wie diese Unterschiede entstehen und wie pädagogische Fachkräfte damit umgehen sollten.
- Die Bedeutung von Gender, Geschlecht und Stereotypen im frühpädagogischen Kontext
- Die biologischen, psychologischen und soziologischen Grundlagen von geschlechtertypischem Verhalten
- Der Einfluss von Performativität auf die Geschlechteridentität von Kindern
- Die Bedeutung geschlechterbewusster Arbeit in verschiedenen Bildungsbereichen
- Die Rolle von pädagogischen Fachkräften in der Gestaltung geschlechtergerechter Bildungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Hypothese der Arbeit vor. Kapitel 2 definiert die Begriffe Gender, Geschlecht und Stereotypen und erläutert die Bedeutung von Bildungsprozessen im frühpädagogischen Kontext. Kapitel 3 behandelt die biologischen, psychologischen und soziologischen Grundlagen von geschlechtertypischem Verhalten. Dabei werden die Gehirnentwicklung, evolutionstheoretische Erklärungsansätze und entwicklungspsychologische Theorien beleuchtet. Kapitel 4 fokussiert auf die Performativität und deren Einfluss auf die Geschlechteridentität von Kindern, insbesondere im Kontext von Kindertageseinrichtungen. Kapitel 5 analysiert verschiedene Bildungsbereiche im Hinblick auf geschlechterbewusste Arbeit. In Kapitel 6 werden die Rolle und Bedeutung von pädagogischen Fachkräften, insbesondere von Frauen und Männern, im frühpädagogischen Handlungsfeld diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Gender, Geschlecht, Stereotype, Bildungsprozesse, Performativität, geschlechtersensible Rahmenbedingungen, frühpädagogisches Handlungsfeld, Kindertageseinrichtungen, pädagogische Fachkräfte und geschlechtergerechte Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet geschlechtersensible Pädagogik im Kindergarten?
Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kindern Bildungsprozesse unabhängig von starren Geschlechterstereotypen ermöglichen.
Gibt es biologische Unterschiede im Gehirn von Mädchen und Jungen?
Die Arbeit beleuchtet hirnbiologische Grundlagen und hormonelle Einflüsse, betont aber auch die enorme Bedeutung der sozialen Konstruktion von Geschlecht.
Was sind "performative Sprechakte" in der Erziehung?
Sprechakte, die durch Benennung und Erwartungshaltung die Geschlechterrollenidentität von Kindern aktiv mitformen und verfestigen.
Welchen Einfluss hat das Geschlecht der pädagogischen Fachkräfte?
Die Präsenz von Männern und Frauen in Kitas ist wichtig, um vielfältige Rollenvorbilder zu bieten und einseitige Gender-Zuschreibungen aufzubrechen.
Wie greifen Bildungspläne das Thema Geschlecht auf?
Die Arbeit prüft, ob Bildungsbereiche wie Sprache, Bewegung oder Technik geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigen oder Stereotype ungewollt fördern.
- Quote paper
- Carola Schröder (Author), 2015, Der Einfluss von geschlechtersensiblen Rahmenbedingungen auf die kindlichen Bildungsprozesse im frühpädagogischen Handlungsfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359224