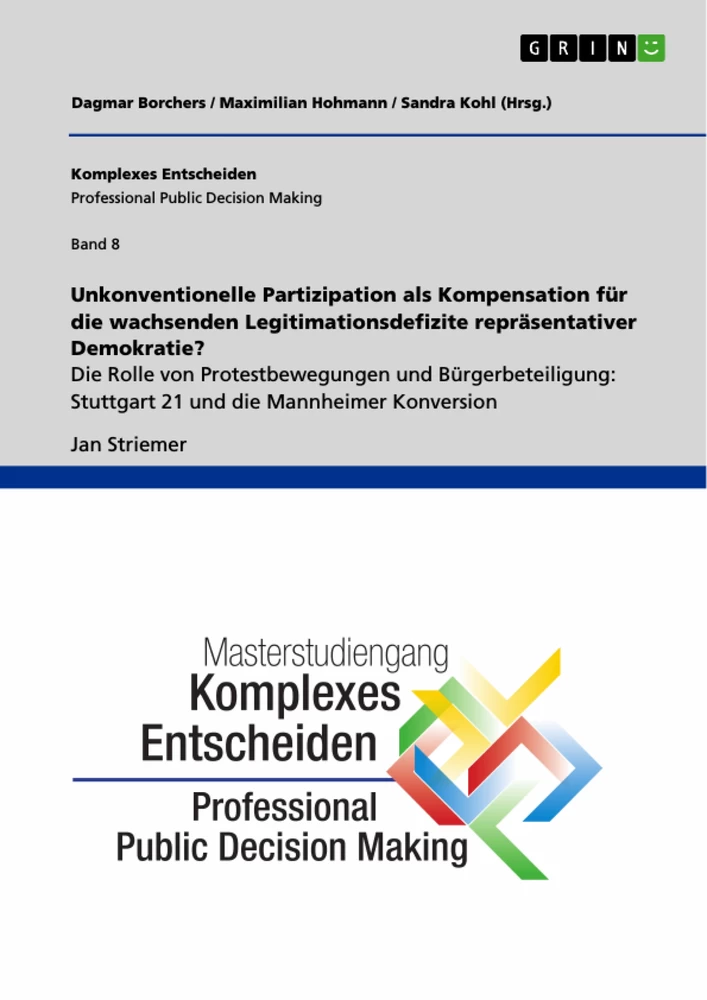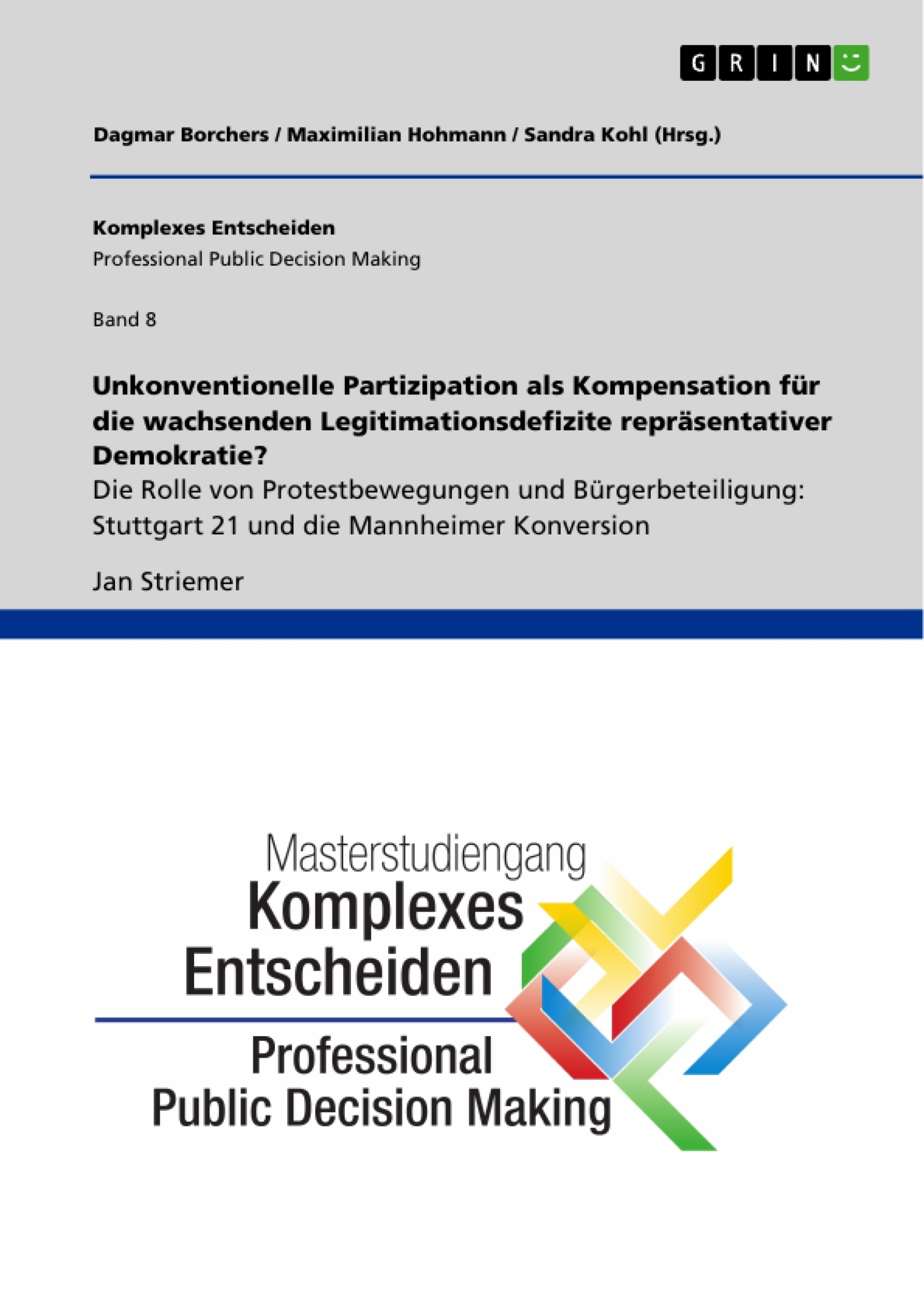Vor dem Hintergrund der wachsenden Legitimationsdefizite der repräsentativen Demokratie fragt die Masterarbeit nach den Demokratisierungspotenzialen unkonventioneller politischer Partizipation im Bereich der Stadtentwicklung. Immer häufiger stellen Großprojekte deutschlandweit nämlich den Ausgangspunkt für Proteste und teilweise heftig geführte öffentliche Kontroversen dar. Und immer häufiger, so scheint es, wollen Bürger mitreden, mitentscheiden und sich einbringen, wenn in öffentlichen Entscheidungsprozessen über die Gestaltung ihres unmittelbaren urbanen Lebensumfeldes verhandelt wird. Aber wie sollen Politiker und Beamte auf diesen gestiegenen Partizipationsanspruch im Bereich der Stadtentwicklung reagieren?
Mit den Fallbeispielen Stuttgart 21 und der Mannheimer Konversion werden in der Masterarbeit zwei Stadtentwicklungsprojekte vorgestellt, in Bezug auf die der Umgang der politisch Verantwortlichen mit der Zivilgesellschaft völlig gegensätzlich war. Während man in Stuttgart einen reinen Top-Down-Ansatz wählte und sich gegenüber den Projektgegnern weder kommunikations- noch verhandlungsbereit zeigte, wurden die Bürger in Mannheim von Anfang an und nachhaltig in die politische Gestaltung des Konversionsprozesses miteinbezogen und durften ihre Teilprojekte auf den freiwerdenden Flächen verwirklichen. Der Vergleich zeigt eindeutig: Frühzeitige und umfassende Ansätze der öffentlichen Bürgerbeteiligung können, wie in Mannheim geschehen, dabei helfen, die Identifikation mit und die Akzeptanz von Stadtentwicklungsprojekten innerhalb der Bevölkerung zu steigern und dabei auch Vertrauen und Sympathien zwischen Bürgern und Repräsentanten (wieder-)herzustellen.
Diese und weitere Ergebnisse der Masterarbeit haben wichtige demokratietheoretische Implikationen: Das pragmatische Demokratiemodell von Jane Mansbridge ist am besten in der Lage, die Partizipationsbeispiele in Stuttgart und Mannheim empirisch und normativ angemessen zu erklären, wogegen das deliberative Demokratiemodell von Jürgen Habermas und das agonistische Demokratiemodell von Chantal Mouffe beide unübersehbare Mängel aufweisen. Vor allem das Vier-Phasen-Modell von Mansbridge liefert einen zukunftsweisenden Erklärungsansatz, weil damit ein Weg aufgezeigt wird, wie die verschiedenen politischen Akteure trotz ihrer unterschiedlichen Meinungen und Interessen schrittweise zu integrierten Lösungen, Kompromissen oder zumindest zu einer fairen Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip gelangen können.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Die wechselseitige Bedingtheit zwischen Demokratie und Partizipation
1.1 Politische Partizipation und ihre verschiedenen Erscheinungsformen
1.2 Konventionelle und unkonventionelle Partizipation als Gegensatzpaar
2 Die Rolle unkonventioneller Partizipation aus drei Perspektiven der gegenwärtigen Demokratietheorie im Vergleich
2.1 Argumentation, Kommunikatives Handeln und rationaler Konsens als Leitmotive des deliberativen Demokratiemodells von Jürgen Habermas
2.2 Diskurs, Konflikt und Hegemonie als Leitmotive des agonistischen Demokratiemodells von Chantal Mouffe
2.3 Deliberation, Verhandlung und Entscheidungsfindung als Leitmotive des pragmatischen Demokratiemodells von Jane Mansbridge
3 Unkonventionelle Beteiligung für eine selbstbestimmte städtische Zukunft? Über die Potenziale und Risiken von mehr Demokratie in der Stadtentwicklung
3.1 Der Versuch einer chronologischen Darstellung der Auseinandersetzung um das verkehrspolitische und städtebauliche Großprojekt „Stuttgart 21“
3.1.1 Erste Phase: Die Entwicklung, Durchsetzung und Finanzierung des Großbauprojektes Stuttgart 21 als politischer Alleingang zwischen Bahn, Bund, Land und Stadt
3.1.2 Zweite Phase: Der zivilgesellschaftliche Protest gegen das Großbauprojekt Stuttgart 21 und zugunsten einer selbstbestimmten städtischen Zukunft
3.1.3 Dritte Phase: Die Scheinlösung des Konfliktes um Stuttgart 21 durch das sogenannte Schlichtungsverfahren unter der Leitung von Heiner Geißler
3.1.4 Vierte Phase: Die Landtagswahl und die Volksabstimmung über das Stuttgart 21-Kündigungsgesetz im Jahr 2011 als vorläufiger Schlusspunkt der Auseinandersetzung
3.2 Mehr Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung – eine kritische Bestandsaufnahme
3.2.1 Kritik an der konventionellen Bürgerbeteiligung nach dem Baugesetzbuch und Anforderungen dialogorientierter Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung
3.2.2 Konversion in Mannheim – Bürger in der Rolle als Stadtplaner und ‑entwickler
4 Eine Bewertung der drei Demokratieverständnisse unter Berücksichtigung der dargestellten unkonventionellen Partizipationsbeispiele in der Stadtentwicklung
Fazit
Literaturverzeichnis
Vorwort
Im Rahmen der Schriftenreihe „Komplexes Entscheiden (Professional Public Decision Making)“ werden herausragende Seminar- und Abschlussarbeiten von Studentinnen und Studenten sowie Absolventinnen und Absolventen des gleichnamigen Masterstudienganges der Universität Bremen veröffentlicht. Während des Studiums werden einschlägige Theorien, Konzepte und Entscheidungsmodelle aus Philosophie, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft sowie Rechtswissenschaft analysiert und diskutiert. Die interdisziplinäre Entscheidungsforschung steht dabei im Mittelpunkt des Studiengangprofils.
Die ausgewählten Arbeiten befassen sich mit komplexen Entscheidungen im Spannungsfeld von politischen Opportunismen, administrativen Postulaten, wirtschaftlichem Effizienzstreben und rechtlichen Rahmenbedingungen. Aufgrund der inhaltlichen und methodischen Vielschichtigkeit von öffentlichen Entscheidungsprozessen werden gleichermaßen philosophische, ökonomische, politik-, und rechtswissenschaftliche Problemanalysen, Lösungskonzepte und Umsetzungsstrategien untersucht.
Herausgegeben von:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
Obwohl die liberalen Demokratien der OECD-Mitgliedsländer heutzutage formal völlig intakt sind und relativ hohe Werte der Freiheitlichkeit in den internationalen Rankings von Freedom House[1] erzielen, scheint sich innerhalb der Bevölkerung vielerorts eine gewisse Politikskepsis und Demokratiemüdigkeit verbreitet zu haben. Auch im politikwissenschaftlichen Diskurs wird die substanzielle Qualität und demokratische Legitimität der öffentlichen Entscheidungsprozesse in den heutigen repräsentativen Demokratien zunehmend in Zweifel gezogen. Auch wenn die verschiedenen Krisendiagnosen häufig problematische normative Implikationen in sich tragen und an vielen Stellen überzogen wirken, treffen sie mit ihrer Kritik an den wachsenden Legitimationsdefiziten in den liberalen Demokratien [2] doch ein Kernproblem der heutigen Zeit. Dies gilt im Übrigen auch für das von der Finanz- und Weltwirtschaftskrise seit 2007 vergleichsweise wenig belastete Deutschland: Die Wahlbeteiligung geht auf allen Ebenen des Föderalsystems seit Jahren zurück, die Parteien und Gewerkschaften erleben einen enormen Mitgliederschwund und viele Menschen fühlen sich in ihren Bedürfnissen, Meinungen und Interessen nicht mehr angemessen von den Parteien und Politikern[3] vertreten. Ob die angesprochene Distanz zwischen politischem Betrieb und den Bürgern an der zunehmenden Verlagerung der vormals parlamentarischen Angelegenheiten auf die supranationale Ebene oder in Expertengremien, der fehlenden Glaubwürdigkeit von Politikern gegenüber ihren eigens formulierten Zielen und Ansprüchen oder an der fehlenden gemeinsamen Sprache zwischen beiden Seiten fest zu machen ist, sei einmal dahingestellt. Fakt ist, dass eine erhebliche Abnahme der politischen Partizipation allgemein und insbesondere unter den sozial schlechter gestellten Bevölkerungsteilen zu beobachten ist. Das egalitäre Projekt der Demokratie zugunsten einer politischen und sozialen Gleichheit aller Mitbürger scheint – war es auch immer bloß ein utopisches und nie vollständig zu erreichendes Ideal – auch in Deutschland immer stärker in den Hintergrund zu geraten. Gleichzeitig haben durch den allmählichen Rückzug des Staates aus vielen Regelungsbereichen der Sozialpolitik und Daseinsvorsorge private Unternehmen, Investoren und Interessenverbände erhöhte Chancen, ihre Absichten erfolgreich in die öffentlichen Entscheidungsprozesse einzuspeisen und die vormals staatlichen Aufgaben zum Teil sogar zu übernehmen. Die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft, welche durch eine wachsende politische Apathie der sozial Schwachen und Benachteiligten begleitet wird, stellt langfristig eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland dar. Doch was kann die beschriebene Problematik abschwächen, aufhalten oder gar umkehren? Wie kann die repräsentative Demokratie im Wortsinn wieder stärker eine Herrschaft des Volkes über sich selbst werden?[4] Wie können öffentliche Entscheidungsprozesse durch die politische Partizipation der Bürger wieder mehr beeinflusst, (mit-)gestaltet und damit auch demokratisiert werden?
Anlass zur Hoffnung bietet in dieser Hinsicht ein Blick auf die lokale Ebene bzw. auf die Kommunal- und Stadtpolitik. Im Politikfeld der Stadtentwicklung erheben nämlich immer mehr Bürger den Anspruch, an den Entscheidungsprozessen über die Zukunft ihres urbanen Lebensumfeldes mitwirken und mitentscheiden zu dürfen. Fühlen sich die Stadtbewohner in Bezug auf Großbauprojekte und die langfristige Stadtplanung von der Politik aber ignoriert oder hintergangen, passiert es immer häufiger, dass sie sich innerhalb eines breiten politischen Netzwerks zum Dauerprotest und zivilen Ungehorsam mobilisieren. Eines der prominentesten Beispiele hierfür stellt der Protest gegen das Großbauprojekt „Stuttgart 21“ dar: In diesem Fall taten sich von 2007 bis 2010 viele Initiativen und Einzelpersonen zu einer Protestbewegung zusammen, um sich gegen das bereits beschlossene Bauvorhaben aufzulehnen und für eine selbstbestimmte städtische Zukunft einzutreten. Obwohl sie den Bau damit letztlich nicht mehr verhindern konnten, waren die Ergebnisse ihrer unkonventionellen politischen Beteiligung beachtlich. Auf den spürbar gestiegenen politischen Partizipationsanspruch in der Bevölkerung hat die Kommunalpolitik mit einer Fülle von Beteiligungsangeboten reagiert: Bürgerausstellungen, Stadtteilforen, Zukunftskonferenzen, Perspektivwerkstätten, runde Tische, Mediation, Bürgerhaushalte, Referenden uvm. erweitern das Spektrum unkonventioneller politischer Partizipation und sollen zu einer neuen Beteiligungskultur beitragen. Vor zu viel Optimismus in Bezug auf die Potenziale der bereits existierenden Beteiligungsverfahren muss jedoch gewarnt werden; schließlich wird das Politikfeld der Stadtentwicklung heute noch weitgehend von den Zielvorstellungen und Interessen einzelner Städteplaner, politischer Eliten und privater Unternehmen dominiert. Es bleibt daher kritisch zu fragen: Tragen die Verfahren wirklich zu mehr Teilnahme und Teilhabe an den stadtentwicklungspolitischen Entscheidungsprozessen bei oder handelt es sich dabei um Scheinbeteiligung als Mittel zur besseren Rechtfertigung des politischen Kurses der Regierung? Und stellt Bürgerbeteiligung für zivilgesellschaftliche Akteure damit eine echte Alternative gegenüber der Methode des kollektiven Protestes dar? Gegenüber kollektivem Protest verspricht die erfolgreiche Suche nach ernst gemeinten und wirksamen Beteiligungsangeboten einen wichtigen Vorteil: Die Legitimität und damit auch die Planungssicherheit von städtebaulichen Maßnahmen und Stadtentwicklungskonzepten ließe sich bereits im Vorfeld erheblich steigern, womit eine Win-Win-Situation für alle beteiligten Akteure der Stadtentwicklung ermöglicht wäre. In diesem Sinne lautet die zweiteilige Hauptfragestellung dieser Masterarbeit: Wie kann die Rolle von Protestbewegungen und Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtentwicklung angemessen beschrieben werden? Und inwiefern können beide Formen der unkonventionellen Partizipation somit zur Kompensation der wachsenden Legitimationsdefizite in der repräsentativen Demokratie beitragen?
Zur Bearbeitung der Fragestellung ist die Masterarbeit wie folgt aufgebaut: Im ersten Teil der Masterarbeit wird zunächst eine weitgehend wertneutrale Definition für den Begriff der politischen Partizipation (1.1) vorgeschlagen. Hiernach erfolgt eine Begriffsdifferenzierung zwischen konventioneller und unkonventioneller politischer Partizipation, wobei das besondere Augenmerk auf die Unterbegriffe Protestbewegung und Bürgerbeteiligung gerichtet sein wird (1.2). Im zweiten Teil der Arbeit werden drei Beiträge der gegenwärtigen Demokratietheorie in Bezug auf ihr Rollenverständnis der unkonventionellen Partizipation im Kontext repräsentativer Demokratie befragt. Hierfür sollen, in Anlehnung an das deliberative Demokratiemodell von Jürgen Habermas (2.1), an das agonistische Demokratiemodell von Chantal Mouffe (2.2) und an das pragmatische Demokratiemodell von Jane Mansbridge (2.3), drei verschiedene Perspektiven der Demokratietheorie dargestellt und miteinander verglichen werden. Im dritten, empirischen Teil der Masterarbeit werden konkrete Fälle der unkonventionellen Partizipation bzw. des kollektiven Protests und der Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtentwicklung untersucht und teilweise auch miteinander verglichen. Hierbei wird erst der Versuch einer chronologischen Darstellung der Auseinandersetzung um das Bauprojekt „Stuttgart 21“ unternommen (3.1). Das gut dokumentierte, politische Ereignis wird dabei ausführlich in vier Phasen dargestellt, weil sich daran zeigen lässt, welche Symptome die wachsenden Legitimationsdefizite repräsentativer Demokratie auch auf Ebene der Kommunalpolitik zeigen (Stichwort: Top-down-Politik). Aber die Stuttgart 21-Proteste sind ein Beispiel dafür, wie auf eine autoritäre Stadtentwicklungspolitik der politisch Verantwortlichen auf Seiten der Einwohner reagiert werden kann und welche beachtlichen (Teil-)Erfolge dadurch erzielt werden können. Im Anschluss wird der unübersehbare Trend zugunsten mehr Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung untersucht (3.2). Hierzu soll zuerst die konventionelle Bürgerbeteiligung im Rahmen des formellen Bebauungsplanverfahrens problematisiert und den qualitativen Anforderungen dialogorientierter Beteiligung im Bereich der Stadtentwicklung nachgegangen werden (3.2.1). Danach wird die Konversion in Mannheim und damit auch der frühzeitige und umfassende Beteiligungsansatz in den Blick genommen, der von den Politikern und der Verwaltung vor Ort initiiert und bis heute fortgeführt wurde (3.2.2). Im Diskussionsteil (4) werden das Erklärungsvermögen und die Implikationen der verschiedenen Demokratietheorien von Habermas, Mouffe und Mansbridge an den empirischen Fallbeispielen aus dem Bereich der Stadtentwicklung diskutiert. Die drei zentralen Hypothesen der Arbeit lauten in diesem Zusammenhang: These 1: Das deliberative Modell von Habermas ist nicht dazu geeignet, um die Rolle unkonventioneller Partizipation im Bereich der Stadtentwicklung angemessen zu beschreiben. These 2: Das agonistische Demokratiemodell von Mouffe ist ebenfalls nicht dazu geeignet, um die Rolle unkonventioneller Partizipation im Bereich der Stadtentwicklung angemessen zu beschreiben. These 3: Das pragmatische Modell von Mansbridge ist am besten dazu geeignet, um die Rolle unkonventioneller Partizipation im Bereich der Stadtentwicklung angemessen zu beschreiben. Das Fazit fasst alle Ergebnisse zusammen und bietet auch Raum, um eventuell noch offen gebliebene Fragen der Masterarbeit anzusprechen.
1 Die wechselseitige Bedingtheit zwischen Demokratie und Partizipation
Ohne Partizipation kann eine Demokratie keinen Bestand haben oder – anders gesagt – „citizen partiticipation is at the heart of democracy“ (Verba et al. 1995: 129). Gleichzeitig ist es einzig und allein die Staatsform der Demokratie, welche ihrem egalitären Anspruch nach allen Bürgern die gleichen Möglichkeiten zur Partizipation bietet: „Wer Demokratie sagt, meint Partizipation“ (Deth 2009: 141). Daher ist es nicht verwunderlich, dass Partizipation neben Freiheit und Gleichheit „einen Schlüsselbegriff politikwissenschaftlicher Theorie wie politischer Praxis“ darstellt (Hoecker 2006: 3). Aufgrund der angesprochenen wechselseitigen Bedingtheit zwischen Demokratie und Partizipation besteht innerhalb der Partizipationsdebatte weitgehend Konsens darüber, dass „das Recht auf politische Partizipation“ (Hoecker 2006: 6) und „ein minimales Niveau politischer Partizipation“ für „die Lebensfähigkeit einer Demokratie“ notwendig sind (Deth 2009: 141). Die zentralen Streitfragen beziehen sich erstens auf die Begriffsdefinition politischer Partizipation, zweitens auf die Formen und Reichweite der Beteiligung, sowie drittens auf die damit verbundenen Zwecke (Hoecker 2006: 3).
Wie Hacker (2001: 66) in seinem Beitrag „Verstehen wollen“ erklärt, ist es in der Philosophie „unerlässlich“ zuerst einen „Überblick über ein Begriffsgebiet oder einen Teil des Gebietes“ zu verschaffen, bevor man zu einer „Lösung oder Auflösung eines philosophischen Problems“ überhaupt vordringen kann. Entsprechend ist zunächst danach zu fragen, wie die zentralen Begriffe politische Partizipation, konventionelle/unkonventionelle Partizipation, Protestbewegung und Bürgerbeteiligung zu verstehen sind, bevor die Rolle der darunterfallenden Handlungen in der repräsentativen Demokratie mit Bezug auf die gegenwärtige Demokratietheorie ausführlich behandelt wird. Der Anspruch, begriffliche Klarheit über die genannten Termini zu gewinnen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies stets nur unvollständig gelingen kann, weil die Begriffe jeweils selbst ein Terrain der politischen Auseinandersetzung darstellen und zudem einem ständigen Gebrauchswandel unterzogen sind.[5] Mit den folgenden Definitionen ist demnach ausdrücklich kein Allgemeingültigkeitsanspruch verbunden.
Der Begriff Partizipation leitet sich aus dem Lateinischen von „participatio“ ab und lässt sich als „Beteiligung im Sinn sowohl von Teilnahme als auch Teilhabe“ übersetzen (Schultze 1995: 396). Partizipieren bedeutet also, auf bestimmte Art und Weise an einem Ganzen teilzuhaben. Nach der Definition gesellschaftlicher Partizipation von Schubert/Klein (2011) bezeichnet der Begriff „die aktive Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen bei der Erledigung der gemeinsamen (politischen) Angelegenheiten bzw. der Mitglieder einer Organisation, einer Gruppe, eines Vereins etc. an den gemeinsamen Angelegenheiten“. Diese Minimaldefinition ist wenig hilfreich, weil sie zu weit gefasst und unpräzise formuliert ist. Wenn von der Beteiligung an Unterschriftensammlungen über die Mitgliedschaft im Hundeverein bis zur Partyorganisation unter Studenten alles als Partizipation gelten soll, ist damit fast jede soziale Tätigkeit gleichzeitig auch als gesellschaftliche Teilhabe zu interpretieren. Zudem ist unklar, was mit der Erledigung gemeinsamer Angelegenheiten gemeint ist: Genügt es schon an den Angeboten eines Sportvereins teilzunehmen bzw. dem Demonstrationsaufruf eines politischen Netzwerks zu folgen oder ist die Mitentscheidung und Umsetzung gemeinsamer Beschlüsse in den genannten Gruppen notwendig? Oder bezieht sich die Erledigung gemeinsamer Angelegenheiten auf ein nicht näher definiertes, gesamtgesellschaftliches Interesse? Aber worin sollte dieses Gemeinwohl in modernen Gesellschaften liegen? Das Beispiel zeigt, dass es in diesem Kapitel notwendig sein wird, politische Partizipation von sozialer Partizipation abzugrenzen und zu ermitteln, was ihren politischen Charakter eigentlich ausmacht.
1.1 Politische Partizipation und ihre verschiedenen Erscheinungsformen
Im Rahmen dieser Arbeit werden „solche Handlungen“ als politische Partizipation verstanden, „die Bürger einzeln oder gemeinsam mit anderen und freiwillig mit dem Ziel vornehmen, Entscheidungen auf den unterschiedlichen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen und/oder selbst zu treffen“ (Holtmann 2015: 64). Erstens sind demnach „Menschen in ihrer Rolle als Bürger“ die Protagonisten politischer Partizipation, wobei ihr Bürgerstatus nicht unbedingt an eine bestimmte Staatsbürgerschaft gebunden sein muss (Deth 2009: 143). Politische Partizipation erfordert zweitens eine „Tätigkeit“, womit das Anschauen von Fernseh-Talk-Runden oder bloßes Interesse an Politik bereits ausgeschlossen sind (Deth 2009: 143). Drittens sollte politische Partizipation in dem Sinne „freiwillig“ sein, dass sie nicht in irgendeiner Form von staatlicher Seite angeordnet wird (Deth 2009: 143). Die Definition erlaubt insofern eine Abgrenzung zu sozialer Partizipation, als dass damit „politische Teilhabe an der Entscheidungsfindung“ und nicht etwa „Beteiligung im Rahmen der Implementation“ von bereits getroffenen Entscheidungen gemeint ist, die auch als „bürgerschaftliches Engagement“ bezeichnet wird (Kersting/Woyke 2012: 20). Ehrenamtliche Tätigkeiten, „die bei begrenzter staatlicher Fremdhilfe auf der Basis eigenen Engagements gemeinwohlorientiert und nicht primär individuell ausgerichtet sind“ und ein wichtiges Fundament der Vereinsarbeit, der Nachbarschafts- und Entwicklungshilfe sowie der sozialen Arbeit darstellen, sind damit eindeutig von politischer Partizipation abzugrenzen (Kersting/Woyke 2012: 21). Aber welche Formen der politischen Partizipation sind mit der Definition angesprochen? Um diese Frage zu beantworten, bezieht sich die Arbeit im Folgenden auf die Typologie von Kersting (2015: 50–53). Ihrzufolge „findet politische Partizipation im Spannungsfeld zwischen einem invited space und einem invented space statt“ (Kersting 2015: 51). Beteiligungsformen im invited space sind solche, die den Beteiligten „von oben“ eingeräumt werden, d.h. sie sind „von staatlichen Institutionen geplant und geben dem Bürger Partizipationsinstrumente an die Hand“ (Kersting 2015: 51). Beteiligungsformen im invented space sind dagegen solche, die „von unten, d.h. aus der Bevölkerung heraus entwickelt werden und hierüber eine höhere Autonomie und eine geringere Regulierung bzw. Formalisierung besitzen“ (Kersting 2015: 51). Nach Kersting sind die vier Formen der repräsentativen, direkten, deliberativen und demonstrativen Beteiligung voneinander abzugrenzen, da ihnen jeweils verschiedene Handlungslogiken zugrunde liegen und sie eine je unterschiedliche Position im angesprochenen Spannungsfeld zwischen Autonomie und staatlicher Kontrolle einnehmen (siehe Abbildung 1, auf der nächsten Seite).
Abbildung 1: Politische Beteiligung zwischen invented space und invited space
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Darstellung wurde mit Änderungen von Norbert Kersting übernommen (siehe 2015: 52).
Nach Kersting (2015: 52) ist repräsentative Beteiligung dadurch charakterisiert, dass sie „wahlzentriert“ und dabei an „Personen, Parteien oder Ämtern orientiert“ ist. Außerdem bewegt sie sich, wie im Schaubild 1 zu erkennen, eindeutig im invited space und unterliegt damit „einer stärkeren Kontrolle und Durchdringung durch staatliche Stellen“ (Kersting 2015: 51). Zu den Instrumenten repräsentativer Beteiligung zählen die freien und gleichen Wahlen auf den unterschiedlichen Ebenen des politischen Systems, das Kontaktieren von Politikern, die Mitgliedschaft und Mitarbeit in den Parteien sowie die Ausführung eines oder mehrerer politischer Mandate (Kersting 2015: 52). Auch Onlineinstrumente gewinnen an Bedeutung: Damit sind z.B. Online-Wahlen angesprochen, die aufgrund technischer Anfälligkeiten, ihrem Missbrauchspotenzial und wahlrechtlicher Bedenken aber umstritten sind (Buchstein/Neymanns 2002). Zudem stellt der direkte Kontakt mit Politikern über „Politiker-Chats“ oder „elektronische Bürgersprechstunden“ im Internet eine Erneuerung dar (Nanz/Fritsche 2012: 91–92).
Direkte Beteiligung ist auch wahlzentriert, aber sie ist im Unterschied zu repräsentativer Beteiligung nicht auf die Auswahl eines politisch verantwortlichen Personals, sondern auf die Abstimmung über konkrete Themen und Sachfragen, gerichtet. „Direktdemokratische Teilhabe (...) wird in Form von Referenden und Initiativen genutzt und kann als stark reguliertes Beteiligungsverfahren bindende Entscheidungen herbeiführen“ (Kersting 2015: 52–53). Nach der Definition von Thurich (2011) ist ein Referendum als „eine Volksabstimmung über ein Gesetz, das von einem Parlament ausgearbeitet oder bereits beschlossen worden ist und das nachträglich bestätigt oder abgelehnt werden kann“, zu verstehen. Während konfirmative Referenden von staatlicher Seite (Regierung oder Parlament) genutzt werden, um die Bestätigung der Bevölkerung für einen Gesetzesentwurf einzuholen, stellen fakultative Referenden eine Möglichkeit dar, mittels derer Bürger bereits beschlossene Gesetze zur Abstimmung stellen können, insofern es ihnen gelingt, genug Stimmen von Wahlberechtigten dafür zu sammeln. Obligatorische Referenden werden nur durchgeführt, wenn dies die Rechtsordnung bei Gesetzesänderungen zwingend vorsieht, die gleichzeitig eine Verfassungsänderung darstellen. In der Bundesrepublik sind obligatorische Referenden in Bayern und Hessen bei Änderungen der Landesverfassung und nach Art. 29 GG bei der Neugliederung des Bundesgebiets durch Zusammenschluss zweier oder mehrere Bundesländer gefordert (Thurich 2011). Direkte Demokratie kann auch über Volksinitiativen oder Bürgerbegehren realisiert werden, die einen Volksentscheid bewirken können. Der Unterschied zum Referendum liegt beim Volksentscheid darin, dass „die Initiative und die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes nicht vom Parlament kommt, sondern aus der Mitte des Volkes“ (Thurich 2011). Auch Bürgerhaushalte können ein Instrument direkter Demokratie sein, da sie „auf konkrete Sachentscheidungen zielen“ (Roth 2011: 177).[6] Einerseits stellen sie ein radikales Instrument dar, „weil sie in das Allerheiligste der repräsentativen Demokratie, das Budgetrecht der Parlamente, eindringen“, andererseits sind sie ein pragmatisches Instrument, „denn sie bewegen sich in einem zumeist engen Korridor der vorhandenen öffentlichen Mittel“ (Roth 2011: 176).[7] In deutschen Kommunen werden Bürgerhaushalte meist in konsultativer Form mit oder ohne Rechenschaftspflicht für die Politiker durchgeführt, weshalb sie hier nicht in den Bereich direkter Demokratie hineinreichen (Statusbericht Bürgerhaushalte 2015). Zu nennen wären an dieser Stelle noch Onlineverfahren, wie z.B. „Online-Petitionen, Online-Referenden“ und „elektronische Bürgerhaushalte, die z.T. kaum dialogorientierte Komponenten haben“ (Kersting 2015: 53).
Deliberative Beteiligung hat unter dem Label der Bürgerbeteiligung in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung in der politischen Theorie und Praxis erlebt (Nanz/Fritsche 2012: 9). Deliberative Beteiligungsverfahren sind „nicht wahl- sondern gesprächszentriert“ (Kersting 2015: 53). In ihnen sollen gemeinsame Positionen und Meinungen über den Dialog der Teilnehmenden miteinander ermittelt werden.[8] Die Leitidee dabei ist, dass „freie und gleiche Personen“ durch den Austausch von Argumenten zu einem rationalen Konsens oder durch faire Verhandlung zu akzeptablen Lösungen in Bezug auf politische Themen gelangen (Kersting 2015: 53). In Bezug auf deliberative Beteiligung bleibt festzuhalten, dass es ein kaum noch zu überblickendes Feld an verschiedenen dialogorientierten Verfahren gibt. Entsprechend werden im Handbuch für Bürgerbeteiligung von Nanz/Fritsche (2012) insgesamt 17 Verfahren wie z.B. „Bürgerpanel“, „Charette“ „Deliberative Polling“, „World Café“ oder „Zukunftswerkstatt“ vorgestellt. Gerade für dialogorientierte Verfahren nehmen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien einen wichtigen Stellenwert ein. Unter Stichwörtern wie „E-Partizipation“ (Nanz/Fritsche 2012: 88–106) oder „E-democracy“ (Smith 2009) werden die Besonderheiten und Demokratisierungspotenziale von Onlineverfahren gegenüber Präsenzveranstaltungen diskutiert. Zu differenzieren sind Beteiligungsverfahren, die ausschließlich im virtuellen Raum stattfinden, wie z.B. die unabhängigen oder von der Regierung finanzierten Diskussionsforen (Smith 2009: 147–153), und Verfahren, in denen Face-to-Face-Kommunikation in Kleingruppen mit computergestützter Diskussion und Entscheidungsfindung im Internet kombiniert werden, wie z.B. bei den „21st Century Town Meetings“ (Nanz/Fritsche 2012: 36–39; Smith 2009: 144–147). Schaubild 1 zeigt, dass die Formen der direkten und deliberativen Beteiligung beide eine Mittelposition zwischen invented und invited space einnehmen, weil die Initiative für die Beteiligung hier sowohl vom Staat als auch von den Bürgern ausgehen kann. Deshalb bleibt in Bezug auf konkrete Fälle der direkten und der deliberativen Partizipation stets zu hinterfragen, von welcher Seite die Initiative tatsächlich ausgeht und welche konkreten Zwecke mit dem Engagement verfolgt werden.
Demonstrative Beteiligung umfasst alle möglichen Formen des politischen Protests. Hierunter fällt die Teilnahme an genehmigten Demonstrationen, an Streiks, die Mitarbeit in einer Bürgerinitiative, das Unterschriften sammeln und auch verschiedene Formen des zivilen Ungehorsams, wie z.B. die Teilnahme an verbotenen Demonstrationen, Hausbesetzungen oder Blockaden (Hoecker 2006: 11). Demonstrative Beteiligung bewegt sich, wie das Schaubild 1 zeigt, eindeutig im invented space, d.h. sie gilt als klassische politische Teilhabe von unten und damit als Gradmesser für das Bestreben nach politischer Selbstbestimmung in einer Gesellschaft. Partizipation ist in dem Bereich nicht primär auf den Ausgang politischer Wahlen bzw. Abstimmungen oder auf deliberative Kommunikation ausgerichtet. Vielmehr übernimmt Beteiligung hier eine „expressive Funktion“, wobei in dem Zusammenhang „die Konstruktion einer Identität eine zentrale Rolle spielt“ (Kersting 2015: 53).[9] Die weltweit zu beobachtende Inflation von Protestbewegungen im 21. Jahrhundert scheint durch den technologischen Fortschritt des Internets begünstigt zu sein, der es den Aktivisten erlaubt dem Zugriff des Staates weitgehend entzogen auf lokaler und globaler Ebene gleichzeitig zu agieren und dadurch auch neue soziale Bewegungen anderswo zu inspirieren (Castells 2012). Zwar wird Protest immer häufiger Online mobilisiert und findet stellenweise sogar im virtuellen Raum des Internets statt, aber die neuen Formen der Online-Mobilisierung und des politisch motivierten Online-Aktivismus werden den „einen höheren Einsatz verlangenden Offline-Protest“ langfristig betrachtet nicht ersetzen (Rucht 2014: 127).
Nach dem hier entwickelten Begriffsverständnis ist politische Partizipation also auf die Beeinflussung der politischen Entscheidungsträger bzw. auf mehr aktive und direkte Mitsprache an der politischen Entscheidungsfindung gerichtet. Demzufolge fallen Handlungen, die dem bürgerschaftlichen Engagement zugeordnet werden können, nicht unter den Begriff. Das gewählte Begriffsverständnis verhält sich gleich in zweierlei Hinsicht normativ neutral: Erstens wurden die vier Beteiligungsformen zwar in das Spannungsfeld zwischen Autonomie und staatlicher Kontrolle eingeordnet; allerdings ist damit noch keine Bewertung darüber vorgenommen, welche Beteiligungsform in welcher Situation geeignet bzw. ungeeignet ist. Dabei müssen sich repräsentative, direkte, deliberative und demonstrative Beteiligung nicht konkurrierend gegenüberstehen, sondern können sich im Gegenteil durchaus wechselseitig ergänzen. Zweitens kommt das Begriffsverständnis ohne Werturteile und Vorwegannahmen aus, die das Rollenverständnis von politischer Partizipation in der repräsentativen Demokratie betreffen. Fragen, die darauf abzielen, werden zunächst noch ausgeklammert.[10]
1.2 Konventionelle und unkonventionelle Partizipation als Gegensatzpaar
Zur Einordnung verschiedener Formen politischer Partizipation werden in der Literatur häufig Gegensatzpaare wie konventionell-unkonventionell, verfasst-unverfasst, legal-illegal, individuell-kollektiv uvm. verwendet (Kersting/Woyke 2012: 20).[11] Von besonderem Interesse im Rahmen dieser Arbeit ist das Gegensatzpaar konventionell-unkonventionell, weil es eine Grenzziehung zwischen den repräsentativen Beteiligungsformen einerseits und den direkten, deliberativen und demonstrativen Formen andererseits erlaubt (vgl. Teil 1.1). Zur Differenzierung zwischen konventioneller und unkonventioneller politischer Partizipation sind nach der Literatur a) die Nähe zu den repräsentativen Institutionen, b) der Grad der Verfasstheit, c) der Grad der öffentlichen Anerkennung und d) die gesellschaftliche Verbreitung der jeweiligen Partizipationsform entscheidend (Hadjar/Becker 2007: 102; Hoecker 2006: 10). Als unkonventionelle Partizipation werden demnach „jene Formen politischer Beteiligung verstanden, die im Sinne unverfasster (...) Beteiligungsformen, spontan oder geplant in relativer Distanz zu parteibezogenen politischen Institutionen entstehen“ (Hadjar/Becker 2007: 102). Unkonventionelle Partizipation stellt insofern ein Mittel zur „institutionell nicht verfassten unmittelbaren Einflussnahme auf den politischen Prozess“ dar, während konventionelle Partizipation „auf institutionalisierte Elemente des politischen Prozesses“ gerichtet ist (Kaase, zit. nach Hoecker 2006: 10). Die repräsentativen Beteiligungsformen wie Wahlen, Kontakt zu Politikern und Behörden oder Engagement in Parteien und Gewerkschaften gelten in der Literatur bis heute als der klassische Bereich der konventionellen Partizipation (Deth 2009: 145–146). Für den Bereich der unkonventionellen Partizipation lassen sich z.B. folgende Aktivitäten unterscheiden (Hoecker 2006: 11; Hadjar/Becker 2007: 103):
- problemorientierte Aktivitäten, die unverfasst und legal sind, wie z.B. die Mitarbeit in Bürgerinitiativen, Unterschriftensammeln, Teilnahme an genehmigten Demonstrationen
- zivile Ungehorsamsaktionen, die unverfasst und illegal, aber zumeist gewaltlos sind, wie z.B. die Teilnahme an verbotenen Demonstrationen, Hausbesetzungen oder Blockaden
- politische Gewaltaktionen, die unverfasst, illegal und gewaltsam sind, wie z.B. die Teilnahme an Aufständen mit Sachbeschädigung, Geiselnahmen oder Terroranschläge
Das Adjektiv unkonventionell wird laut dem Portal Wortschatz der Universität Leipzig häufig als Synonym für „außergewöhnlich, neu, neuartig, rar, selten, ungewöhnlich“ gebraucht.[12] Dagegen wird das Adjektiv konventionell oft als Synonym für „alt, förmlich, gebräuchlich, gewohnt, herkömmlich, traditionell, üblich“ verwendet. Die Aufzählung verdeutlicht, dass konventionelle Beteiligung die in einer Gesellschaft etablierten und traditionellen Formen politischer Partizipation bezeichnet, während unkonventionelle Beteiligung stärker auf die Partizipationsformen jenseits des gesellschaftlichen Mainstreams bezogen ist. Entsprechend bleibt festzustellen, dass die Unterscheidung zwischen konventioneller und unkonventioneller Partizipation stark davon abhängt, inwieweit bestimmte Partizipationsformen innerhalb der politischen Praxis einer Gesellschaft verankert sind. Natürlich können etablierte Beteiligungsverfahren und die dahinterliegende Partizipationskultur von Ort zu Ort variieren. Entsprechend sind direktdemokratische Verfahren z.B. in der Schweiz seit vielen Jahrzehnten in der Verfassung verankert und gehören zur politischen Alltagspraxis (vgl. Möckli 1995; Vatter 2007). Dagegen wurden direktdemokratische Verfahren z.B. in Deutschland auf Landes- und Kommunalebene erst in den letzten 15 Jahren allmählich in die jeweiligen Verfassungen aufgenommen und spielen in der politischen Praxis auf Bundesebene de facto keine und auf Landesebene wegen restriktiver Zugangsbedingungen bisher nur eine überschaubare Rolle (vgl. Weixner 2006; Decker 2006). Langfristig kann sich die politische Partizipationskultur innerhalb einer nationalen Gemeinschaft natürlich verändern: Beteiligungsformen, die zu einem Zeitpunkt noch als unkonventionell galten, können sich im Zeitverlauf als konventionelle politische Praxis etablieren und schrittweise in die konstituierende Verfassung aufgenommen werden.
Den ersten großen Bereich unkonventioneller Partizipation umfassen solche Aktivitäten, die soziale Bewegungen als Mittel ihrer politischen Artikulation und Einflussnahme zur Anwendung bringen. Diese Mittel liegen im Bereich der demonstrativen Beteiligung, weshalb es Sinn macht, soziale Bewegungen auch als Protestbewegungen zu bezeichnen.[13] Für den Begriff der sozialen Bewegung ist es wichtig, dass nicht in Bezug auf jedes Protestereignis auch von einer Bewegung gesprochen werden kann: „Von Bewegungen sprechen wir erst, wenn ein Netzwerk von Gruppen und Organisationen, gestützt auf eine kollektive Identität, eine gewisse Kontinuität des Protestgeschehens sichert, das mit dem Anspruch auf Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels verknüpft ist“ (Roth/Rucht 2008: 13). Obwohl der Anspruch auf Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse als zentrales Wesensmerkmal sozialer Bewegungen gilt, ist damit keine Aussage über „die Reichweite solcher Gestaltungsversuche, die beanspruchte Veränderungstiefe und nicht zuletzt die tatsächliche Wirkung“ verbunden (Roth 2011: 101). Grundsätzlich sind Protestbewegungen „umstritten“, weil sie „Partei ergreifen, ausgegrenzte Interessen vorbringen, bestehende Herrschaftsverhältnisse kritisieren und alternative Lebensstile proklamieren“ (Roth/Rucht 2008: 16). In den politischen Auseinandersetzungen „treffen sie auf andere Akteure, die ihre Anliegen unterstützen oder ignorieren, wenn nicht gar in Form von Gegenbewegungen bekämpfen“ (Roth 2011: 103). Ob und mittels welcher Strategie die politischen Ziele sozialer Bewegungen überhaupt erreicht werden können, ist mit dem Beginn ihres Protestes meistens noch weitgehend unklar: „Zum Begriff der sozialen Bewegung gehört also immer auch die Möglichkeit des Scheiterns beziehungsweise höchst ambivalente Resultate zu erzielen (...)“ (Roth 2011: 103). Die Mittel der politischen Einflussnahme sind, anders als bei Verfahren der repräsentativen, der deliberativen und auch der direkten Beteiligung, nicht bereits von Anfang an mehr oder weniger eindeutig vorgegeben, sondern stellen selbst den Gegenstand des sich im Protestverlauf mehrfach wiederholenden Prozesses der kollektiven Selbstbestimmung sozialer Bewegungen dar. Das Merkmal der Selbstorganisation und Selbstkonstituierung ist zentral für soziale Bewegungen. Häufig stellen einzelne Bürgerinitiativen oder nur sehr lose organisierte politische Gruppierungen die Keimzelle der Mobilisierung für Protestbewegungen dar, die im Verlauf der Ereignisse aber zu einem großen Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, anderen Verbänden, Parteien und Medienvertretern anwachsen, um über diesen Weg genügend Aufmerksamkeit, Einfluss und Druck in der politischen Öffentlichkeit generieren zu können (Roth/Rucht 2008: 22–26). Neben der Bestimmung einer eigenen Identität, der Inspiration durch historische Vorläufer, den propagierten Ideologien und Zielsetzungen sowie den Organisationen und Netzwerken, zählen vor allem die Strategien und Aktionen zu den wichtigen Merkmalen sozialer Bewegungen: „Ohne sichtbaren Protest gibt es keine soziale Bewegung. Alltagsroutinen bestätigen den Status quo. Wer mehr und anderes will, muss sich etwas einfallen lassen“ (Roth/Rucht 2008: 26). Die historische Bedeutung der neuen sozialen Bewegungen, die sich in Deutschland seit den 70er und 80er Jahren als dominierende Bewegungsform etablieren konnten, wird in der Literatur sehr positiv eingeschätzt (Roth 2011: 104; Rucht 2013: 65). Dabei darf nicht übersehen werden, dass sich die politische Protestkultur bis heute teilweise deutlich verändert hat und die angestrebten Ideologien und Zielsetzungen von Protestbewegungen nicht in jedem Fall „progressiv“ und demokratiefreundlich sein müssen. Ganz im Gegenteil „können sich auch rechtsextreme und rechtspopulistische Gruppierungen zu Bewegungen verdichten“ (Roth 2011: 99).[14]
Einen zweiten relativ großen Bereich im Feld der unkonventionellen Partizipation deckt die sogenannte Bürgerbeteiligung ab. Bürgerbeteiligung umfasst sowohl den Bereich deliberativer als auch den Bereich direkter Beteiligung und kann sowohl von staatlicher Seite als auch von Seiten zivilgesellschaftlicher Akteure initiiert werden. In ihrem Handbuch haben Nanz/Fritsche (2012: 25–35) vier Kriterien zur Beschreibung und Einordnung von Verfahren der Bürgerbeteiligung entwickelt: Das erste Kriterium bezieht sich auf die Dauer und Teilnehmerzahl. Von Interesse ist dabei, ob die Verfahren punktuell oder kontinuierlich stattfinden, eine bestimmte Mindestdauer erfüllen, den Teilnehmerkreis begrenzen und die Interaktion aller Teilnehmenden miteinander oder eine Aufteilung der Gesamtgruppe in Kleingruppen vorsehen (Nanz/Fritsche 2012: 25). Das zweite Kriterium nimmt Bezug auf die Auswahl und Zusammensetzung des Teilnehmerkreises. Dabei geht es vor allem darum, eine möglichst hohe gesellschaftliche Repräsentativität herzustellen, die dann gegeben ist, „wenn der Teilnehmerkreis eines Verfahrens alle für ein spezifisches Thema relevanten gesellschaftlichen Gruppen abbildet“ (Nanz/Fritsche 2012: 26). Die Über- oder Unterrepräsentation sozialer Gruppen, die sich über ihre Herkunft, Religion, ihr Geschlecht oder ihr Alter definieren, ist demnach zu vermeiden. Nanz/Fritsche (2012: 26–28) differenzieren die Mechanismen der Selbstselektion, der zufälligen Auswahl und der gezielten Auswahl voneinander. Beteiligungsverfahren, in denen die Rekrutierung der Teilnehmer über Selbtselektion erfolgt, sind prinzipiell offen für alle Bürger, die sich vollkommen selbstständig „zur Teilnahme an einem partizipativen Angebot entscheiden“ (Nanz/Fritsche 2012: 26–27). Selbstselektive Verfahren sind anfällig für die Überrepräsentation und Dominanz von Teilnehmenden, die über eine höhere Bildung, mehr Zeit oder das erforderliche technische Know-How in Bezug auf Online-Verfahren verfügen (Nanz/Fritsche 2012: 27). Diesen Verzerrungseffekten können Verfahren, in denen eine zufällige oder gezielte Teilnehmerauswahl erfolgt, besser entgegenwirken (Nanz/Fritsche 2012: 27–28). Das dritte Kriterium zielt auf die angewandten Kommunikationsformen. Dabei beginnt partizipative Mitwirkung erst dort, wo der Rahmen von reinen Informationsveranstaltungen, in denen als Kommunikationsform das „Zuhören und Beobachten“ vorgesehen ist, überschritten und den Teilnehmenden der Bürgerbeteiligung mehr Raum für „einen tatsächlichen Input“ gegeben wird (Nanz/Fritsche 2012: 29–30). Bei der Kommunikationsform der Artikulation von Interessen ist vorgesehen, dass die Teilnehmenden „ihre Perspektive mit Anderen vergleichen, ihre Standpunkte differenzieren und gegebenenfalls auch verändern“ (Nanz/Fritsche 2012: 30). Beim Verhandeln dagegen sollen Interessenkonflikte zwischen den Konfliktparteien ausgehandelt werden, „um am Ende zu einem von allen Beteiligten getragenen Kompromiss zu gelangen“ (Nanz/Fritsche 2012: 30). Der Austausch von Argumenten in Deliberationen ist dagegen komplexer und stärker an „dem Ziel einer kollektiven Meinungsbildung“ orientiert (Nanz/Fritsche 2012: 30). Das vierte Kriterium ist auf die verschiedenen Funktionen von Beteiligungsverfahren gerichtet. Dabei geht es nicht zuletzt um „die Anschlussfähigkeit und Einbettung eines Verfahrens in das politisch-administrative System“ (Nanz/Fritsche 2012: 31). Allgemein lassen sich die folgenden Beteiligungsstufen voneinander unterscheiden, die sich in der Realität jedoch häufig überlagern, so dass es zu Mischformen kommen kann: 1. Individueller Nutzen: Hierbei handelt es sich um Beteiligungsverfahren, die „keinen oder nur geringen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse“ haben, aber den Teilnehmenden im Sinne einer „Qualifizierung persönlicher Kompetenzen“ nutzen (Nanz/Fritsche 2012: 33). Damit sind die demokratischen Fertigkeiten und Fähigkeiten (»Democratic Skills«) gemeint, die etwa das „Zuhören und Anerkennen des Gegenübers und Berücksichtigen anderer Meinungen, Austauschen von Argumenten (...)“ umfassen (Nanz/Fritsche 2012: 31). 2. Einflussnahme auf Öffentlichkeit: Hiermit sind Verfahren gemeint, die „keinen unmittelbaren Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse“ nehmen, aber „zur Initiierung und Bereicherung öffentlicher Debatten beitragen“ und damit langfristig auch den „Handlungsdruck auf Entscheidungsträgerinnen und -träger“ erhöhen können (Nanz/Fritsche 2012: 33). 3. Konsultation und Stellungnahme: Hierbei handelt es sich um Verfahren, in denen die Teilnehmenden gemeinsam Empfehlungen an die Politik und Verwaltung abgeben. Obwohl die formulierten Vorschläge prinzipiell keine Verbindlichkeit zur politischen Umsetzung mit sich bringen, sind die politisch Verantwortlichen in der Regel zumindest dazu verpflichtet, die Empfehlungen zu beachten und offiziell Stellung zu beziehen (Nanz/Fritsche 2012: 34). 4. Mit-Entscheidung und Co-Governance: Damit sind Verfahren gemeint, in denen die Empfehlungen der Teilnehmenden im Gegensatz zur Konsultation und Stellungnahme „garantiert in den weiteren Entscheidungsprozess einfließen“ (Nanz/Fritsche 2012: 34). Mit-Entscheidung und Co-Governance bedeuten „eine direkte Einflussnahme auf politische Entscheidungen. Sie kann bis zur unmittelbaren Entscheidungsverantwortung in Bürgerhand reichen“ (Nanz/Fritsche 2012: 34). Damit konnte verdeutlicht werden, dass die Spannbreite der Verfahren, die als Bürgerbeteiligung gelten, von der Nicht-Beeinflussung über die Initiierung öffentlicher Debatten und der Konsultation bis in den Bereich der mehr oder weniger direktdemokratischen Einflussnahme auf politische Entscheidungen reicht. Im Bereich der Stadtentwicklung ist eine Besonderheit zu beachten: Für die städtebauliche Planung ist Bürgerbeteiligung nach dem Baugesetzbuch gesetzlich verbindlich geregelt und wird in der politischen Praxis durch das sog. Bebauungsplanverfahren entsprechend durchgeführt. Die Bürgerbeteiligung in den Planverfahren reicht damit in den Bereich der konventionellen Partizipation hinein und wird noch problematisiert (vgl. Teil 3.2.1). Die in dieser Arbeit bisher getroffenen Unterscheidungen zum Begriff der politischen Partizipation können nun abschließend noch einmal nachvollzogen werden (siehe dazu Abbildung 2).
Abbildung 2: Die bisher getroffenen definitorischen Unterscheidungen in einem Überblick
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2 Die Rolle unkonventioneller Partizipation aus drei Perspektiven der gegenwärtigen Demokratietheorie im Vergleich
Bevor die Unterschiede der drei in diesem Kapitel zu behandelnden Demokratiemodelle von Jürgen Habermas, Chantal Mouffe und Jane Mansbridge aufgezeigt werden, gilt es an dieser Stelle zunächst einmal ihre Gemeinsamkeiten zu betonen: Demnach sind sich die Autoren darin einig, dass die bloße Effektivität und Stabilität des politischen Prozesses und der rechtsstaatlichen Institutionen allein nicht dafür ausreichen, um die repräsentative Demokratie lebendig zu halten. Vielmehr bedarf es dafür zusätzlich einer politisch wachen und auch aktiven Zivilgesellschaft, die die Regierungspolitik kritisch überprüft, zurückweist und mitgestaltet. Unkonventionelle Partizipation nimmt demnach eine wichtige Rolle für die Legitimation demokratischer Entscheidungsprozesse ein und kann nach den drei Modellen zumindest teilweise zur Kompensation der wachsenden Legitimationsdefizite in repräsentativen Demokratien beitragen.[15] Gleichzeitig – und hierin besteht eine zweite Übereinstimmung zwischen Habermas, Mouffe und Mansbridge – gilt es sich in Bezug auf die pluralistischen Gesellschaften von heute von der unrealistischen Annahme zu verabschieden, dass sich die staatliche Politik oder die politische Beteiligung nur und ausschließlich an einem ein für alle Male gültigen Allgemeinwohl orientieren könnten oder sollten. Da es den einen Volkswillen nicht gibt und niemals geben kann, werden kollektiv verbindliche Entscheidungen für die davon Betroffenen stets umstritten sein. Es stellt sich daher die Frage, wie mit den verschiedenen und zum Teil in Konflikt zueinanderstehenden Meinungen und Interessen zwischen den Akteuren in Bezug auf politische Themen umgegangen werden sollte. In ihrer Antwort auf diese Frage unterscheiden sich die Demokratiemodelle von Habermas, Mouffe und Mansbridge deutlich voneinander. Die Differenzen betreffen a) ihre Positionierung im demokratietheoretischen Diskurs, b) ihr Demokratieverständnis und c) ihre Rollenzuschreibung unkonventioneller Partizipation in der repräsentativen Demokratie. Im Folgenden werden die genannten Einzelaspekte ausgeführt, so dass ein Gesamteindruck über die wichtigsten Charakteristika und Argumentationslinien der drei erwähnten demokratietheoretischen Ansätze entstehen kann.
2.1 Argumentation, Kommunikatives Handeln und rationaler Konsens als Leitmotive des deliberativen Demokratiemodells von Jürgen Habermas
Mit dem deliberativen Demokratiemodell wendet sich Habermas (1996: 277) explizit gegen ein liberales und gegen ein republikanisches Politikverständnis. Dabei stellt sein Ansatz einen Mittelweg zwischen beiden Richtungen dar, der ihre Vorzüge vereinen und ihre Nachteile überwinden soll (Habermas 1996: 277–292). Das liberale Demokratiemodell hält Habermas (1996: 287) für realistischer, weil es die Notwendigkeit einer Trennung und Arbeitsteilung zwischen Staat und Zivilgesellschaft anerkennt. Außerdem nehmen die in einem Rechtsstaat gewährten negativen Freiheitsrechte für ihn, wie auch nach liberaler Lesart, einen zentralen Stellenwert ein. Entsprechend sollten sich die Staatsbürger gegenseitig „das größtmögliche Maß gleicher subjektiver Handlungsfreiheiten“ zugestehen (Habermas 1994: 155). Insgesamt bleibe das liberale Modell aber unzureichend, weil es den politischen Prozess vor allem als „geregelten Macht- und Interessenausgleich“ begreifen und sich ausschließlich „am Output einer erfolgreichen Leistungsbilanz der Staatstätigkeit orientier[en]“ würde (Habermas 1996: 287). Das republikanische Modell habe dagegen den Vorteil, dass es an dem Ideal „der Selbstorganisation der Gesellschaft durch die kommunikativ vereinigten Bürger (...)“ festhalte (Habermas 1996: 283). Wie auch nach republikanischer Lesart nehmen die politischen Rechte auf eine „chancengleiche Teilnahme an Prozessen der Meinungs- und Willensbildung“ für Habermas (1994: 156) eine herausragende Bedeutung ein. Insgesamt sei das republikanische Modell aber zu idealistisch, da es den „demokratischen Prozess von den Tugenden gemeinwohlorientierter Staatsbürger abhängig“ mache und die Politik mit „Fragen der ethischen Selbstverständigung“ überfrachte (Habermas 1996: 283). Aus den genannten Gründen erachtet Habermas ein drittes Modell für notwendig.
Im Zentrum des deliberativen Demokratiemodells stehen öffentliche Deliberationen[16], in denen alle von einer gesetzlichen Maßnahme potenziell betroffenen Bürger ihre Argumente austauschen und zu Ja- und Nein-Stellungnahmen zusammentragen können. Nach der Auffassung von Habermas erschöpft sich die Legitimität eines demokratischen Rechtsstaates nicht in seiner legalen Ordnung. Mit anderen Worten sollten Gesetze nicht aufgrund ihres legalen Status oder aufgrund von Angst vor den staatlichen Sanktionspotenzialen befolgt werden, sondern aufgrund der freiwilligen Anerkennung seitens der Bürger: „Rechtsnormen müssen aus Einsicht befolgt werden können “ (Habermas 1994: 155). Es ist der Anspruch des deliberativen Demokratiemodells zu zeigen, wie „die private und öffentliche Autonomie der Bürger“ in einem demokratischen Rechtsstaat „ gleichgewichtig zur Geltung“ gebracht und wie die Doppelrolle der Bürger als Autoren und Adressaten des Gesetzes wirksam werden könnte (Habermas 1994: 151). In diesem Zusammenhang gibt das Diskursprinzip darüber Auskunft, wie dies gelingen soll bzw. welches Kriterium erfüllt sein müsste, damit der öffentliche Deliberationsprozess zu einem erfolgreichen Ende gelangt: „D: Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten“ (Habermas 1994: 138).[17] Auf die politische Praxis übertragen, wird mit dem Diskursprinzip angenommen, dass die verschiedenen Akteure in einem politischen Gemeinwesen zu einem rationalen Konsens in Bezug auf kollektiv verbindliche Entscheidungen gelangen könnten. Aus prozeduralistischer Perspektive sind es die Kommunikationsbedingungen, die für die Legitimation des politischen Prozesses zentral sind: „Das dritte Demokratiemodell, das ich vorschlagen möchte, stützt sich genau auf die Kommunikationsbedingungen, unter denen der politische Prozess die Vermutung für sich hat, vernünftige Resultate zu erzeugen, weil er sich dann in ganzer Breite in einem deliberativen Modus vollzieht“ (Habermas 1996: 285). Die vier wichtigsten Bedingungen, die ein Beratungsprozess zu erfüllen hat, um als rationaler Diskurs gelten und vernünftige Resultate produzieren zu können, hat Habermas (2005: 54–55) wie folgt konkretisiert: Erstens muss der Diskurs öffentlich und inklusiv sein, d.h. das niemand ausgeschlossen bleiben darf, der einen relevanten Beitrag in Bezug auf die Thematik liefern könnte.[18] Zweitens ist allen Diskursteilnehmern die gleiche Chance einzuräumen, sich mit ihren Beiträgen einzubringen. Drittens müssen sich alle Diskursteilnehmer gegenseitig wahrhaftig mitteilen, was sie meinen. Viertens muss der Diskurs ohne jeden Zwang stattfinden, so dass darin ausschließlich die Kraft des besseren Arguments zur Geltung kommen kann. Wie mit dem letzten Aspekt bereits angedeutet, verlangt Habermas (2005: 53) von den Diskursteilnehmern eine „Unparteilichkeit“ in Bezug auf den Ausgang der öffentlichen Deliberation. Eine unparteiische Diskursteilnahme schließt im Zweifelsfall auch die Bereitschaft mit ein, die eigene Niederlage nach einer mehr oder weniger erschöpfenden Kontroverse einzugestehen. In jedem Fall gewinnt die deliberative Politik „ihre legitimierende Kraft aus der diskursiven Struktur einer Meinungs- und Willensbildung, die ihre sozialintegrative Funktion nur dank der Erwartung einer vernünftigen Qualität ihrer Ergebnisse erfüllen kann“ (Habermas 1994: 369).[19] Das Kriterium der Qualität ist aber unauflöslich mit dem Kriterium der Inklusivität verbunden, denn nur wenn alle von einer Entscheidung betroffenen Bürger die gleiche Chance auf politische Partizipation erhalten, kann die öffentliche Deliberation auch das notwendige Niveau erreichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt Habermas nicht etwa auf gezielte Auswahlmechanismen des Teilnehmerkreises, sondern auf eine prinzipiell vorhandene Fähigkeit der Argumentationsteilnehmer zur kritischen Selbstreflexion und zur Selbstkorrektur: „Man merkt es eben, wann neue Argumente in Betracht gezogen oder marginalisierte Stimmen ernst genommen werden müssen“ (Habermas 2005: 56).
Jürgen Habermas unterscheidet in seiner Diskursethik bekanntlich zwischen den Interaktionsformen des strategischen Handelns einerseits und des kommunikativen Handelns andererseits (Fuchs-Goldschmidt 2008: 51–53): Während strategisch handelnde Akteure in der sprachlichen Interaktion mit anderen stets an egozentrischen Erfolgskalkülen orientiert seien, ginge es kommunikativ handelnden Akteuren in der Interaktion darum, ein intersubjektives Einverständnis über die Gültigkeit der vorgebrachten Argumente zu erzielen. Dies bedeutet, dass strategisch handelnde Akteure maximal einen Kompromiss oder eine formale Übereinstimmung erzielen können, indem sie einer Entscheidung aus verschiedenen subjektiven Gründen zustimmen. Für kommunikativ handelnde Akteure liegt das Maximalziel eines rationalen Konsenses höher, denn demnach „zählen allein die Gründe, die von den beteiligten Parteien gemeinsam akzeptiert werden können. Es sind jeweils dieselben Gründe, die für die kommunikativ Handelnden eine rational motivierende Kraft haben“ (Habermas 1994: 152). Wichtig ist nun, dass Habermas dem kommunikativen Handeln in seiner Diskursethik einen normativen Vorrang gegenüber strategischen Einstellungen im Sprachgebrauch zuschreibt (Fuchs-Goldschmidt 2008: 54). Es sei das Telos, d.h. der Sinn und Zweck, der menschlichen Sprache und Kommunikation, sich mit anderen vorbehaltlos zu verständigen (Fuchs-Goldschmidt 2008: 49 und 54). In der Öffentlichkeit agierende politische Akteure werden damit auf einen verständigungsorientierten Sprachgebrauch verpflichtet. Mit der Vorrangstellung kommunikativen Handelns wird ferner auch angenommen, dass Gesellschaften darauf angelegt seien, „prinzipiell alle Formen sozialer Auseinandersetzung über einen einverständlichen Konsens zu regeln“ (Fuchs-Goldschmidt 2008: 50). Konsensfindung wird von Habermas damit zum zentralen normativen Ideal seiner Demokratietheorie erhoben. Alle Formen politischer Partizipation nehmen gegenüber dem Konsensideal im Grunde nur eine abgeleitete Funktion ein. Die politische Selbstbestimmungspraxis der Bürger wird damit nicht auf bestimmte Inhalte oder eine bestimmte Form, aber auf das allgemeine Ziel einer rationalen Konsensfindung hin festgelegt. Ein machtorientierter oder strategischer Sprachgebrauch, mit dem Akteure gezielt ihren Erfolg maximieren oder einen Dissens mit anderen provozieren wollen und bewusst keinen Beitrag zur kooperativen Suche nach rational akzeptablen Ergebnissen leisten würden, wäre demnach per se als kontraproduktiv für die diskursive Meinungs- und Willensbildung einzustufen. Zwar ist sich Habermas (2005: 55) offenbar bewusst, dass es sich in Bezug auf seine vorgeschlagenen Kommunikationsbedingungen unvermeidbar um „starke Idealisierungen“ handelt und reale Diskurse stets von diesen abweichen. Trotzdem geht es ihm darum, dass sich die unter nicht-idealen Bedingungen geführten Diskurse der von ihm als ideal unterstellten Sprechsituation zumindest annähern (Habermas 2005: 55–56). In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, warum eine Orientierung an den Kommunikationsbedingungen überhaupt für sinnvoll erachtet werden sollte und ob damit nicht ein hoffnungslos idealistisches Bild der politischen Praxis gezeichnet wäre.
Habermas’ zweigleisige Grundannahme lautet, dass sich die deliberative Politikkonzeption und damit auch das Diskursprinzip über die demokratischen Verfahren der parlamentarischen Gesetzgebung einerseits und über die Meinungs- und Willensbildung der Öffentlichkeit andererseits realisieren lasse (Fuchs-Goldschmidt 2008: 163). Wie das funktionieren soll, zeigt Habermas mit dem Schleusenmodell, dem das Modell des demokratischen Machtkreislaufs von Peters als Vorlage dient (Habermas 1994: 429–467; Fuchs-Goldschmidt 2008: 173–188). Demnach seien die Kommunikations- und Entscheidungsprozesse einer repräsentativen Demokratie auf „der Achse Zentrum-Peripherie angeordnet, durch ein System von Schleusen strukturiert und durch zwei Arten der Problemverarbeitung gekennzeichnet“ (Habermas 1994: 429–430). Im Zentrum befindet sich der Kernbereich des politischen Systems, bestehend aus der Regierung und Verwaltung, dem Gerichtswesen und den parlamentarischen Körperschaften. Hier sind die zentralen Entscheidungskompetenzen und Problemverarbeitungskapazitäten angesiedelt. Deshalb müssen alle Beschlüsse und Änderungsanträge, die gesetzliche Verbindlichkeit erlangen sollen, „durch die engen Kanäle des Kernbereichs hindurchgeleitet werden“ und dort „die Schleusen demokratischer und rechtsstaatlicher Verfahren am Eingang des parlamentarischen Komplexes oder der Gerichte (und gegebenenfalls auch am Ausgang der implementierenden Verwaltung) passieren“ (Habermas 1994: 431–432). Das Zentrum ist von einer inneren Peripherie und einer äußeren Peripherie umgeben, wobei die äußere auch als politische Öffentlichkeit bezeichnet wird.[20] In der politischen Öffentlichkeit ließen sich „Output-orientierte Abnehmer“, wie z.B. öffentliche Verwaltungen, private Organisationen, Spitzenverbände und Interessengruppen, von „Input-orientierten Zulieferern“ unterscheiden (Habermas 1994: 430–431).[21] Im Gegensatz zu den an der Implementierung von Politik beteiligten Abnehmern würden die zuliefernden Gruppen, Assoziationen und Verbände „gesellschaftliche Probleme zur Sprache bringen, politische Forderungen stellen, Interessen oder Bedürfnisse artikulieren und auf die Formulierung von Gesetzesvorhaben oder Politiken Einfluss nehmen“ (Habermas 1994: 430). Es sind „diese meinungsbildenden, auf Themen und Beiträge, allgemein auf öffentlichen Einfluss spezialisierten Vereinigungen“, denen Habermas (1994: 431) einen Großteil der normativen Erwartungen seiner deliberativen Politikkonzeption zumutet: Sie sollen gesellschaftliche Probleme erstens wahrnehmen und identifizieren, zweitens überzeugend und einflussreich in der Öffentlichkeit thematisieren und drittens mit Beiträgen ausstatten und so dramatisieren, „dass sie vom parlamentarischen Komplex übernommen und bearbeitet werden“ (Habermas 1994: 435).[22] Doch wie können ihre Erfolgschancen auf eine inhaltliche Beeinflussung der Gesetzgebung eigentlich genau eingeschätzt werden?
Im inoffiziellen Machtkreislauf befindet sich die Öffentlichkeit im Ruhezustand und die Karriere neuer politischer Themen wird weitgehend vom politischen Zentrum bestimmt: Dem inside access model zufolge zirkulieren Gesetzesinitiativen bis zu ihrer formalen Behandlung ausschließlich innerhalb des politischen Systems, „sei es unter Ausschluss oder ohne erkennbare Einwirkung der politischen Öffentlichkeit“ (Habermas 1994: 459). Dem mobilization model zufolge geht die Gesetzesinitiative zwar ebenfalls vom politischen System aus, aber hier bedarf es einer Mobilisierung von Unterstützung in Teilen der politischen Öffentlichkeit, um das Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen oder es erfolgreich zu implementieren. Das dritte outside initiative model stellt den von Habermas bevorzugten offiziellen demokratischen Machtkreislauf dar: Nur hier geht die Initiative für Themen und Anregungen von den zivilgesellschaftlichen Kräften außerhalb des politischen Systems aus, die durch den Druck einer öffentlichen Meinung die Verfahren der parlamentarischen Gesetzgebung beeinflussen (Habermas 1994: 459).[23] Habermas gesteht ein, dass das Agenda-Setting meistens den ersten beiden Modellen und nur vergleichsweise selten dem dritten Modell entspricht. Im Normalfall sei die kommunikative Macht der Zivilgesellschaft zu schwach, um sich in der Öffentlichkeit gegen die administrative Macht des Gesetzgebers und die soziale Macht der intermediären Organisationen zu behaupten. Wenn z.B. Regierungen, Parteien oder Politiker öffentliche Debatten strategisch dafür nutzen, um mehr Wählerstimmen auf ihre Seite zu bringen und um ihre politischen Machtansprüche zu realisieren, wird ein rationaler Diskurs dadurch verhindert.[24] Ebenso verhält es sich, wenn Parteien, Gewerkschaften und Interessenverbände ihre soziale Macht (Geld, Ansehen, Wissen) einsetzen, um den politischen Prozess zugunsten ihrer ökonomischen Eigeninteressen zu manipulieren. Nicht zuletzt entscheidet auch die Macht der Massenmedien darüber, welche politischen Themen zu welchem Zeitpunkt und in welcher Weise in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden (Habermas 1994: 454–455). Trotzdem ist Habermas optimistisch, dass die kommunikative Macht einer deliberierenden Öffentlichkeit zumindest in Konfliktfällen die Kontrolle über die Gesetzgebung (zurück-)gewinnen kann. In Zeiten eines verstärkten Krisenbewusstseins, einer erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit und einer intensivierten Suche nach Lösungen könne sich das Kräfteverhältnis zwischen dem politischen System, den intermediären Organisationen und den zivilgesellschaftlichen Akteuren verändern: „Der Druck der öffentlichen Meinungen erzwingt dann einen außerordentlichen Problemverarbeitungsmodus“ (Habermas 1994: 433). In dem Fall gehen die Kommunikationsflüsse aus dem Bereich einer nicht durch Verfahren regulierten, aber grundrechtlich geschützten, pluralistischen Öffentlichkeit aus, passieren die Schleusen der parlamentarischen Beratung und Beschlussfassung oder der Gerichte und beeinflussen über diesen Weg den Gebrauch der administrativen Macht (Habermas 1994: 432). Zur erfolgreichen Umstellung des Machtkreislaufs bedarf es jedoch nicht nur öffentlicher Deliberation und überzeugender Argumente, sondern auch öffentlicher Unterstützung und einer grundsätzlich vorhandenen Protestbereitschaft in der Bevölkerung. Als erfolgreiche Beispiele in den letzten Jahrzehnten erwähnt Habermas (1994: 460–461) der Reihe nach die sozialen Bewegungen gegen a) das atomare Wettrüsten, b) eine friedliche Nutzung von Atomenergie, c) Experimente mit Gentechnik, d) die Umweltverschmutzung, d) die globale Armut und die Weltwirtschaftsordnung sowie e) gegen die Diskriminierung von Frauen. An diesen politischen Themen und ihren Karriereverläufen lasse sich erkennen, dass zum Teil „spektakuläre Aktionen, Massenproteste und anhaltende Kampagnen“ dafür notwendig waren, bis die inhaltlichen Anliegen der sozialen Bewegungen in der Öffentlichkeit ausreichend Aufmerksamkeit und Unterstützung erlangen und über den Weg politischer Wahlerfolge, der Aufnahme in Parteiprogramme, der Behandlung in den Parlamenten und in Form von Grundsatzurteilen der Justiz letztlich Einzug in „die Kernbereiche des politischen Systems“ finden konnten (Habermas 1994: 461). Als ein letztes Mittel des politischen Protests hält Habermas auch zivilen Ungehorsam für gerechtfertigt. Als zivilen Ungehorsam möchte er „Akte gewaltfreier symbolischer Regelverletzung“ verstanden wissen, mittels derer die Protestierenden die Legitimität kollektiv verbindlicher Entscheidungen in Zweifel ziehen (Habermas 1994: 462).
Das Rollenverständnis unkonventioneller Partizipation nach der deliberativen Demokratietheorie von Habermas dürfte nun deutlich geworden sein: Mit unkonventioneller Partizipation sind vor allem die Prozesse der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung angesprochen, deren Ergebnisse letztlich die Grundlage für politische Entscheidungen innerhalb des politischen Systems darstellen sollen. Im Gegensatz zu den demokratischen und rechtsstaatlichen Verfahren in den Parlamenten und Gerichten ist unkonventionelle Beteiligung nach deliberativer Lesart nicht veranstaltet, sondern geht vom freiwilligen Engagement zivilgesellschaftlicher Akteure aus, weshalb sie auch als politische Selbstbestimmungspraxis freier und gleicher Bürger angesehen werden kann. Anders als bei der repräsentativen und auch der direktdemokratischen Beteiligung steht bei der deliberativen Beteiligung nicht die Praxis des politischen Entscheidens, sondern die Praxis einer Open-End-Diskussion über politische Themen im Vordergrund (vgl. Teil 1.1). Im Feld der Bürgerbeteiligung reicht sie damit in den Bereich der Beeinflussung öffentlicher Debatten und der Konsultation von Politik, aber nicht in den Bereich des Mit-Entscheidens und des Co-Gouvernements hinein (vgl. Teil 1.2). Die Hauptaufgabe der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung erkennt Habermas darin, den vermachteten und verselbstständigten politischen Prozess erstens öffentlicher und inklusiver, zweitens informierter und drittens machtfreier und unparteiischer zu gestalten. Zu diesem Zweck sollen öffentliche Deliberationsprozesse zu gesellschaftlich relevanten Themen initiiert werden, in denen alle Diskursteilnehmer ihre Pro- und Kontra-Argumente vorbringen. Entsprechend dem Diskursprinzip sollte sich innerhalb des argumentativen Wettstreits eine Meinung als rational akzeptabel für Alle herausfinden lassen. Die öffentliche Meinung der Zivilgesellschaft darf nicht selber herrschen, sondern den Gebrauch der administrativen Macht nur von außen beeinflussen. Im Wettstreit um eine effektive Beeinflussung der Regierungspolitik konkurriert die kommunikative Macht zivilgesellschaftlicher Akteure allerdings mit der im Vergleich stärkeren sozialen Macht der intermediären Organisationen und ist dazu noch zu einem großen Anteil von der Gunst der Medienberichterstattung abhängig. Gerade aus diesen Gründen bedarf es zusätzlich der demonstrativen Beteiligung in Form von legalem Protest und zivilem Ungehorsam. Nur über politischen Protest können zivilgesellschaftliche Akteure nämlich ausreichend öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung für ihre gemeinsamen Anliegen und Argumente generieren, so dass die politisch Verantwortlichen unwillkürlich unter Handlungsdruck geraten. Im Angesicht anhaltender Proteste sozialer Bewegungen kann sich eine Eigendynamik entfalten und kann der inoffizielle Machtkreislauf auf den offiziellen demokratischen Machtkreislauf umgestellt werden. In dem Fall gibt die öffentliche Meinung das Agenda-Setting für das politische System vor und sind es die Bürger selbst, die sich zugleich als Urheber und auch als Adressaten des Gesetzes verstehen können.
2.2 Diskurs, Konflikt und Hegemonie als Leitmotive des agonistischen Demokratiemodells von Chantal Mouffe
Chantal Mouffe hat sich in einigen ihrer Beiträge (Mouffe 2007a; 2007b, 2008) der Aufgabe gewidmet, ein agonistisches Demokratiemodell zu entwickeln, welches zum einen der antagonistischen Dimension des Politischen und zum anderen dem in liberalen Demokratien prinzipiell vorhandenen Pluralismus gerecht werden soll. Mit ihrem hegemonietheoretischen oder als „radikal“ bezeichneten Demokratieverständnis grenzt sich Mouffe stark von deliberativen Ansätzen ab: Anstatt „Inklusion“, „machtfreie Verständigung“ und „rationalen Konsens“ als realisierbare oder wünschenswerte Ideale anzunehmen, wird aus radikaldemokratischer Sicht davon ausgegangen, dass demokratische Politik unvermeidlich mit Ausschluss, Machthandeln und Konflikt verbunden ist.[25] Dass politische Konflikte zwischen verschiedenen Akteuren immer wieder neu entstehen und ausgetragen werden, wird jedoch nicht als zu beseitigender Makel, sondern vielmehr als eine begrüßenswerte Eigenschaft moderner Demokratien angesehen: „Die Spezifizität der modernen Demokratie liegt in der Anerkennung und Legitimierung des Konflikts sowie in der Weigerung, ihn durch die Setzung einer autoritären Ordnung zu unterbinden“ (Mouffe 2007b: 46). Die wichtigste Aufgabe von demokratischer Politik sei demnach nicht, wie nach dem deliberativen Demokratiemodell „in der Überwindung des Wir-Sie-Gegensatzes“ zwischen politischen Identitäten durch angeblich neutrale Deliberationsverfahren und rationale Argumentation zu erkennen. Vielmehr gehe es darum, parteiliche, leidenschaftliche und mitreißende politische Gegnerschaften auf eine Art und Weise miteinander zu konfrontieren, „die mit der Anerkennung des für die moderne Demokratie konstitutiven Pluralismus vereinbar“ bleibt (Mouffe 2007a: 22).
Die Unterscheidung zwischen der Politik und dem Politischen ist für ein Verständnis des agonistischen Demokratiemodells besonders wichtig (Mouffe 2007a: 15–31; 2007b: 44–48). Mit dem Begriff des Politischen wird auf „die Dimension des Antagonismus“ verwiesen, die auf unterschiedlicher Art und Weise „für jede menschliche Gesellschaft konstitutiv“ ist (Mouffe 2007a: 16).[26] Mit dem Begriff der Politik hingegen wird „die Gesamtheit der Verfahrensweise und Institutionen“ angesprochen, „die das Miteinander der Menschen im Kontext seiner ihm vom Politischen auferlegten Konflikthaftigkeit organisiert“ (Mouffe 2007a: 16). Obwohl nun bestimmte Akteure (z.B. Regierungen, Parteien, Interessenverbände) aufgrund ihrer Machtvorteile mitunter sehr erfolgreich darin sein mögen, Politik zu machen, können auch sie den Bereich des Politischen immer nur zeitweilig und unvollständig kontrollieren. Dies liegt daran, dass es aus radikaldemokratischer Sicht keinen letztgültigen Grund für die Legitimation demokratischer Herrschaft gibt. Das einzige Grundprinzip der Demokratie ist paradoxer Weise ihre Grundlosigkeit: „Demokratie als Volksherrschaft ist in dem Maße eine radikale Demokratie, wie sie ihre eigene Grundlosigkeit anerkennt, ja sie sogar zu ihrem Kernprinzip macht (…). Denn in ihrem Zentrum befindet sich ein leerer Ort: der leere Ort der Macht, um dessen Besetzung legitimer Weise gestritten wird“ (Nonhoff 2007: 11). Doch welche Konsequenzen hat diese Einsicht über die Grundlosigkeit der Demokratie?
In ihrem radikaldemokratischen Ansatz betonen Laclau/Mouffe vor allem die Offenheit, Kontingenz und Nicht-Determiniertheit des Sozialen (Nonhoff 2007: 9).[27] Demnach ist es wenig sinnvoll von der Gesellschaft, der Nation, der Arbeiterklasse usw. als einer jeweils objektiv gegebenen Einheit zu sprechen. Vielmehr finden „andauernd scheiternde Prozesse der Vergesellschaftung und verschiedenste fragile, einander häufig gegenseitig beeinflussende gesellschaftliche Formierungen“ im Raum des Politischen statt (Nonhoff 2007: 9–10). In einer prinzipiell von Pluralität und Diversität geprägten Gesellschaft ist es notwendig, „im Zuge des politischen Kampfes immer aufs Neue um Gründungs- und Begründungsfiguren zu streiten“ (Nonhoff 2007: 7). Da es im Grunde nichts gibt, was dem politischen Streit entzogen bleiben sollte, werden auch „die Optionen der politischen Neugründung und Neuorientierung verfügbar und legitim“ (Nonhoff 2007: 11). Die Einsicht über die Grundlosigkeit der Legitimität demokratischer Herrschaft hat also einen umfassenden Perspektivwechsel zur Folge, nach dem es sich von der Vorstellung zu verabschieden gilt, dass das Projekt der Demokratisierung der Demokratie jemals zu einem Ende gebracht werden könnte. Nach einer Formulierung von Derridasollte die Demokratie als „notwendig im Kommen“ und „konstitutiv unvollständig“ verstanden werden (Flügel et al. 2004: 13).[28] Aus dieser radikaldemokratischen Perspektive muss die normative Leitidee der deliberativen Demokratietheorie, wonach politische Auseinandersetzungen mithilfe eines overlapping consensus (John Rawls) oder eines rationalen Konsenses (Jürgen Habermas)[29] zu lösen seien, autoritär und antidemokratisch erscheinen, weil ihre Verwirklichung das Ende des unendlichen Prozesses des Infragestellens und damit auch der politischen Kommunikation bedeuten würde. Außerdem gelte es sich demnach von der in den Sozialwissenschaften weit verbreiteten, kosmopolitischen Vision zu verabschieden, nach der es für möglich und erstrebenswert gehalten wird, einen vollständig befriedeten und transparenten Gesellschaftszustand zu erreichen (Mouffe 2007a: 7–14). Der Traum nach einer harmonisierten Weltordnung, in der alle Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die Aufteilung zwischen rechter und linker Politik sowie gesellschaftliche Antagonismen für immer der Vergangenheit angehören, entpuppt sich für Mouffe als eine antipolitische Vorstellung: „Mit dieser Sehnsucht wird (...) völlig verkannt, worum es in demokratischer Politik geht und welche Dynamik bei der Konstituierung politischer Identitäten zu bewältigen ist (...)“ (Mouffe 2007a: 8).
Nach der Diskurstheorie von Laclau/Mouffe konstituieren sich politische Identitäten und gesellschaftliche Ordnungen durch artikulatorische Praxen (Jörke 2004: 165–170).[30] Die soziale Wirklichkeit wird demnach diskursiv konstruiert, d.h. der Raum des Sozialen wird durch hegemoniale Artikulationen, die darin bestrebt sind Bedeutung zeitweilig und partiell zu fixieren, beständig reproduziert und verändert. Mit der Annahme über die soziale Konstruiertheit von Welt ist nicht gesagt, dass es keine Wirklichkeit jenseits von Diskursen gibt, wohl aber, dass alle Objekte, Aussagen, Handlungen und Ereignisse ihre spezifische Bedeutung „erst durch ihre relationale Anordnung innerhalb eines Diskurses“ erhalten (Jörke 2004: 166). Dabei zählen für Laclau/Mouffe sprachliche und auch nicht-sprachliche Praxen zu den relevanten Artikulationsmöglichkeiten: „Somit sind Diskurse explizit nicht auf die Sphäre der Sprache begrenzt: Auch Objekte, Subjekte, Zustände oder Praktiken ergeben erst im sozialen Relationsgefüge einen je spezifischen Sinn und sind insofern diskursiv strukturiert“ (Nonhoff 2007: 9).[31] Eine der wichtigsten Thesen in Hegemony and Socialist Strategy ist, dass soziale Objektivität im Modus der Diskursivität erst durch Machthandeln hervorgebracht wird: „Dies impliziert, dass jede soziale Objektivität letztlich politisch ist und dass sie Spuren des Ausschlusses, der ihre Konstituierung bestimmt, in sich trägt. Als Hegemonie bezeichnen wir genau jenen Punkt, an dem Macht und Objektivität zusammenfließen“ (Mouffe 2007b: 43). In den immer schon von Machtverhältnissen durchdrungenen und ständig umkämpften gesellschaftlichen Kontexten (d.h. im Raum des Politischen) ist Politik daher unvermeidlich mit Machthandeln und Ausschluss verbunden: „Politik zielt (…) auf die Schaffung von Einheit im Kontext von Konflikt und Diversität; sie hat immer mit der Schaffung eines wir durch die Bestimmung der anderen zu tun“ (Mouffe 2007b: 45). Es liege demnach im Wesen kollektiver Identitäten sich über eine Wir-Sie-Unterscheidung zu definieren und sich durch Macht und Ausschluss „in einem prekären Terrain, das stets Verwerfungen ausgesetzt ist, hervorzubringen“ (Mouffe 2007b: 43).[32] Nach dem agonistischen Demokratiemodell von Mouffe sollten die politischen Subjekte ihr Gegenüber nicht als Feind betrachten, den es zu zerstören gilt (Antagonismus), sondern als einen Gegner, deren Ideen sie zwar bekämpfen können, deren Grundrechte ihre Ideen zu verteidigen, sie allerdings prinzipiell respektieren müssen (Agonismus). Es kann als das normative Leitziel des agonistischen Demokratiemodells festgehalten werden, antagonistische Beziehungen zwischen Feinden in agonistische Beziehungen zwischen sich gegenseitig respektierenden Gegnern zu verwandeln (Mouffe 2007b: 45). Aber wie kann dieses normative Leitziel realisiert werden? Wie können die Gegnerschaften zwischen verschiedenen politischen Lagern mit dem Pluralismus liberaler Demokratien vereinbar bleiben?
Obwohl Chantal Mouffe die Konsensorientierung der deliberativen Demokratietheorien oft und stark kritisiert, kommt sie selbst nicht ohne eine ähnliche Forderung aus: Auch ihrer Meinung nach stellt „ein Konsens über die für die Demokratie konstitutiven Institutionen und über die ethisch-politischen Werte, die das politische Gemeinwesen konstituieren“ eine unverzichtbare normative Bedingung dar (Mouffe 2007a: 43). Allerdings betont Mouffe, dass ihre Forderung nach einem konfliktualen Konsens nichts mit den moralphilosophisch aufgeladenen Vorstellungen deliberativer Autoren gemeinsam habe: Auch wenn die verschiedenen Akteure eines politischen Gemeinwesens demnach prinzipiell mit den demokratischen Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit übereinstimmen sollten, muss es dennoch auch „Meinungsverschiedenheiten über deren Bedeutung und die Art und Weise ihrer Verwirklichung geben. In einer pluralistischen Demokratie sind solche Meinungsverschiedenheiten nicht nur legitim, sondern notwendig. Sie enthalten den Stoff, aus dem demokratische Politik gemacht wird“ (Mouffe 2007a: 43). Mit der Forderung nach einem konfliktualen Konsens sind zwei normative Erwartungen verbunden: Einerseits soll ein demokratischer Minimalkonsens zwischen den Kontrahenten gelten, der die Anerkennung der konstitutiven Rolle der rechtsstaatlich-demokratischen Institutionen und Verfahren für eine liberale Demokratie sowie die Akzeptanz des Anderen als gleichberechtigten politischen Gegner umfasst.[33] Andererseits sollen die Kontrahenten klar voneinander zu differenzierende Positionen entwickeln, die den Menschen echte Wahl- und Identifikationsmöglichkeiten bieten, ihre Leidenschaften wecken und ihnen Hoffnung für die Zukunft geben.[34] Nur wenn demokratische Politik von Dissens, Diversität und der Konfrontation hegemonialer Projekte geprägt ist, die den Menschen wirkliche Alternativen offerieren, kann eine politische Mobilisierung erwartet werden: „Mobilisierung erfordert Politisierung, aber Politisierung kann es nicht ohne konfliktvolle Darstellung der Welt mit gegnerischen Lagern geben, mit denen sich die Menschen identifizieren können“ (Mouffe 2007a: 35). Aus den genannten Gründen „sollten demokratische Theoretiker und Politiker ihre Aufgabe in der Schaffung einer lebendigen agonistischen Sphäre des öffentlichen Wettstreits sehen, in der verschiedene hegemoniale politische Projekte miteinander konfrontiert werden“ (Mouffe 2007a: 9-10). Nach den Ausführungen über das agonistische Modell stellt sich die Frage, welche Implikationen sich daraus für die politische Praxis und das Rollenverständnis der unkonventionellen politischen Partizipation ergeben.
In dem Essay „Postdemokratie“ und die zunehmende Entpolitisierung stimmt Mouffe (2011: 3) mit folgenden Annahmen der Postdemokratie-Debatte überein: a) die liberalen Demokratien funktionieren heute zwar formal noch nach demokratischen Prinzipien, werden aber mittlerweile eigentlich von privilegierten Eliten kontrolliert, b) die Implementierung einer neoliberalen Politik hat zur Vereinnahmung des Staates durch die Interessen von Banken, Unternehmen und Verbänden geführt, so dass wichtige politische Entscheidungen nicht mehr in den dafür vorgesehenen Gremien getroffen werden und c) der Legitimitätsverlust demokratischer Institutionen und der Politik ist an einer starken Entpolitisierung in der Bevölkerung zu erkennen (Mouffe 2011: 3). Der Hauptgrund für den postdemokratischen Zustand liegt für Mouffe (2013: 209–210) in der „gegenwärtigen neoliberalen Hegemonie“, die wiederum als „Ergebnis einer Reihe politischer Interventionen in ein komplexes Feld ökonomischer, rechtlicher und ideologischer Kräfte“ zu verstehen sei. In diesem diskursiven Konstruktionsprozess hätten das Kapital in Gestalt der Banken, Unternehmen und Verbände, die neokonservativen Parteien sowie die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien alle eine politisch aktive Rolle übernommen. Die genannten politischen Akteure hätten auf jeweils unterschiedliche Weise zu einem „Konsens der Mitte“ beigetragen, der behauptet, dass es keine Alternative mehr zur neoliberalen Globalisierung gebe (Mouffe 2013: 205–206). Das heutige „ Es gibt keine Alternative- Dogma“ der traditionellen Parteien sei aber höchst problematisch, weil es den Aufstieg rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien provoziere.[35] Die Rechtspopulisten seien in diesem Zusammenhang oftmals die Einzigen, die sich der neoliberalen Politik des politischen Establishments noch irgendwie entgegenstellten und die Leidenschaften der Menschen damit erfolgreich mobilisierten (Mouffe 2013: 206).
Nach Chantal Mouffe (2007b: 48–51) ist ein „neues linkes Projekt“ notwendig, das die neoliberale Hegemonie in Frage stellt und den Menschen eine radikaldemokratische Alternative gegenüber der Politik der Mitte bietet. Das Projekt der neuen Linke sollte demnach eine doppelte Zielsetzung verfolgen: Einerseits gehe es um „die Kritik und Disartikulation der existierenden Hegemonie“ und andererseits um die Reartikulation einer neuen hegemonialen Ordnung. Dem ersten negativen Moment, in dem eine Kritik und Ablehnung gegenüber der neoliberalen Ordnung artikuliert wird, muss ein zweites positives Moment folgen, in dem eine hegemoniale Alternative befürwortet wird: „Das zweite Moment, das Moment der Reartikulation ist entscheidend. Ansonsten würden wir einer chaotischen Situation reiner Dissemination begegnen, was Versuchen der Reartikulation durch nicht-progressive Kämpfe Tür und Tor öffnet“ (Mouffe 2013: 211). Eine neue linkspolitische Offensive sollte demnach nicht nur auf eine oppositionelle Politik der Störung des politischen Status quo setzen, sondern auch „die Konstruktion einer alternativen Hegemonie“ zum Ziel haben (Mouffe 2013: 214). Eine der zentralen Bedingungen für den Erfolg des neuen linken Projektes kann laut Mouffe (2007a: 71) darin erkannt werden, dass die diversen „alten und neuen demokratischen Bewegungen“ eine „ Äquivalenzkette “ bilden, um aus ihren unterschiedlichen Subjektpositionen „einen kollektiven Willen zu formen, ein Wir der radikaldemokratischen Kräfte.“ Damit sind an dieser Stelle z.B. die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Ökologiebewegung, die Homosexuellenbewegung, die Arbeiterbewegung, die Studentenbewegung, die Tierschutzbewegung sowie die städtischen, antirassistischen und antikapitalistischen Bewegungen angesprochen. Obwohl die einzelnen Fraktionen dieser Bewegungen z.T. jeweils heterogene politische Absichten verfolgen, könnten sie diese laut Mouffe „nur in einer Allianz mit den anderen Fraktionen erreichen“ (Jörke 2004: 178). Deshalb sei es umso wichtiger, dass sich die demokratischen Bewegungen trotz der Pluralität ihrer politischen Absichten und Strategien (Logik der Autonomie) zum gemeinsamen Kampf gegen Unterdrückung und zugunsten einer Demokratisierung der Demokratie verbündeten (Logik der Äquivalenz).[36] In ihrer gemeinsamen Opposition zu alten und neuen Formen der Unterdrückung und in ihrem gemeinsamen Ziel einer Vertiefung und Ausdehnung der Prinzipien der Freiheit und Gleichheit auf immer mehr soziale Verhältnisse sieht Mouffe den idealen Anknüpfungspunkt für ein neues linkes Bündnis (Jörke 2004: 178). An dieser Stelle kommt aber die Frage auf, wie das neue linke Bündnis, welches die Voraussetzung für ein neues linkes Projekt wäre, entstehen sollte. Warum sollten sich z.B. Arbeitnehmer, die sich in Gewerkschaften für die Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse einsetzen, mit radikalen Tierschützern verbünden?
Nach den Ausführungen dürfte das Rollenverständnis unkonventioneller Partizipation nach der agonistischen Demokratietheorie von Chantal Mouffe deutlich geworden sein: Sie ist als eine Praxis der demokratischen und kollektiven Selbstbestimmung zu verstehen, die der Schaffung einer agonistischen Sphäre des öffentlichen Wettstreits bzw. der Institutionalisierung des konfliktiven Konsenses in demokratischen Gesellschaften dient. Zu diesem Zweck ist allerdings die Bildung einer Äquivalenzkette zwischen den alten und neuen demokratischen Bewegungen notwendig: Die diversen Einzelfraktionen (z.B. Arbeiter-, Frauen- und Ökologiebewegung) sollen sich dabei trotz der Differenzen bezüglich ihrer politischen Ziele zu einem gemeinsamen Kampf verbünden. Der gemeinsame Kampf einer neuen Linken würde sich im negativen Sinne gegen die bis heute existierenden Formen von Unterdrückung richten und im positiven Sinne auf eine Vertiefung und Ausdehnung der formalen Prinzipien der Freiheit und Gleichheit auf immer mehr soziale Verhältnisse drängen. Nach der Meinung von Chantal Mouffe kann die hegemoniale Artikulation eines neuen linken Projektes allerdings nur Erfolg haben, wenn dabei zwei Momente berücksichtigt werden: Einerseits gehe es um die Kritik und Disartikulation der neoliberalen Ordnung und Ideologie. Andererseits gehe es aber auch um die Befürwortung und Reartikulation eines alternativen Gesellschaftsentwurfs bzw. einer anderen Vorstellung des guten Lebens. Opportunistischer Protest und Ablehnung gegenüber den kapitalistischen Verhältnissen allein sind demnach keine geeignete politische Strategie für die neue Linke. Der Bedarf für ein neues linkes Projekt ergibt sich laut Mouffe vor dem Hintergrund des postdemokratischen Zustandes und der Hegemonie des Neoliberalismus in den liberalen Demokratien. Für den politischen Status quo würden vor allem die traditionellen Parteien (vom linken bis zum rechten Spektrum) und das Kapital (in Gestalt der Banken, Unternehmen und Verbände) die Verantwortung tragen. Sie hätten gemeinsam zu einer Politik der Mitte beigetragen, die, mehr oder weniger bewusst, den Eindruck erweckt, dass es zur neoliberalen Globalisierung keine Alternative mehr gebe. Da durch die Politik der Alternativlosigkeit keine echten Unterschiede und Wahlmöglichkeiten mehr zwischen den einzelnen Kandidaten, Parteien und Regierungen bestünden, sei die verstärkte Politikverdrossenheit in der Bevölkerung und der zu beobachtende Aufstieg der Rechtspopulisten kein Wunder. Um dem Mangel an politischer Identifikation und den wachsenden Legitimationsdefiziten repräsentativer Demokratie[37] effektiv entgegenzuwirken, sollen die Leidenschaften der Menschen nach der Meinung von Chantal Mouffe durch das neue linke Projekt und die unkonventionelle Partizipation der sozialen Bewegungen wieder mobilisiert werden. Nach diesem Rollenverständnis kann und sollte unkonventionelle Partizipation die Funktion übernehmen, eine Kompensation für die wachsenden Legitimationsdefizite repräsentativer Demokratie zu erfüllen. Der Prozess der hegemonialen Artikulation einer alternativen Vorstellung des guten Lebens soll sich dabei möglichst auf alle gesellschaftlichen (Teil-)Bereiche und außerdem auch auf die verschiedenen Ebenen institutioneller Politik erstrecken: „Nicht in der Preisgabe des demokratischen Terrains, sondern im Gegenteil gerade in der Ausdehnung des Feldes demokratischer Kämpfe auf die ganze civil society und den Staat liegt die Möglichkeit für eine hegemoniale Strategie der Linken“ (Laclau/Mouffe [1985] 2006: 240–241). Wie sich die Bildung von Äquivalenzketten zwischen den einzelnen demokratischen Bewegungen und wie sich die Strategie der neuen Linken dabei eigentlich genau in die politische Praxis übertragen lassen sollte, bleibt in der mouffschen Konzeption aber viel zu offen und unklar. Mouffe erklärt nicht, wie die unkonventionelle Partizipation der demokratischen Bewegungen genügend Einfluss auf die anderen Gesellschaftsbereiche und die verschiedenen Ebenen der institutionellen Politik gewinnen sollte. Wie kann das Terrain der institutionellen Politik, das doch gegenwärtig von der Ideologie des Neoliberalismus dominiert wird, durch die neue Linke zurückerobert werden? Und welchen Beitrag können die verschiedenen Formen der unkonventionellen und konventionellen Partizipation leisten?
2.3 Deliberation, Verhandlung und Entscheidungsfindung als Leitmotive des pragmatischen Demokratiemodells von Jane Mansbridge
In den letzten Jahren hat Jane Mansbridge eine wichtige Rekonzeptualisierung der klassisch-deliberativen Demokratietheorie vorgenommen (Mansbridge 2006; 2009; Mansbridge 2010 et al.; 2015).[38] Einerseits geht es ihr darum, die Legitimität der Rolle von (Selbst-)Interessen, Konflikt und zwingender Macht in demokratischen Prozessen anzuerkennen und die Potenziale von Verhandlungen, Bargaining (Feilschen) und Abstimmungen durch Wahlen zu erforschen. Andererseits möchte sie aber auch an bestimmten normativen Idealen festhalten, die traditionell mit dem Begriff der Deliberation verbunden sind. Die Beteiligten an Deliberationen weichen in ihren Meinungen und materiellen Interessen häufig zurecht voneinander ab, woraus Konflikte entstehen, die sich nicht immer zugunsten eines Allgemeinwohls auflösen lassen: „No decision putatively for the common good is legitimate if created by ignoring conflicting interests“ (Mansbridge 2006: 107). Die potenzielle Möglichkeit der Entstehung von unlösbaren Konflikten bedeutet aber nicht, dass deshalb die kooperative Suche nach Konsens, integrativen Lösungen oder fairen Kompromissen in jedem Fall als nicht realisierbar, unpolitisch oder aufoktroyiert abgetan werden muss. Die politische Partizipation und der demokratische Prozess lassen sich nach Mansbridge nicht einfach entweder auf die Suche nach einem rationalen Konsens, Gemeinsamkeiten und Harmonie oder aber auf die agonistische Inszenierung von Dissens, Gegnerschaft und Konflikt festlegen: „It is not easy to value both conflict and commonality, giving each a respected place in the political arena“ (Mansbridge 2006: 115). Aber genau darin liegt der Anspruch des pragmatischen Demokratiemodells von Jane Mansbridge. Da sie damit ausdrücklich die Vereinbarkeit zwischen Konflikten und Gemeinsamkeit zum normativen Leitziel einer pluralistischen Demokratie erklärt, kann ihr Modell als eine Art theoretischer Mittelweg zwischen den bereits dargestellten Modellen von Jürgen Habermas (vgl. Teil 2.1) und Chantal Mouffe (vgl. Teil 2.2) angesehen werden. Ob und wie ihr dieser Mittelweg gelingt und welche Implikationen sich daraus im Einzelnen für die politische Praxis ergeben, wird im Folgenden erklärt.[39]
Der Begriff der Deliberation wird von Mansbridge (2015: 27) als „mutual communication that involves weighing and reflecting on preferences, values and interests regarding matters of common concern“ definiert.[40] Mit dieser minimalen Definition wird der Begriff der Deliberation in dreierlei Hinsicht begrenzt: Die erste Komponente – mutual communication – verweist darauf, dass mit Deliberation eine kommunikative Interaktion zwischen zwei oder mehreren Personen angesprochen ist und Formen der „one-way-communication“ nicht unter den Begriff fallen (Mansbridge 2015: 29). Die zweite Komponente – weighing and reflecting – nimmt darauf Bezug, dass in Deliberationen üblicherweise die Vorteile und Nachteile zweier oder mehrerer Handlungsoptionen abgewogen und reflektiert werden, so dass damit auch die Qualität der Entscheidung verbessert werden kann: „In short, a communicative process that includes little or no reflective interactive weighing is not by itself deliberation“ (Mansbridge 2015: 28). Die dritte Komponente – on preferences, values, and interests regarding matters of common concern – spezifiziert den Gegenstand von Deliberationen als öffentliche und darum gemeinsame Angelegenheit, womit abwägende und reflektierende Gespräche, die nur für Individuen oder Paare relevant sind, ausgeschlossen bleiben (Mansbridge 2015: 29). In einem zweiten Schritt geht Mansbridge der Frage nach, welche normativen Maßstäbe dafür geeignet sind, um eine gute von einer schlechten Deliberation zu unterscheiden. Ihrer Ansicht nach sind fünf normative Kriterien dafür notwendig, um damit die Legitimität und Qualität von Deliberationsprozessen beurteilen zu können: 1. mutual respect, 2. absence of power, 3. clarification of interests, 4. epistemic value and substantive balance, 5. equal opportunity and inclusion (Mansbridge 2015: 35–40).
1. Der Maßstab des gegenseitigen Respekts (mutual respect) beinhaltet, den fundamentalen Wert und die Würde des Anderen anzuerkennen. Bezüglich öffentlicher Deliberation ist damit eine Verpflichtung angesprochen, den anderen Teilnehmern gegenüber aufmerksam zuzuhören und ihnen möglichst akzeptable Begründungen für die jeweils eigenen Standpunkte anzubieten (Mansbridge 2015: 35). Wieviel gegenseitiger Respekt in einer Deliberation vorherrscht, ist schwer zu messen, kann aber z.B. daran erkannt werden, wie häufig die Teilnehmer in ihren Redebeiträgen aufeinander Bezug nehmen. „A deliberation cannot be considered good without high levels of mutual respect“ (Mansbridge 2015: 35). Obwohl gegenseitiger Respekt als normative Notwendigkeit für Demokratien unumstritten ist, wird durchaus kontrovers darüber diskutiert, was dieser Maßstab genau in Bezug auf die politische Praxis aussagt. Während der Maßstab des gegenseitigen Respekts im Kontext der Aggregation das Auszählen von Inputs auf der Basis gleicher Machtansprüche impliziert, verlangt er im Kontext der Deliberation vor allem die Abwesenheit von zwingender Macht: „Getting people to do something on the basis of coercive power (...) is directly opposed to getting them to do something via deliberation on the basis of genuine persuasion on the merits“ (Mansbridge 2015: 43).
2. Mit dem Maßstab der Abwesenheit von Macht (absence of power) wird verlangt, dass die Teilnehmer von öffentlichen Deliberationen möglichst auf den Gebrauch von zwingender Macht verzichten, womit die Androhung von Sanktionen und die Anwendung von Gewalt gemeint sind (Mansbridge 2015: 36). Laut Mansbridge (2009: 9) ist Macht als Präferenz oder Interesse von Person A zu verstehen, bestimmte Ergebnisse zu erzielen oder die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ergebnisse zu verändern. Zwingende Macht ist dagegen als A’s Präferenz oder Interesse zu verstehen, Person B zu einem Verhalten zu veranlassen oder ein Verhalten von B wahrscheinlicher zu machen, welches B ohne die Androhung von Sanktionen oder die Anwendung von Gewalt unterlassen würde. Der Unterschied zwischen der Androhung von Sanktionen und dem Gebrauch von Gewalt liegt darin, dass erstere den Willen des Gezwungenen, wenn auch nur minimal, mit einbezieht: „If I threaten you with a sanction (Leave this room or I’ll shoot you), you can always accept the sanction and deprive me of what I want“ (Mansbridge 2009: 9). Gewalt hingegen bezieht den Willen des Gezwungenen gar nicht mit ein: „When I use force, I achieve my goal without a choice on your part (I carry you out of the room, kicking and screaming)“ (Mansbridge 2009: 9). Lügen und Manipulation stellen z.B. auch Formen der Gewalt dar: „A’s lying leads B to act, without B’s willing it, against B’s own interests in ways that B would otherwise not act. Other forms of manipulation, in ways that structure alternatives against other’s interests, are also forms of force” (Mansbridge 2009: 10). Überzeugung unterscheidet sich von beiden Formen der zwingenden Macht dadurch, dass die andere Person zwar auch zu einem Verhalten veranlasst werden soll, aber ihr dabei ihr freier Wille überlassen bleibt (Would you please leave the room!?). In Deliberationen sollen die Teilnehmer möglichst nur durch das Mittel der Überzeugung zu einer bestimmten Handlung, Meinung oder Position gebracht werden. Zusammen stellen die Maßstäbe des gegenseitigen Respekts und der Abwesenheit von Macht die ethische Funktion dar, die Deliberationen im Einzelnen und der demokratische Prozess im Ganzen so gut wie möglich erfüllen sollen (Mansbridge 2015: 43).
3. Mit dem Maßstab der Klärung der vorliegenden Interessen (clarification of interests) steht Mansbrigde in direkter Opposition zur klassisch-deliberativen Demokratietheorie: „Although classic deliberative democrats such as Habermas place a high value on the contestation of opinions, they believe the deliberative focus should be solely on the common good. For such theorists, it was not conflict per se but the conflict of self-interests that contaminated the process” (Mansbridge 2015: 38). Die Annahme, dass materielle Interessenkonflikte den politischen Prozess vergiften und Selbstinteressen deshalb keine Rolle in Bezug auf politische Angelegenheiten spielen sollten, ist nach der Ansicht von Mansbridge zu verwerfen. In dem Sammelwerk Beyond Self-Interest macht Mansbridge (1990: 133–143) darauf aufmerksam, dass altruistische Motive und Selbstinteressen in den meisten Situationen nicht sauber voneinander zu trennen sind, sondern sich vielmehr häufig überlagern und wechselseitig ergänzen. Wenn es um die gemeinsamen Angelegenheiten einer politischen Gemeinschaft (polity) geht, herrscht demnach gewöhnlich ein unübersichtliches Geflecht zwischen altruistischen Motiven und Selbstinteressen vor. Eine wichtige Aufgabe guter Deliberation liegt insofern darin, die vorliegenden Einzel- und Gruppeninteressen zu klären: „bringing one’s self-interests and group interests to the table when those interests are relevant to the decision is not only consonant with but required by the standards for good deliberation” (Mansbridge 2015: 38–39). Ohne eine solche Klärung könnten die verschiedenen Akteure gar nicht wissen, ob sie bereits gemeinsame Interessen haben, gemeinsame Interessen entwickeln könnten oder ihre Interessen in einem unlösbaren Konflikt zueinanderstehen. Für Mansbridge liegt das Hauptziel politischer Partizipation deshalb darin, herauszufinden, ob und inwieweit die jeweils eigenen Interessen in Bezug auf ein politisches Thema mit den Interessen anderer Akteure in der politischen Gemeinschaft übereinstimmen oder aber in Konflikt zu ihnen stehen (Williams 2012: 802). In Bezug auf bestimmte Situationen sollten gute Deliberationen das Handeln nach dem Eigeninteresse aktiv legitimieren. Wenn in der Politik distributive Themen aufkommen, sei es faktisch unmöglich und normativ abzulehnen, die Eigeninteressen aus den öffentlichen Deliberationen herauszuhalten, weil damit die Kapazitäten der Deliberationsteilnehmer unterwandert werden, ihre gerechten Ziele mit legitimen Prozeduren zu erreichen (Mansbridge 2006: 125). Öffentliche Beratungen können insofern nicht immer einen rationalen Konsens zum Ziel haben, sondern müssen vor allem zur Klärung der vorliegenden Interessen beitragen und einen Weg zur Bearbeitung der daraus womöglich resultierenden Konflikte anbieten: „When interests or values conflict irreconcilably, deliberation ideally ends not in consensus but in a clarification of conflict and a structuring of disagreement, which sets the stage for a decision by non-deliberative methods, such as aggregation through the vote“ (Mansbridge 2015: 38). Damit tritt Jane Mansbridge für ein komplementäres Verhältnis zwischen deliberativen (konsensualen) und nicht-deliberativen (aggregativen) Mechanismen der Entscheidungsfindung ein, d.h. beide Mechanismen sollen sich in Bezug auf öffentliche Entscheidungen nicht konkurrierend gegenüberstehen, sondern sich gegenseitig ergänzen (Mansbridge et al. 2010: 64). Zwar können die verschiedenen Akteure einer politischen Gemeinschaft zunächst versuchen, nur über das Mittel der Überzeugung zu konsensualen Ergebnissen zu gelangen. Wenn dies aber aufgrund von unlösbaren Meinungs- und Interessenkonflikten zwischen ihnen unmöglich ist, dann sollten sie auf aggregative Entscheidungsmechanismen, wie z.B. Abstimmungen durch Wahlen, zurückgreifen, um dadurch einigermaßen akzeptable Ergebnisse zu erreichen.
4. Der Maßstab des epistemischen Wertes und der substantiven Balance (epistemic value and substantive balance) geht von der Grundannahme aus, dass eine größere Menge an Individuen auch mehr Informationen generiert und dadurch das kollektive Wissen in einer politischen Gemeinschaft verbessern kann. Die Aufgabe guter Deliberation kann demnach darin erkannt werden, die wichtigen Fakten und Sichtweisen in Bezug auf ein relevantes politisches Thema hervorzubringen, mit einzubeziehen und zu einem wechselseitigen Übereinkommen oder zu einer guten Entscheidung weiter zu verarbeiten: „A deliberation of high quality will bring out and process well the important facts and perspectives needed for greater mutual understanding or a good decision“ (Mansbridge 2015: 39). Das epistemische Ziel einer Verbesserung des Informationsstandes und der Qualität des politischen Prozesses ist dabei unauflöslich mit dem egalitären Ziel einer möglichst gleichen Einbeziehung der Überlegungen aller politischen Akteure verbunden: „To the degree possible, good deliberation should take account of considerations on all sides of the relevant issues“ (Mansbridge 2015: 39). In diesem Sinne haben gute Deliberationen eine epistemische Funktion zu erfüllen.
5. In Bezug auf den Maßstab der gleichen Möglichkeit und Inklusion (equal opportunity and inclusion) geht Mansbridge von der Grundannahme aus, dass Ungleichheiten in jedem sozialen System entstehen, unabhängig davon welche Ideologie darin verfolgt wird (Williams 2012: 799). Wenn sich Ungleichheiten in politischen Gemeinschaften aber nie ganz eliminieren lassen, dann kann das egalitäre Leitziel öffentlicher Deliberationen auch nicht darin liegen, eine gleiche Partizipation im Sinne einer vollkommen gleichen Machtverteilung zwischen allen Beteiligten zu erreichen. Trotzdem ist mit einer guten Deliberation prinzipiell der Anspruch verbunden, dass sie allen Personen, die von einer Entscheidung betroffen sind, zumindest die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu politischem Einfluss einräumt (Mansbridge 2015: 37). In der politikwissenschaftlichen Debatte ist höchst umstritten, wie das Kriterium der Inklusion genau auszulegen ist. Während in der klassisch-deliberativen Demokratietheorie weitgehend Einigkeit darüber herrschte, dass nur Personen, die ihren legalen Bürgerstatus innehaben, zu den Beteiligten öffentlicher Deliberationen zählen sollten, ist diese Interpretation stark in die Kritik geraten, weil damit Personenkreise, wie z.B. Kinder, Jugendliche, Behinderte, Migranten und Staatenlose von vorne herein von der Teilnahme an öffentlichen Deliberationen ausgeschlossen wären. Deshalb wird zurzeit eine Erweiterung auf alle möglichen Personen, die von einer Entscheidung betroffen sind, diskutiert, wobei meist unklar bleibt, wie dieses Kriterium im Einzelfall in der politischen Praxis umgesetzt werden sollte (Mansbridge 2015: 37). Nach dem Maßstab der gleichen Möglichkeit und Inklusion sollen Deliberationen möglichst die folgende politische Funktion erfüllen: „A deliberative system becomes democratic by including multiple and plural voices, interests, concerns, and claims on the basis of feasible equality“ (Mansbridge 2015: 43).
Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass Mansbridge die genannten normativen Maßstäbe für gute öffentliche Deliberationen als regulative Ideale begreift. Ein regulatives Ideal ist ein Ideal, welches in vollem Umfang zwar nicht zu erreichen ist, das man aber dennoch so gut wie möglich zu erreichen versuchen sollte (Mansbridge 2015: 32).[41] Regulative Ideale können in vollem Umfang aus praktischen Gründen unerreichbar sein. Zum Beispiel können weder das Ideal der Machtfreiheit noch das Ideal einer absoluten Gleichheit im Sinne einer gleichen Machtverteilung zwischen den Beteiligten in öffentlichen Deliberationen jemals verwirklicht werden, weil Gesellschaften immer von asymmetrischen Machtverhältnissen und Ungleichheiten geprägt sind. Regulative Ideale können unter bestimmten Umständen aber auch unerreichbar sein, wenn sie in Konflikt mit anderen Idealen geraten, was nicht selten vorkommt. So stehen in der Politik und der politischen Theorie z.B. die Ideale der Freiheit und Gleichheit traditionell in einem konfliktreichen Spannungsverhältnis zueinander (Mansbridge 2015: 32–33). In Bezug auf Deliberationen kann das Ideal der Abwesenheit von zwingender Macht z.B. immer dann nicht aufrecht gehalten werden, wenn unlösbare Konflikte auftreten und die öffentlichen Beratungsprozesse dennoch eine abschließende und zwingende Entscheidung verlangen. Öffentliche Deliberationen und der demokratische Prozess können die fünf formulierten normativen Maßstäbe insofern niemals alle vollständig erfüllen, weil dies in Bezug auf die politische Praxis unmöglich wäre. Dennoch können und sollten sie die regulativen Ideale nach der Ansicht von Mansbridge so gut wie möglich erfüllen. In diesem Zusammenhang drängt sich allerdings die Frage auf, wie ein mehr oder weniger guter öffentlicher Deliberationsprozess genau realisiert werden sollte und welche Rolle darin die deliberativen und aggregativen Entscheidungsmechanismen eigentlich übernehmen.
In der politischen Praxis haben alle modernen Demokratien auf nationaler Ebene einen Mix aus konsensualen und aggregativen Formen der Entscheidungsfindung etabliert, der eine gewisse Flexibilität bezogen auf verschiedene politische Situationen ermöglicht: „In some instances a group rightly tries to deliberate to consensus. In others that group, recognizing the endurance of fundamental conflicts, rightly negotiates a fair bargain or adopts some procedures such as proportional outcomes or majority rule to reach an authoritative decision” (Mansbridge 2006: 116–117). Wenn in Bezug auf eine politische Angelegenheit sowohl gemeinsame als auch konfligierende Meinungen und Interessen zwischen den Deliberationsteilnehmern gemischt vorhanden sind, dann kann und sollte der demokratische Prozess insgesamt vier Phasen durchlaufen: 1. pre-deliberation, 2. full-scale-deliberation, 3. negotiation, 4. fair aggregation (Mansbridge 2006: 117–125).
1. In der ersten Phase der pre-deliberation oder der Sitzung der Gleichgesinnten (caucus of the likeminded) beginnen die Individuen, die in einem Konflikt gemeinsame Interessen haben oder diese entwickeln könnten, untereinander zu reden, um ihre wechselseitigen Interessen besser nachzuvollziehen (Mansbridge 2006: 117). Besonders Mitglieder von untergeordneten Gruppen müssen häufig in geschützten Räumen (safe spaces) oder in Enklaven (enclaves) zusammenkommen, um gegenhegemoniale Ideen und Einsichten über ihre wechselseitigen Interessen zu entwickeln und damit die konventionellen Sichtweisen und Vorurteile innerhalb der dominanten Gesellschaft anzugreifen. Aber auch Mitglieder der dominanten Gesellschaft müssen sich häufig in Untergruppen zusammensetzen, um ihre gemeinsamen Interessen, Meinungen und Forderungen für die große Deliberationsphase herauszufinden und zu artikulieren (Mansbridge 2006: 117–118).
2. In der zweiten Phase der full-scale-deliberation treten Individuen mit gleichen und konfligierenden Interessen in die Diskussion miteinander. Die besten Diskussionen klären Konflikte und Gemeinsamkeiten zwischen den Beteiligten und schmieden womöglich dort echte Gemeinsamkeiten, wo vorher keine existierten. Weniger erfolgreiche Deliberationen verschleiern hingegen die Umrisse vorliegender Konflikte durch Dynamiken, die entweder Feindseligkeiten zwischen den Beteiligten verschärfen oder aber falsche Gemeinschaft befördern, indem z.B. vorliegende Interessenkonflikte zugunsten eines angeblichen Allgemeinwohls zum Schweigen gebracht werden (Mansbridge 2006: 118). Insgesamt unterscheidet Mansbridge zwischen vier Formen der kommunikativen Übereinkunft, in denen jeweils keine zwingende Macht zum Einsatz kommt und durch die Ergebnisse produziert werden, die alle Deliberationsteilnehmer freiwillig als richtig oder zumindest als fair akzeptieren können (Mansbridge 2009: 11–20; Mansbridge et al. 2010: 70-72).[42] Die erste Form der kommunikativen Übereinstimmung (convergence) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Beteiligten zu einem Ergebnis auf Basis der gleichen Begründung gelangen, ohne dass zwischen ihnen zu Beginn überhaupt ein signifikanter Konflikt in ihren Meinungen oder Interessen vorlag: „The participants bring together facts and insights from their various sources of information, and after deliberation converge on one option as the best for all“ (Mansbridge et al. 2010: 70). Politik notwendig auf Konflikt festzulegen, würde demnach die Vielfalt und Komplexität politischer Prozesse leugnen, in denen kollektive Entscheidungen häufig auch einen relativ konfliktfreien Charakter annehmen können: „One member may make a good suggestion to solve a common problem, one or two others suggest modifications, and the group reach agreement“ (Mansbridge 2009: 11). Die zweite Form der kommunikativen Übereinstimmung (incompletely theorized agreement) beginnt mit konfligierenden Meinungen über das Gemeinwohl und endet mit einem Einverständnis über ein Ergebnis, das die Teilnehmer jedoch verschieden begründen: „Incompletely theorized agreements do not fulfill the demands of the criterion of mutual justification ‘all the way down’. By definition such agreements leave certain issues unresolved“ (Mansbridge et al. 2010: 71). In der politischen Praxis kann es für politische Gruppen oder Bündnisse strategisch klüger sein, sich primär auf ihre Gemeinsamkeiten zu fokussieren und die Differenzen in Bezug auf ihre Begründungen außen vor zu lassen oder sich in ihrer gemeinsamen Opposition gegen einen äußeren Feind zu stellen (Mansbridge 2006: 118).[43]
3. Wenn eine Gruppe während der zweiten Deliberationsphase herausfindet, dass die vorliegenden Konflikte nicht geschlichtet oder zu einem Gemeinwohl subsumiert werden können, kann sie zur dritten Verhandlungsphase übergehen (Mansbridge 2006: 119).[44] Die dritte Form der kommunikativen Übereinstimmung (integrated negotiation) ist sehr wichtig für die dritte Verhandlungsphase, weil damit integrierte Lösungen bzw. “Win-Win“-Lösungen ermittelt werden können. Integrierte Verhandlungen beginnen, wie schon die zweite Form der kommunikativen Übereinstimmung, mit Konflikt und enden mit einer Übereinstimmung aus unterschiedlichen Gründen, wobei es um die Lösung von scheinbar vorliegenden Interessenkonflikten geht (Mansbridge et al. 2010: 71). Um zu verdeutlichen, was genau integrierte Lösungen sind, bezieht sich Mansbridge auf ein Beispiel, in dem eine Frau das Fenster in einer Bibliothek schließen möchte, um Lärm und Zugluft zu vermeiden, aber ein Mann dasselbe Fenster lieber geöffnet haben möchte, um frische Luft zu bekommen. Die integrierte Lösung liegt in diesem Fall darin, das Fenster zwar zu schließen, dafür aber ein Fenster im nächstgelegenen Raum zu öffnen, um damit beiden Parteien zu geben, was sie wollen (Mansbridge 2009: 15).[45] Um integrative Lösungen zu erreichen, bedarf es viel Überlegung, denn beide Parteien müssen sich von ihren konfligierenden, oberflächlichen Präferenzen (Fenster zu/Fenster auf) zu ihren übereinstimmenden, tieferen Präferenzen (Frischluft/keine Zugluft und kein Lärm) bewegen. Zudem müssen sie eine Lösung finden, die die tieferen Präferenzen beider Parteien befriedigt, aber ursprünglich nicht in ihrem Denken vorhanden war (Mansbridge 2009: 16). Dies ist nur dann möglich, wenn beide Parteien die Aspekte der Verhandlung unterschiedlich bewerten und eine alternative Lösung herausfinden, welche für beide einen klaren Mehrwert darstellt: „Integrated solutions are possible only when the parties have different valuations of the different aspects of the negotiation and can discover a way of exploiting those different valuations for a joint gain“ (Mansbridge et al. 2010: 71). Die vierte Form der kommunikativen Übereinstimmung (fully cooperative distributive negotiation) nimmt auch einen wichtigen Stellenwert für die dritte Verhandlungsphase ein, weil damit kollektive Handlungsprobleme, die in den Sozialwissenschaften häufig als Prisoners’ Dilemma diskutiert werden, potenziell zu lösen sind (Mansbridge 2009: 20–25).[46] In vollständig kooperativen, distributiven Verhandlungen beginnen die Beteiligten mit konfligierenden Interessen und einigen sich zum Ende auf einen Kompromiss bzw. eine distributive Vereinbarung, die alle als fair anerkennen können (Mansbridge et al. 2010: 71–72). Der Unterschied zwischen integrativen und distributiven Verhandlungen besteht darin, dass integrative Verhandlungen keinen Kompromiss zwischen den Parteien verlangen, aber distributive Verhandlungen gerade auf einen solchen abzielen (Mansbridge 2009: 18). Obwohl die Parteien demnach eine distributive Vereinbarung erzielen, die besser für sie ist, als der Status quo und die anderen verfügbaren Alternativen, müssen sie dafür auch ein Teil dessen, was in ihrem Eigeninteresse liegt, aufgeben (Mansbridge et al. 2010: 72). Neben der Bereitschaft zum Kompromiss wird auch eine vollständige Kooperationsbereitschaft zwischen den Parteien verlangt. Zu diesem Zweck sei es wichtig, dass beide Seiten sich gegenseitig keine wichtigen Informationen vorenthalten und mit maximaler Ehrlichkeit agieren. In kooperativen, distributiven Verhandlungen sind also zwei Dinge wichtig: Einerseits geht es darum, das Gemeinwohl der geschlossenen Einheit als das jeweils eigene Wohl zu begreifen, was nur durch ausreichend Empathie und Solidarität gelingen kann. Andererseits geht es auch darum, die individuellen Eigeninteressen mit in die Verhandlung einzubeziehen und sie nicht einfach zu ignorieren (Mansbridge 2009: 18). Ob faire und effektive Lösungen für kollektive Handlungsprobleme generiert werden können, hängt demnach davon ab, inwieweit es einer politischen Gemeinschaft gelingt, ihre kollektiven Ziele in Einklang mit den vorliegenden Eigeninteressen ihrer jeweiligen Mitglieder zu bringen. In diesem Sinne ist es hilfreich, die individuellen Anreizstrukturen durch faire Kompromisse derart zu verändern, dass sich das kooperative Handeln nach dem Gemeinwohl auch individuell für die Mitglieder der Gemeinschaft auszahlt (Mansbridge 2009: 21). Kollektive Handlungsprobleme durch distributive Vereinbarungen zu lösen, ist demnach nicht nur für Kleingruppen wichtig, sondern stellt das Tagesgeschäft der nationalen Politik und der internationalen Beziehungen dar. Man denke hier z.B. an die internationalen Bemühungen, um den Klimawandel zu stoppen.[47] Entsprechend zählt die Frage danach, wie auf nationaler und supranationaler Ebene der Politik genügend legitimer Zwang in Form von Sanktionen ausgeübt werden kann, um positive oder negative Anreize zu schaffen und dadurch kollektive Handlungsprobleme zu lösen, für Mansbridge (2014) zu den Schlüsselfragen der Politikwissenschaft.[48]
4. Manchmal wird all das Gerede in der Welt (all the talk in the world) keine Einigung hervorbringen, auch nicht durch Deliberation, Verhandlung oder Bargaining. In diesen Fällen, in denen sich ein unauflöslicher Konflikt zwischen den Teilnehmern manifestiert hat, macht es Sinn, die Deliberation für beendet zu erklären und zu einer letzten Phase der fair aggregation vorzudringen (Mansbridge 2006: 123).[49] Die Mehrheitsregel ist die meist verbreitete Prozedur der Aggregation von konfligierenden Meinungen oder Interessen. Dabei hänge die Legitimität der Mehrheitsregel allerdings sehr stark von einer politisch-ökonomischen Struktur ab, die es Individuen und Gruppen ermöglicht, in Bezug auf manche Themen zu gewinnen und in Bezug auf andere Themen zu verlieren. Dort wo Individuen und Gruppen aufgrund ihrer biologischen, ethnischen und/oder religiösen Zugehörigkeit hingegen systematisch zu einer unterdrückten Minderheit oder Mehrheit degradiert würden und keine relevante Entscheidungsmacht besäßen, könne die Mehrheitsregel demnach keine Legitimität beanspruchen (Mansbridge 2006: 123–124). Wenn Interessen in einem unauflöslichen Konflikt zueinanderstehen, habe die faire Aggregation durch die Wahl den normativen Vorteil, den vorliegenden Konflikt explizit werden zu lassen und zeitweilig in einer Art und Weise zu lösen, die das Prinzip der individuellen politischen Gleichheit zur Geltung bringt (Mansbridge 2006: 124). Natürlich sind die Ideale der politischen Gleichheit und Freiheit durch keinen Staat vollständig erfüllbar und als regulative Ideale zu verstehen. Deshalb kann keine durch die Mehrheitsregel getroffene Entscheidung jemals vollkommen legitim sein. Dennoch können Mehrheitsentscheidungen häufig Ergebnisse produzieren, die legitimer sind, als wenn sie durch einen deliberativen Konsens zustande gekommen wären (Mansbridge 2006: 124–125). Aggregative Entscheidungsmechanismen haben gegenüber deliberativen Entscheidungsmechanismen darüber hinaus den pragmatischen Vorteil, dass sie den politischen Prozess trotz unauflöslicher Meinungsverschiedenheiten und Interessenkonflikte zwischen den Akteuren einer politischen Gemeinschaft überhaupt zu einem Ende bringen können.
Nach den bisherigen Ausführungen dürfte nun das Rollenverständnis unkonventioneller Partizipation nach dem pragmatischen Demokratiemodell von Jane Mansbridge klar geworden sein. Politische Beteiligung sollte auch ihrer Meinung nach über die Mitarbeit in Parteien und die turnusmäßigen Wahlen von politischen Repräsentanten hinausgehen und sich auf die öffentlichen Beratungs- und Verhandlungsprozesse (Deliberationen) im Voraus öffentlicher Entscheidungen erstrecken. Repräsentative Demokratien und ihre aggregativen Entscheidungsmechanismen sollten demnach durchaus durch unkonventionelle Partizipation und deliberative Entscheidungsmechanismen ergänzt werden. Im Gegensatz zur klassisch-deliberativen Demokratietheorie von Jürgen Habermas dienen öffentliche Deliberationen laut Mansbridge aber keinesfalls dazu, die Eigeninteressen aus der Diskussion herauszuhalten und Meinungsunterschiede nach dem Diskursprinzip zu allgemeingültigen, öffentlichen Meinungen weiter zu verarbeiten, die dann die Basis für öffentliche Entscheidungen darstellen. Auch müssen die öffentlichen Meinungs- und Willensbildungsprozesse nicht zwingend, wie durch das agonistische Demokratiemodell von Chantal Mouffe impliziert, auf unlösbare und respektvoll ausgetragene Konflikte hinauslaufen. Vielmehr dienen öffentliche Deliberationen laut Mansbridge dazu, dass die unterschiedlichen Akteure einer politischen Gemeinschaft in einem dialogischen Kommunikationsprozess selbst herausfinden, welches ihre Meinungen und Interessen in Bezug auf ein politisches Thema sind und ob sich daraus Gemeinsamkeiten oder aber Konflikte zwischen ihnen ergeben. Darüber hinaus zeigt Mansbridge mit ihrem Vier-Phasen-Modell konkrete Möglichkeiten auf, wie dies in Bezug auf die politische Praxis im Einzelnen gelingen kann. Demnach können die unterschiedlichen Akteure in einem mehrstufigen Deliberationsprozess zu wechselseitigen Übereinstimmungen, intergierten Lösungen oder aber fairen Kompromissen gelangen. Für den Fall, dass durch die Verhandlungen und selbst mithilfe des Bargaining keine Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien zustande kommt, hält das Modell die Phase der fairen Aggregation bereit, in der durch Abstimmungen nach dem Mehrheitsprinzip verbindliche, öffentliche Entscheidungen auch gegen den Willen einer Minderheit erzwungen werden können und der politische Prozess damit überhaupt zu einem, wenn auch meist nur vorläufigen, Ende gebracht werden kann. Mit ihrem pragmatischen Demokratiemodell verfolgt Jane Mansbridge einen wissenschaftstheoretischen Doppelanspruch: Zum einen geht es ihr in normativer Hinsicht darum, dass die nach dem Phasenmodell organisierten politischen Beratungs- und Verhandlungsprozesse die fünf Kriterien – 1. gegenseitiger Respekt, 2. Machtfreiheit, 3. Klärung der Interessen, 4. epistemischer Wert und substantive Balance sowie 5. gleiche politische Einflussmöglichkeiten und Inklusion – so gut wie möglich erfüllen und die politische Gemeinschaft dadurch demokratisieren. Zum anderen geht es ihr in empirischer Hinsicht auch darum, den politischen Prozess nicht mit normativen Erwartungen zu überfrachten bzw. den Bezug zur politischen Praxis nicht zu verlieren.[50]
3 Unkonventionelle Beteiligung für eine selbstbestimmte städtische Zukunft? Über die Potenziale und Risiken von mehr Demokratie in der Stadtentwicklung
Gerade auf der lokalpolitischen Ebene nimmt unkonventionelle Partizipation gegenüber konventioneller Beteiligung einen zunehmend wichtigen Stellenwert ein: „Mehr denn je bringen sich Bürgerinnen und Bürger aktiv ein bei der Gestaltung ihres Lebensumfeldes wie etwa ihres Stadtviertels, ihrer Gemeinde oder Region, sie wollen bei Planungen und Entwicklungen im öffentlichen Bereich mitreden und Entscheidungen nicht allein politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten überlassen“ (Nanz/Fritsche 2012: 9). Der erhobene Anspruch auf mehr politische Selbstbestimmung von zivilgesellschaftlichen Akteuren steht dabei offenbar in einem Spannungsverhältnis zu den staatlichen Steuerungsabsichten und den privatwirtschaftlichen Interessen, die das Politikfeld der Stadtplanung und -entwicklung in der Regel auch heute noch weitgehend dominieren. Jedoch gibt es auch genügend Gegenbeispiele, die zeigen, dass das Leitziel einer selbstbestimmten städtischen Zukunft für die Zivilgesellschaft keine Utopie sein muss. Die Chronologie des Protestes gegen das verkehrspolitische und städtebauliche Großprojekt „Stuttgart 21“ zeigt, welche unvorhergesehenen Ergebnisse und Folgewirkungen in Bezug auf das Leitziel einer Demokratisierung der Stadtentwicklung und ‑planung durch Protestbewegungen von unten erzielt werden können. Die sowohl in Stuttgart als auch in anderen deutschen Großstädten aufkommenden Proteste gegen eine Bevormundung in Bezug auf die Entscheidungsprozesse zur Umsetzung von Bauprojekten haben auch von staatlicher Seite teilweise zu einer veränderten Haltung und Herangehensweise in Bezug auf die städtebaulichen Planungsprozesse beigetragen. Hiervon zeugt zumindest der unübersehbare Trend zugunsten mehr Bürgerbeteiligung und der Ausweitung direktdemokratischer Verfahren, die von oben eingeräumt werden. In dem Zusammenhang gilt es die Potenziale und Risiken der Veränderungen in Richtung eines aktivierenden Staates im Politikfeld der Stadtentwicklung aber auch kritisch zu hinterfragen, denn häufig genug scheinen in diesem Zusammenhang die formulierten Ansprüche und die tatsächliche Beteiligungspraxis relativ weit auseinanderzuklaffen. Ein vielversprechendes Beispiel für einen umfassenden Bürgerbeteiligungsansatz stellt dabei der Mannheimer Konversionsprozess dar, bei dem ehemaliges US-Militärgelände zurück in eine zivile Nutzung überführt wird und eine frühzeitige sowie dauerhafte Einbeziehung der Bürger von Seiten der politisch Verantwortlichen und der Verwaltung stattgefunden hat. Daher lohnt es sich, die Mannheimer Konversion zu untersuchen.
3.1 Der Versuch einer chronologischen Darstellung der Auseinandersetzung um das verkehrspolitische und städtebauliche Großprojekt „Stuttgart 21“
Die Protestereignisse gegen das Bauprojekt „Stuttgart 21“ haben in den letzten Jahren sowohl in den Medien als auch innerhalb des politikwissenschaftlichen Diskurses für eine starke Resonanz gesorgt und sind deshalb gut dokumentiert.[51] Um die Komplexität und Eigenheiten des politischen Prozesses im Fall von Stuttgart 21 wiederzugeben, wird dieser rückblickend in vier Phasen dargestellt.[52] Zunächst wird dabei die erste Phase der Projektentwicklung, politischen Durchsetzung und Finanzierung von S 21 in den Blick genommen, in der die Deutsche Bahn AG, die Bundesregierung, die baden-württembergische Landesregierung und die Stadt Stuttgart kooperativ zusammenagierten. Die zweite Phase beschreibt die Mobilisierung des Protestes gegen das Bauprojekt S 21, wobei der Protest mit der Eskalation des Konfliktes zwischen den Demonstranten und der Polizei am 30. September 2010, dem schwarzen Donnerstag, seinen vorläufigen dramatischen Höhepunkt erreichen sollte. Die dritte Phase wendet sich im Anschluss dem sog. „Schlichtungsverfahren“ unter der Leitung von Heiner Geißler (CDU) zu. Dieses Verfahren ermöglichte zwar einerseits den Dialog zwischen Befürwortern und Gegnern von Stuttgart 21, konnte andererseits aber die Erwartungen an eine faire Kompromissfindung zwischen beiden Konfliktparteien aus verschiedenen Gründen nicht erfüllen. Die vierte Phase widmet sich sowohl der Landtagswahl in Baden-Württemberg als auch der Volksabstimmung über das S 21-Kündigungsgesetz, die den Konflikt um S 21 zumindest vorläufig beenden und bis heute relativ nachhaltig befrieden konnten.
3.1.1 Erste Phase: Die Entwicklung, Durchsetzung und Finanzierung des Großbauprojektes Stuttgart 21 als politischer Alleingang zwischen Bahn, Bund, Land und Stadt
Wenn hier von „Stuttgart 21“ die Rede ist, sind damit zwei verschiedene Teilprojekte gemeint: Zum einen handelt es sich um das „Bahnprojekt Stuttgart 21“, mit dem die Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens zum Zweck einer Zugverkehrsanbindung der Innenstadt und des Stuttgarter Flughafens an die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm vorgenommen werden soll. Es geht dabei unter anderem um die umstrittene Umwandlung des Stuttgarter Kopfbahnhofes in einen unterirdischen Tiefbahnhof. Für das Bahnprojekt ist die Deutsche Bahn AG Bauherr und trägt die eigenwirtschaftliche Verantwortung. Zum anderen geht es bei S 21 auch um das Städtebauprojekt „Stuttgart 21/Rosenstein“ der Landeshauptstadt Stuttgart, bei dem die 100 Hektar freiwerdenden Gleisflächen zum Zweck der Stadtentwicklung neu genutzt, d.h. in öffentliche Parkanlagen und urbanes Bauland umgewandelt, werden (Stuckenbrock 2013: 15–16). Obwohl beide Teilprojekte durchaus verschiedene Aufgabenbereiche der Stadtplanung und -entwicklung umfassen, bedingen sie sich gegenseitig und sind daher nicht getrennt voneinander zu betrachten: „Zum einen können die neuen Stadtteile erst gebaut werden, wenn der neue Bahnknoten fertiggestellt ist, zum anderen kann das Schienenprojekt mit dem neuen Bahnknoten nur finanziert und realisiert werden, wenn das Städtebauprojekt als notwendige Bedingung mitgedacht wird“ (Stuckenbrock 2013: 49–50). Aber wie kam es überhaupt zur Verquickung zwischen dem Bahnprojekt und dem Städtebauprojekt?
Wie ein Blick auf die Phase der Projektentwicklung zwischen 1990–1994 zeigt, bildete sich ein politisches Bündnis bestehend aus Bahn, Bund, Land und Stadt heraus, das eine Weiterführung der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Stuttgart bis nach Ulm und München wegen der erwartbaren Fahrzeitersparnis für unbedingt notwendig erachtete. Die Zugverkehrsanbindung Stuttgarts an die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm markierte insofern von Anfang an das gemeinsame verkehrspolitische Ziel zwischen der Bahn und den politisch Verantwortlichen (Stuckenbrock 2013: 20–28). Umstritten war hingegen die Frage, wie diese Verkehrsanbindung vorgenommen werden sollte. Den Durchbruch in dieser Diskussion brachte 1990 ein Vorschlag von den drei Stadtplanern und Architekten Hansjörg Böhm, Christian Wendt und Klaus Gurk, die auf „die Möglichkeit der Verknüpfung von Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanung“ hinwiesen (Stuckenbrock 2013: 29). Ihr Vorschlag enthielt folgende drei Schritte: Erstens war der bestehende sechzehngleisige Kopfbahnhof durch einen achtgleisigen, unterirdischen und um 90 Grad gedrehten Durchgangsbahnhof zu ersetzen. Zweitens konnte die bahnbetrieblich nicht mehr genutzte oberirdische Gleisfläche von 100 Hektar städtebaulich entwickelt und anschließend veräußert werden. Drittens ließen sich die aufwendigen Umbaumaßnahmen in Bezug auf das Bahnprojekt S-21 teilweise durch die Verkaufserlöse aus den künftigen Gebäudewerten finanzieren (Stuckenbrock 2013: 33). Der Vorschlag stellte für die Bündnispartner (Bahn, Bund, Land, Stadt) eine integrierte Lösung dar, weil er einerseits die Umbaukosten für das Bahnprojekt S 21 zu verringern versprach und andererseits ungeahnte Möglichkeiten für die Stadtentwicklung im Innenstadtbereich Stuttgarts bereithielt (Gewerbe, Arbeitsplätze und Wohnraum). Außerdem versprach das Großbauprojekt aufgrund des hohen Investitionsvolumens, einen erheblichen volkswirtschaftlichen Nutzen für die Stadt und die gesamte Region zu erbringen.
Die politische Durchsetzung des S 21-Projektes verlief zunächst unproblematisch. Dem damaligen Bahnchef, Heinz Dürr, gelang es in informellen Gesprächen mit Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann, Ministerpräsident Erwin Teufel und Oberbürgermeister Manfred Rommel für eine breite politische Unterstützung bezüglich des Bauvorhabens zu sorgen (Stuckenbrock 2013: 35–36). Am 18.04.1994, in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Bahn und der politisch Verantwortlichen, wurde Stuttgart 21 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei hätten die Initiatoren eine „diebische Freude über ihren geglückten Überraschungscoup“ zu erkennen gegeben (Zielcke 2010a). Sie gingen davon aus, „ein für sich selbst sprechendes Vorhaben zu präsentieren und glaubten, für ihr effektives Zusammenwirken (...) besonderes Lob zu verdienen“ (Thaa 2015: 286). In der Folgezeit konnten die erforderlichen parlamentarischen Mehrheiten zugunsten einer politischen Umsetzung des Projektes erreicht werden. Im November 1995 wurde auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie eine erste Rahmenvereinbarung zwischen Bahn, Bund, Land und Stadt abgeschlossen, der auch „der Stuttgarter Gemeinderat nach gerade mal drei Wochen ohne größere parlamentarische Diskussion zustimmte“ (Thaa 2015: 287). Mit dieser Vereinbarung verpflichteten sich Bahn, Bund, Land und Stadt verbindlich zur Umsetzung von S 21 schon bevor die städtebauliche und finanzielle Planung dafür überhaupt begonnen hatte. Ab diesem Moment waren „rechtlich die entscheidenden Würfel gefallen, ohne dass zuvor eine öffentliche Auseinandersetzung über die Wünschbarkeit des Projektes oder denkbare Alternativen stattgefunden hätte“ (Thaa 2013: 3).
Obwohl die politische Entscheidung zugunsten von S 21 demnach also über die repräsentativen Kanäle zustande kam und daher Legalität beanspruchen konnte, war ihre Legitimität von Beginn an fragwürdig. Nicht zuletzt lag dies auch an dem undemokratischen Agieren der Projektbefürworter. Insbesondere fällt der Top-Down-Ansatz auf, mit dem die Befürworter ihr Vorhaben trotz der zunehmenden öffentlichen Kritik ohne jede Diskussion von oben nach unten durchsetzen wollten. Zu keinem Zeitpunkt ließen sie sich dabei auf die Argumente der Gegenseite ein. Vielmehr erkannten sie die Zivilgesellschaft nicht als beachtenswerten Dialog- und Verhandlungspartner in Bezug auf die Frage nach der Realisierung des Bauprojektes an. Nach der Beurteilung von Winfried Thaa (2015: 287–288.) erweist sich Stuttgart 21 „als Idealtypus eines großen Infrastrukturprojektes, das unter dem Primat ökonomischer Zielsetzungen zwischen Vertretern der Exekutive und der Wirtschaftseliten konzipiert, als alternativlose Modernisierung kommuniziert und unter weitgehender Vermeidung öffentlicher Auseinandersetzungen durch die Parlamente geschleust wird.“ Entsprechend wurde die Umwandlung des Kopfbahnhofes in einen Tiefbahnhof von den Projektbefürwortern mit dem verkehrspolitischen Argument gerechtfertigt, dass es sich dabei um eine „infrastrukturelle Notwendigkeit“ handeln würde, „ohne die die verkehrsmäßig ungünstig liegende Wirtschaftsregion den Anschluss an das europäische Fernverkehrsnetz zu verlieren drohe“ (Thaa 2013: 4). Mit dieser „Rhetorik der Alternativlosigkeit“ bürdeten die Befürworter dem Projekt vom ersten Tag an eine „absolutistische Ja/Nein Logik“ auf (Thaa 2013: 4; Zielcke 2010a). Was durch diese Argumentation der Befürworter verschleiert wurde, ist die Tatsache, dass eine Zugverkehrsanbindung Stuttgarts an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn durchaus mit dem Erhalt des Kopfbahnhofes kompatibel gewesen wäre: Ein Blick auf die frühe Projektentwicklungsphase zeigt sogar, dass der Bahnvorstand zunächst selbst die „K 21“-Variante (Anbindung mit Kopfbahnhof) gegenüber der „S 21“-Variante (Anbindung mit Tiefbahnhof) aufgrund ihrer besseren Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit bevorzugte (Stuckenbrock 2013: 31–32). Warum man die K 21-Variante nicht weiterverfolgte und warum man angesichts der Finanzierungs- und Legitimationsprobleme von S 21 später nicht nochmal darauf zurückgriff, bleibt rätselhaft. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang eine aktuelle Ermittlung der Ausstiegskosten für das Projekt Stuttgart 21 von der Vieregg-Rössler GmbH, die zum Ergebnis kommt, dass ein Abbruch des Bauprojektes und ein Umschwenken auf K 21 zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch um bis zu 5,9 Mrd. Euro kostengünstiger wäre als der Weiterbau (Vieregg-Rössler GmbH 2016: 18–19). Außerdem führte das Bündnis der Projektbefürworter das städtebauliche Argument ins Feld, dass sich durch die 100 Hektar frei werdenden Flächen eine einmalige Chance für die Neugestaltung des Stuttgarter Innenstadtbereichs bieten würde. Aber auch in Bezug auf das Städtebauprojekt S 21 war der Diskussions- und Gestaltungsspielraum von Anfang an begrenzt, weil sich die Stadt frühzeitig auf Bebauungspläne festlegte, „die der Bahn durch eine dichte Blockbebauung mit monofunktionalen Gebäuden für Büro- und Einkaufszentren einen hohen Grundstückserlös garantieren sollten“ (Thaa 2013: 4). Damit blieb auch die offene und gestalterische Seite des Stuttgart 21-Projektes der öffentlichen Diskussion entzogen und ökonomischen Zwängen unterworfen. Zwar wurde 1997 eine sogenannte offene Bürgerbeteiligung veranstaltet, die den Bürgern angeblich die Chance geben sollte, sich an der Planung zu beteiligen. Allerdings entpuppte sich die Veranstaltung als „eine Farce“, da über die verschiedenen Aspekte des Projektes schon entschieden war und die Beteiligung demnach „lediglich der nachträglichen Akzeptanzbeschaffung“ diente (Schlager 2010: 116–117). Zusammengefasst verhinderte das Primat ökonomischer Zielsetzungen innerhalb des Bündnisses der Befürworter, dass sie sich wichtige Fragen nach der Legitimität des Bauvorhabens überhaupt stellten: „Rechtfertigen wenige Minuten Zeitersparnis auf der Strecke Stuttgart-Ulm die Zerstörung eines einmaligen, in der Innenstadt gelegenen Parks? Ist die höhere Nahverkehrskapazität des alten Bahnhofes nicht wichtiger als die Beschleunigung auf den Fernstrecken? Braucht Stuttgart ein neues Büro- und Bankenviertel“ (Thaa 2013: 17)?
Die Finanzierungsgeschichte von Stuttgart 21 war durch „enorme Kostensteigerungen und finanzielle Ungereimtheiten“ geprägt, die in ähnlicher Weise aber auch schon bei anderen Großbauprojekten vorkamen (Thaa 2013: 4). Während die Bahn in ihrer Machbarkeitsstudie 1995 noch Kosten von umgerechnet ca. 2,45 Mrd. Euro für das Bauprojekt voraussagte, korrigierte sie ihre Kostenprognose danach sukzessive nach oben: 2001: 2,6 Mrd. €; 2007: 2,8 Mrd. €; 2009: 4,1 Mrd. € (Krüger 2012: 592, Abb. 2). Entsprechend sah der von Bahn, Bund, Land, Stadt, Region und Flughafen 2009 gemeinsam unterzeichnete Finanzierungsvertrag bereits einen Rahmen von insgesamt 4,526 Mrd. Euro vor (DB AG: 2016a). Obwohl der Vertrag bereits einen Risikopuffer für eventuelle Preissteigerungen enthielt, korrigierte der Bahnvorstand den Finanzierungsrahmen für das Stuttgart 21-Projekt im März 2013 nochmals auf 6,526 Mrd. Euro nach oben (DB AG: 2016a). In einem aktuellen und unabhängigen Gutachten von 2015 kommt die Vieregg-Rössler GmbH sogar auf eine Kostenprognose von bis zu 9,8 Mrd. Euro (Vieregg-Rössler GmbH 2015). Damit soll verdeutlicht werden, dass die realen Kosten für Stuttgart 21 heute immer noch nicht abschließend kalkulierbar sind, weil sie sich während der Bauphase tendenziell erhöhen. Der Verdacht einer gegenseitigen Vorteilnahme einzelner Akteure aus dem Lager der Projektbefürworter bestätigte sich gleich mehrfach: „Prominente Politiker und ihre Familienangehörige sind als Berater von Firmen oder Mitglieder von Stiftungen an der geplanten Verwertung der frei werdenden Innenstadtflächen beteiligt“ (Thaa 2013: 4). Die „außerordentlich hohe Bereitschaft der politisch Verantwortlichen, enorme Mittel in die Vorfinanzierung des Projektes zu investieren, anhaltende Unsicherheiten der Finanzierung hinzunehmen und immer wieder drastische Kostensteigerungen zu akzeptieren (...)“, lässt sich aber nicht allein dadurch erklären und verwundert insofern (Thaa 2013: 4). Wieviel Kooperationsbereitschaft die Politik der Bahn in den Verhandlungen um eine Kofinanzierung entgegen brachte, zeigt die Kostenverteilung im Finanzierungsvertrag von 2009: Von den darin vorgesehenen 4.526 Mio. Euro Kosten übernimmt die Bahn 1.747 Mio. Euro (57%), der Bund inklusive EU-Fördermittel 1.229 Mio. Euro (19%), das Land Baden-Württemberg 931 Mio. Euro (14%), die Stadt Stuttgart 292 Mio. Euro (5%), und der Flughafen Stuttgart und die Region Stuttgart zusammen 337 Mio. Euro (5%) (DB AG 2016b). Aufgrund der unkritischen Bereitschaft der politisch Verantwortlichen immense Steuermittel in die Kofinanzierung von S 21 zu investieren, verwundert es nicht, dass die Frage nach der Projektrealisierung trotz der bereits getroffenen Entscheidung und der Entpolitisierungsstrategie der Projektbefürworter von der Zivilgesellschaft zunehmend als öffentliche Angelegenheit wahrgenommen wurde. Als am 2.02.2010, und damit 15 Jahre nach der ersten Bekanntgabe des Bauvorhabens, der offizielle Baubeginn von S 21 von Ministerpräsident Günther Oettinger, Bundesminister Peter Ramsauer, Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster und Bahnchef Rüdiger Grube feierlich eingeleitet wurde, stellte dies den Anlass für teils heftige und langanhaltende Proteste dar (Stuckenbrock 2013: 41–42).
3.1.2 Zweite Phase: Der zivilgesellschaftliche Protest gegen das Großbauprojekt Stuttgart 21 und zugunsten einer selbstbestimmten städtischen Zukunft
Wirft man einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Widerstandes gegen S 21, lässt sich festhalten, dass dieser lange vor dem Baubeginn 2010 einsetzte und „es sich bei den Protesten gegen Stuttgart 21 um die Proteste eines auf Dauer mobilisierten Netzwerkes an Unterstützern“ handelte (Bebnowski 2013: 136). Den organisatorischen Kern dieses Netzwerkes bildete ein Dreierbündnis mit einer klaren Aufgabenverteilung: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) koordinierte ein Bündnis aus diversen Umweltschutzgruppen und war für juristische Belange und Verfahrensfragen zuständig. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) arbeitete mit dem Fahrgastverband pro Bahn an einer verkehrspolitischen Alternative zu Stuttgart 21, die den Namen „Kopfbahnhof 21“ (K 21) erhalten und zu einem zentralen Symbol des Widerstandes werden sollte. Nach ihrem Gegenvorschlag sollte der bestehende Kopfbahnhof modernisiert und durch den Ausbau der Gleisanlagen an die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm angebunden werden.[53] Dieser Schritt war wichtig für die Dynamik der Protestbewegung: „So war sie davor gefeit, bloß als Nein-Sager dazustehen. Vielmehr standen sich nun zwei Alternativen gegenüber und das Kürzel K 21 wurde zum Symbol für etwas Besseres und zu einem Ausdruck davon, dass die Protestbewegung weiß, was sie will“ (Ohme-Reinicke 2012: 94).
Die Bürgerinitiative „Leben in Stuttgart – Kein Stuttgart 21“ gründete sich bereits 1995 aus einer kleinen undogmatischen, linken Gruppierung, die vor allem auf die Demokratiedefizite bei der Planung und der politischen Durchsetzung des Bauprojektes aufmerksam machte. Die Initiative leistete erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit und sorgte dafür, dass weite Teile der Stuttgarter Zivilgesellschaft über die Nachteile und Risiken des Bauvorhabens aufgeklärt wurden (Bebnowski 2013: 134). Jedoch blieb der Widerstand in der frühen Phase zwischen 1995–2007 „zunächst auf kleine Kreise beschränkt“ und größere Proteste gab es kaum (Baumgarten/Rucht 2013: 111). Zu dieser Zeit beschränkten sich die Projektgegner noch „auf kritische Schriften, Einsprüche im Planfeststellungsverfahren und Unterschriftensammlungen“ (Baumgarten/Rucht 2013: 111). Die Ablehnung des Bürgerbegehrens 2007 stellte in dieser Hinsicht einen Wendepunkt dar (Ohme-Reinicke 2012: 94). Obwohl die Projektgegner in sechs Wochen mehr als 67.000 Unterschriften zugunsten eines Bürgerentscheids über den Ausstieg der Stadt aus den Bauverträgen sammelten, wurde ihr Vorstoß vom Verwaltungsgericht mit der Begründung abgelehnt, dass ein Bürgerbegehren gegen einen bereits vollzogenen Gemeinderats-beschluss ungültig sei, „da die Angelegenheit nicht mehr in dem vom Bürgerbegehren verfolgten Sinne entschieden werden kann“ (Thaa 2015: 288–289; Schlager 2010: 119). Die Ablehnung sorgte nachweislich für einen Mobilisierungsschub zugunsten der Protestbewegung (Baumgarten/Rucht 2013: 118). Im April 2007 gründeten die Projektgegner als Reaktion das Aktionsbündnis und veranstalteten bald darauf die erste Großdemonstration unter dem Motto: „Kopf hoch! Kein Stuttgart 21“ (Ohme-Reinicke 2012: 95). Dem Aktionsbündnis traten die Parteien Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und das Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS) bei. Ihre Beteiligung hatte für die Protestbewegung strategische Vor- und Nachteile und war deshalb nicht unumstritten: Einerseits konnten die Projektgegner auf die starken Mobilisierungsressourcen der Parteien zurückgreifen und im Falle entsprechender Wahlergebnisse auf eine parlamentarische Umsetzung ihrer außerparlamentarischen Forderungen hoffen. Andererseits bestand die Gefahr, dass die Protestbewegung aus wahltaktischen Gründen instrumentalisiert wird und dadurch ihre Spontaneität und Autonomie einbüßt (Schlager 2010: 128).
Eine besondere Rolle innerhalb des Aktionsbündnisses übernahmen die Parkschützer. Die Initiative gründete sich erst 2009 und verschrieb sich dem Ziel die Parkanlagen und Bäume im Schlossgarten zu schützen (Schlager 2010: 122). Viele Parkschützer waren in Umweltschutzgruppen wie Greenpeace aktiv gewesen und konnten ihre Erfahrungen und ihr Wissen in Bezug auf die Organisierung und Durchführung von Aktionen des zivilen Ungehorsams in die Protestbewegung einbringen (Ohme-Reinicke 2012: 97). In Bezug auf die Rekrutierung von Unterstützern und Aktivisten nutzten sie das Internet: Auf ihrer Webseite (www.parkschuetzer.de) konnten sich die Leute als Parkschützer registrieren und in abgestufter Form ihr Engagement bekunden. Vom bloßen Bekenntnis die drohenden Baumfällungen abzulehnen, über die Erklärung sich im Fall der Baumfällungen an den spontanen Protesten dagegen vor Ort zu beteiligen, bis hin zur Bereitschaft sich vor die anrückenden Baumfahrzeuge zu setzen oder an die Bäume zu ketten, waren drei Widerstandsstufen (grün, gelb, rot) wählbar (Schlager 2010: 123). Von besonderer Wichtigkeit waren die regelmäßig stattfindenden Blockadetrainings im Schlossgarten, mit denen die Parkschützer den Protestierenden die Möglichkeit boten, eine Aktionsform einzuüben, die für sie bis dahin unbekannt war (Schlager 2010: 123). Insgesamt wurde das Aktionsbündnis weniger als ein beschlussfassendes, sondern vielmehr als ein bündelndes, Gremium verstanden, weshalb die Erklärungen meistens von Einzelpersonen und nicht im Namen des gesamten Bündnisses erfolgten (Schlager 2010: 121). Diese relative Offenheit des Bündnisses der Projektgegner in Bezug auf verschiedene Begründungen und Protestmethoden bewirkte, dass sich im Zeitraum von 2007 bis 2010 immer mehr Unterstützer anschlossen und so letztlich eine vielfältige Protestbewegung entstand.
So differenziert, wie sich das Netzwerk der Projektgegner zusammensetzte, so vielfältig waren auch die Motive, die letztlich für die Proteste gegen S 21 ausschlaggebend waren. Im Folgenden werden trotzdem zwei Erklärungsversuche präsentiert: Zunächst lässt sich erstens festhalten, dass sich die Proteste gegen die mangelnde demokratische Legitimation des Bauprojektes richteten. Laut Umfragen gaben entsprechend die meisten Protestierenden Demokratiedefizite bei der Projektplanung und/oder Demokratiedefizite im Umgang mit den Projektgegnern als Begründung für ihren Protest an (Baumgarten/Rucht 2013: 109). Mit anderen Worten hätten sich die Projektgegner eine frühere Einbeziehung und Mitwirkung schon während der Planungsphase des Projektes und/oder zumindest mehr Responsivität in Bezug auf ihre kritischen Einwände von den Politikern gewünscht. Ihr Aufbegehren war damit kein Ausdruck von Politikverdrossenheit oder etwa gegen das repräsentative System gerichtet, sondern zielte auf eine Ergänzung der formaldemokratischen Verfahren durch dialogische und direkte Beteiligungsmöglichkeiten (Schlager 2010: 132). Die Forderung der Projektgegner nach mehr Demokratie bzw. nach mehr politischer Selbstbestimmung im Bereich der Stadtentwicklung stand von Beginn an in einem unauflöslichen Konflikt zu dem bereits beschriebenen Top-Down-Ansatz der Projektbefürworter bzw. ihrem autoritären Demokratieverständnis. Die fehlende Dialog- und Verhandlungsbereitschaft der Projektbefürworter und der Unmut „über die Missachtung der Kritik eines großen Teils der Bürger mag auch erklären, warum es in der Auseinandersetzung in Stuttgart zu einer ungewöhnlich starken Wir-Sie-Dichotomisierung kam“ (Thaa 2013: 6). Hiervon zeugen zumindest die gegen das Lager der Projektbefürworter verwendeten Parolen wie z.B. „Maultaschen Connection“, „Schwabenmafia“ oder schlicht „Lügenpack“ (Schlager 2010: 133, Thaa 2015: 291). Außerdem richteten sich die Proteste in Stuttgart gegen die Rhetorik der Alternativlosigkeit und das Primat ökonomischer Zielsetzungen in der Stadtentwicklungspolitik. Mit ihrem Kopfbahnhof 21-Entwurf konterkarierten die Projektgegner die Rhetorik der Alternativlosigkeit von Seiten der politisch Verantwortlichen: Nicht nur gab es offenbar doch eine realisierbare Alternative zu Stuttgart 21, sondern war K 21 nach Meinung der Protestierenden auch kostengünstiger, sozial verträglicher, verkehrlich effizienter und ökologisch nachhaltiger. Entsprechend wurden erstens die hohen Kosten des Stuttgart 21-Projektes, zweitens die einseitigen Profite der Banken und Baukonzerne, drittens verkehrliche Aspekte wie z.B. die geringere Kapazität des achtgleisigen Durchgangsbahnhofes und viertens ökologische Aspekte wie z.B. geologische Gefahren beim Tunnelbau oder die Beeinträchtigung von Mineralwasservorkommen als Hauptargumente für die Proteste genannt (Baumgarten/Rucht 2013: 109). Dass diese kritischen Einwände von den politisch Verantwortlichen ignoriert wurden, verstärkte bei den Projektgegnern den Eindruck, dass die Politiker bewusst an einer fehlgeleiteten Stadtentwicklungspolitik festhielten, die sich primär an den Interessen des Kapitals und kaum an den Interessen der Stadteinwohner orientiert: „Für viele ist es nicht mehr zu akzeptieren, dass die Politik Projekte durchsetzt, die sich primär an den Interessen des Kapitals ausrichten. Stuttgart 21 wird als verkehrlich untaugliches Projekt eingeschätzt, das nur deswegen gebaut wird, weil die freiwerdenden Flächen prächtige Spekulationsobjekte für Investoren bieten“ (Schlager 2010: 134). Göschel (2013) hat die Auseinandersetzung in Stuttgart in diesem Zusammenhang als einen kulturellen Konflikt zwischen den postindustriellen Wertvorstellungen der Projektgegner und den industriellen Wertvorstellungen der Projektbefürworter interpretiert: Während es den Gegnern demnach um den Erhalt ihrer unmittelbaren Lebenswelt und der darin durch persönliche Erfahrungen positiv besetzten Orte, wie z.B. den als Wahrzeichen der Stadt bekannten Kopfbahnhof und den zum Zwecke der Freizeitgestaltung und Erholung vielfach genutzten Schlossgarten, ging, waren für die Befürworter ökonomische Ziele, wie z.B. die Beförderung von Kapitalverwertungsinteressen, die Beschleunigung des Verkehrflusses und des Lebensalltags der Menschen sowie das durch den Bau generierte Wirtschaftswachstum in der Region Stuttgart, handlungsleitend (Göschel 2013). Insgesamt können die Stuttgart 21-Proteste demnach als „Kampf gegen die Ökonomisierung der Stadt und gegen die Beschleunigung des Lebens“ verstanden werden, mit dem die Projektgegner eine andere Stadtentwicklungspolitik einforderten, die wieder stärker die Interessen und Meinungen der Stadtbewohner in den Mittelpunkt stellt (Schlager 2010: 135). Wie dieser neue Politikansatz genau aussehen könnte, war den meisten Protestierenden dabei zunächst selbst weitgehend unklar. In jedem Fall aber orientierte sich ihr Vorstoß zugunsten einer gemeinschaftlichen Stadtentwicklung an folgenden Leitfragen: „Wie wollen wir hier leben? Wie können wir uns die Stadt (neu) aneignen? Was heißt Recht auf Stadt konkret“ (Schlager 2010: 135)? Nach der hier entwickelten Interpretation gingen die Menschen im Sommer 2010 nicht nur gegen das Bauprojekt Stuttgart 21, sondern vor allem auch zugunsten einer selbstbestimmten städtischen Zukunft, auf die Straßen.
Zum viel beachteten Kennzeichen der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 wurden die „in ihrer Regelmäßigkeit und Dauer beispiellosen Straßenproteste“ (Thaa 2015: 289). Nachdem die Abrissarbeiten am nördlichen Seitenflügel des Bahnhofes im August 2010 begannen und sich der Konflikt deshalb weiter zuspitzte, gingen montags und samstags regelmäßig zwischen 10.000 und 80.000 Menschen auf die Straße (Schlager 2010: 122; Thaa 2015: 289). Neben den für deutsche Verhältnisse einzigartigen Straßenprotesten, waren auch andere Aktionsformen charakteristisch für die Protestbewegung in Stuttgart: Zu erwähnen sind z.B. die sogenannten Schwabenstreiche. Dabei handelte es sich um eine Aktionsform, bei der die Projektgegner täglich um 19 Uhr mittels Topfschlagen, Trillerpfeifen o.ä. für eine Minute lang Lärm machten (Baumgarten/Rucht 2013: 110; Thaa 2015: 289). Im Aufruf zum ersten Schwabenstreich von Walter Sittler und Volker Lösch heißt es: „Das Schöne daran ist: Jeder und Jede kann mitmachen, egal wo er oder sie gerade sitzt, steht, fährt oder geht, egal ob jung oder alt. Und täglich können neue Protestierer dazukommen“ (Sittler/Lösch, zit. nach Schlager 2010: 124). Tatsächlich verbreitete sich die Protestform der Schwabenstreiche über die Stadt Stuttgart hinaus und wurde bald auch in Baden-Württemberg, im übrigen Bundesgebiet und sogar im Ausland praktiziert (Baumgarten/Rucht 2013: 110). Auch ziviler Ungehorsam wurde von Teilen der Bewegung durchgeführt. Zu den häufigsten Regelverletzungen zählten „Spontandemonstrationen, Besetzungen von Teilen des Bahnhofes, Straßenblockaden und Behinderungen der Bauarbeiten“ (Baumgarten/Rucht 2013: 111). Diese Aktionen blieben meist friedlich und wurden innerhalb des Aktionsbündnisses von der überwiegenden Mehrheit als legitime Protestmethode akzeptiert (Baumgarten/Rucht 2013: 112).
Die Proteste im Sommer 2010 wurden durch viele kulturelle Beiträge unterstützt. Zum Beispiel fand ergänzend zu den Demonstrationen und Kundgebungen regelmäßig ein Kulturmittwoch statt, zu dem Autoren aus ihren Büchern lasen, Experten über das Bauprojekt diskutierten und Musik gespielt wurde. Danach wurden spät abends im Freien gelegentlich Filme über ehemalige Auseinandersetzungen der Anti-Atomkraftbewegung in Whyl oder Wackersdorf gezeigt (Ohme-Reinicke 2012: 98–99). Ein weiteres Beispiel stellte der Bauzaun dar, der am 30. Juli 2010 errichtet wurde und den Projektgegnern bald als künstlerisches Medium und Treffpunkt diente: „Die Menschen hängten dort über eine Länge von 80 Metern witzige, kreative Bilder, Sprüche, Comics und alle möglichen Symbole auf. Der Platz rund um den Nordflügel des Bahnhofes wurde nun ein allgemeiner Treffpunkt, an dem stets viele Dutzend Menschen, Projektgegner sowie interessierte Reisende zu treffen waren. Hier war ein öffentlicher Ort des Protestes entstanden“ (Ohme-Reinicke 2012: 99). In der Protestbewegung war eine vergleichsweise hohe Expertise vorhanden, die z.B. in den regelmäßigen Fachvorträgen „zu architektonischen Aspekten des Bahnhofes, zu ökologischen und geologischen Gefahren des Umbaus etc.“ zum Ausdruck kam (Schlager 2010: 121). In diesem Sinne ähnelten die S21-Proteste „manchmal einer Volksuni unter freiem Himmel“ (Schlager 2010: 121).[54]
Als am 30. September 2010 die ersten Bäume im Schlossgarten gefällt werden sollten, eskalierte der Konflikt zwischen der Polizei und den Projektgegnern. Es waren an jenem Tag die Parkschützer, die die geplanten Baumfällarbeiten antizipierten und durch ihren SMS-Alarm über 1000 Aktivisten mobilisierten. Unterstützt wurden sie unter anderem auch von Schülern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die im Stadtzentrum an einer angemeldeten Demonstration teilnahmen (Ohme-Reinicke 2012: 103). Nachdem immer mehr Menschen in den Park strömten, um das Fällen der Bäume aktiv und z.T. auch regelwidrig zu verhindern, ging die Polizei zum ersten Mal in den Auseinandersetzungen mit äußerster Brutalität gegen die Demonstranten vor. Den Einsatz fasst Schlager (2010: 124) zusammen: „Mit Wasserwerfern, Pfefferspray, Reizgas und Schlagstöcken werden die Menschen auseinandergetrieben. Am Rande stehende Personen werden ohne polizeitaktische Notwendigkeit zusammengeprügelt. Es gibt über 400 Verletzte. Vier Personen werden durch die Wasserwerfer so schwer an den Augen verletzt, dass sie im Krankenhaus operiert werden müssen, ein Demonstrant verliert sein Augenlicht.“ Ob es sich bei dem Einsatz um ein strategisches Manöver zur Abschreckung und Spaltung der Bewegung oder um eine unkontrollierte Überreaktion der Polizei handelte, lässt sich rückblickend kaum feststellen. In jedem Fall aber gelang es damit nicht, die Proteste zu stoppen. Im Gegenteil demonstrierten am 1. Oktober 2010 mehr Menschen, wie jemals zuvor, gegen Stuttgart 21: Die Schätzungen reichen von unter 100.000 bis zu ungefähr 150.000 Teilnehmern (Kersting/Woyke 2012: 93; Ohme-Reinicke 2012: 105). Durch die beschriebenen Ereignisse am schwarzen Donnerstag gerieten der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus und die CDU-Landesregierung in die Kritik und nach Umfragen drohte ihnen eine deutliche Niederlage zur nächsten Landtagswahl. Um den politischen Schaden abzuwenden, war Ministerpräsident Mappus nun um eine Entschärfung des Konflikts bemüht, ordnete einen vorläufigen Baustopp am Nordflügel des Bahnhofes an und schlug Schlichtungsgespräche zwischen den Projektgegnern und -befürwortern unter der Leitung von Heiner Geißler vor (Kersting/Woyke 2012: 93).[55]
3.1.3 Dritte Phase: Die Scheinlösung des Konfliktes um Stuttgart 21 durch das sogenannte Schlichtungsverfahren unter der Leitung von Heiner Geißler
Die Idee eine sogenannte Schlichtung zwischen den Projektbefürwortern und -gegnern durchzuführen, entstand aufgrund der bereits beschriebenen Eskalation des Konfliktes: Beide Konfliktparteien waren sich aufgrund der Vorkommnisse vom 30.09.2010 einig, dass eine Aussprache und Vermittlung zwischen ihnen zur Beruhigung der aufgeheizten Situation beitragen könnte (Thaa 2015: 291–292). Innerhalb des Aktionsbündnisses sahen dies nur die Parkschützer anders und lehnten eine Teilnahme an den Gesprächen mit den Projektbefürwortern weiterhin ab (Thaa 2015: 292). Zwischen dem 22. Oktober und dem 30. November 2010 fanden sich die Projektbefürworter und -gegner zu insgesamt acht Sitzungsterminen zusammen, um über die verschiedenen Aspekte von Stuttgart 21 und das Alternativkonzept Kopfbahnhof 21 zu diskutieren (Brettschneider 2013: 189). An den Gesprächen, die im Rathaus der Landeshauptstadt Stuttgart stattfanden, waren je sieben Vertreter der Pro- und Kontra-Seite beteiligt.[56] Bei der Pro-Seite handelte es sich u.a. um Ministerpräsident Stefan Mappus, die baden-württembergische Umwelt- und Verkehrsministerin Tanja Gönner und Bahnvorstand Dr. Volker Kefer. Bei der Kontra-Seite waren es u.a. Winfried Kretschmann (Die Grünen), Dr. Brigitte Dahlbender (BUND) und Gangolf Stocker (Initiative Kein Stuttgart 21). Zum Zwecke einer größtmöglichen Transparenz wurden alle Sitzungen in voller Länge beim Fernsehsender PHOENIX, im Radio, im Internet und auch auf einer Großbildleinwand für Zuschauer im Rathaus übertragen (Brettschneider 2013: 188). Heiner Geißler übernahm die Moderation des Verfahrens und agierte „immer wieder als Anwalt der Zuschauer“ (Brettschneider 2013: 189). „Das versteht kein Mensch!“, rief er häufig dazwischen und sorgte dafür, dass die Redner bestimmte Fachbegriffe oder komplizierte Sachverhalte in einer verständlichen Sprache nochmals erklärten. Mit diesen Interventionen wurde eine „Experten-Experten-Kommunikation“ während des Verfahrens weitgehend verhindert und eine „Experten-Laien-Kommunikation“ ermöglicht (Brettschneider 2013: 189–190). In der allerletzten Sitzung am 30.11.2010 vollzog Heiner Geißler seinen Schlichterspruch. Darin betonte er, dass es einen wirklichen Kompromiss zwischen beiden politischen Lagern nicht geben könne, da ihre beiden Positionen (Stuttgart 21 vs. Kopfbahnhof 21) zu gegensätzlich seien. In seinem Abschlussplädoyer sprach sich Geißler prinzipiell für den Weiterbau des Tiefbahnhofes und damit auch für Stuttgart 21 aus, was er vor allem mit den bereits gültigen Bauverträgen zwischen der Bahn und der Politik begründete. Zugleich wollte er aber die berechtigten Kritikpunkte der Projektgegner zur Geltung bringen und mahnte deshalb Verbesserungsvorschläge an (Brettschneider 2013: 196–197). Nur wenn die folgenden Verbesserungsvorschläge beachtet würden, könnte Stuttgart 21 oder „Stuttgart Plus“ nach Meinung von Heiner Geißler überhaupt Legitimität beanspruchen:
1. Die durch den Gleisbau frei werdenden Grundstücke werden der Grundstücksspekulation entzogen und einer allgemeinnützigen Stiftung überführt, die fortan eine sozial verträgliche und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung im Innenstadtbereich von Stuttgart ermöglichen soll.
2. Die Bäume im Schlossgarten bleiben entweder erhalten oder werden, wenn dies die Umbaumaßnahmen unbedingt erfordern, an einen anderen, ebenfalls geeigneten Ort umgepflanzt.
3. Die Deutsche Bahn AG verpflichtet sich zur Durchführung eines Stresstestes, der den Nachweis einer Leistungssteigerung von 30 Prozent zur Spitzenstunde gegenüber dem bestehenden Kopfbahnhof zu erbringen hat (vgl. alle Vorschläge Stuckenbrock 2013: 46–47).
Die Beurteilung der Schlichtung fällt eher negativ aus. So ist dem Journalisten der Süddeutschen Zeitung Andreas Zielcke (2010b) z.B. darin zuzustimmen, wenn er das Schlichtungsverfahren im doppelten Sinne als postdemokratisch kritisiert: Zum einen spricht er damit die Tatsache an, dass die Schlichtung „der versäumten demokratischen Willensbildung nachgeschaltet war“ und also zu einem verspäteten Zeitpunkt stattfand. Zum anderen versteht er das Verfahren „als Parodie auf den herrschaftsfreien Diskurs“, weil darin die weitgehend machtlosen Projektgegner den Projektbefürwortern gegenübersaßen, die sich ihres Sieges zu jedem Zeitpunkt sicher sein konnten. Diese Machtasymmetrie zwischen den Konfliktparteien bezeichnet Zielcke (2010b) als „einseitige oder unfaire Souveränität“. Demnach war die Schlichtung kein offenes Entscheidungs- oder Konfliktlösungsverfahren, „sondern der Versuch, die Ohnmächtigen mit dem harten Faktum ihrer feststehenden Niederlage zu versöhnen. Sie war therapeutisch angelegt, nicht offen. Man lieh ihnen nicht das Recht, nur das Ohr“ (Zielcke 2010b). Auch die dominante Rolle von Heiner Geißler während des Verfahrens und die Verfahrensunklarheit für die Teilnehmer bieten Anlass zur Kritik. Beklagt wird vor allem die Tatsache, „dass das Verfahren und die Art seines Abschlusses nicht von den Beteiligten vorab festgelegt worden waren, sondern weitgehend Heiner Geißlers souveräner Entscheidung überlassen blieben“ (Thaa 2013: 7; Thaa 2015: 292). Spieker/Brettschneider (2013: 219–221) argumentieren, dass es bei Verfahren der alternativen Streitbeilegung eigentlich üblich sei, dass die im Konflikt zueinander stehenden Parteien selbstständig und freiwillig zu einer gemeinsamen Lösung kommen, die von ihnen beidseitig und langfristig akzeptiert werden kann. Genau diese langfristige Selbstbindung sei in Bezug auf das Ergebnis der S 21-Schlichtung nicht möglich gewesen, da sich Geißler zu sehr in das Geschehen einmischte und sich mit seinem Schlichterspruch letztlich zugunsten der Projektbefürworter positionierte (Spieker/Brettschneider 2013: 221–223). Weil das rechtlich unverbindliche Ergebnis der Schlichtung nicht das eigenständige Verhandlungsergebnis der im Konflikt zueinander stehenden Parteien war, sondern es ihnen von außen auferlegt wurde, konnte es demnach nur unzureichend Verbindlichkeit erlangen: „So mögen sich zwar am Ende des Verfahrens beide Seiten zu einem wie auch immer gearteten Lösungsvorschlag bekennen, ein späteres, zunehmend stärkeres Distanzieren schließt das aber nicht aus“ (Spieker/Brettschneider 2013: 222). Genau dieser Effekt war auch in Bezug auf den Stuttgart 21-Konflikt zu beobachten: Zwar beauftragte die Deutsche Bahn das Unternehmen sma zur Durchführung eines Stresstestes, demzufolge die verlangte 30-Pronzent-Steigerung erreicht werden konnte, jedoch zweifelten die Projektgegner sowohl an der Objektivität der Ergebnisse des Stresstestes als auch an der prinzipiellen Bereitschaft der Projekt-befürworter sich an die Verbesserungsvorschläge zu halten. Die Proteste des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 gingen deshalb, wenn auch in deutlich geringerem Umfang, weiter. Die sogenannte Schlichtung hat demnach ihren Namen nicht verdient, da sie bestenfalls zu einer Scheinlösung des Konfliktes zwischen den Projektbefürwortern und Projektgegnern beitragen konnte.
Trotz der berechtigten Kritik an der sog. Schlichtung bleibt hervorzuheben, dass von ihr eine befriedende Wirkung ausging (Thaa 2015: 292–293). In diesem Zusammenhang sind die besonderen Begleitumstände und auch die begrenzte Zielsetzung des Verfahrens zu berücksichtigen. Der Hauptorganisator, Lother Frick, hat in einem Interview darauf hingewiesen, dass es sich bei den Schlichtungsgesprächen keineswegs um einen Prototyp für Bürgerbeteiligung handelte (Cornelius et al. 2013: 209–217). Vielmehr waren die Gespräche als „Feuerwehrrettungsaktion“ zu verstehen, deren Aufgabe darin bestand, „die Situation zu beruhigen und erst einmal wieder eine Gesprächsbasis herzustellen“ (Cornelius et al. 2013: 215). Weder Bürgerbeteiligung noch Konfliktlösung waren demnach mit der Schlichtung beabsichtigt, sondern eine möglichst umfassende Bürgerinformation (Cornelius et al. 2013: 216). An dieser Zielsetzung bemessen, war die sog. Schlichtung durchaus ein Erfolg. Wie z.B. die Forschungsergebnisse von Brettschneider (2013: 188–198) belegen, wurde die Schlichtung nicht nur von einem großen öffentlichen Interesse begleitet, sondern von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in Stuttgart und der Region auch positiv wahrgenommen. Die meisten Bürger fühlten sich demnach durch den wechselseitigen Austausch von Argumenten gut informiert und in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden (Brettschneider 2013: 191–193). Neben der Beseitigung des wahrgenommenen Informationsdefizites hat die Schlichtung aus Sicht der Bevölkerung auch einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte geleistet (Brettschneider 2013: 195–196). Auch das Verhalten von Geißler während des Verfahrens und sein Schlichterspruch wurden von den Befragten mehrheitlich positiv aufgenommen (Brettschneider 2013: 189–190; 196–198). Durch die Schlichtung konnte ein, wenn auch geringfügiger, Meinungsumschwung zugunsten des Stuttgart 21-Projektes erreicht werden (Brettschneider 2013: 199–200). Trotz der Beseitigung des Informationsdefizites, der allgemein positiven Wahrnehmung in der Bevölkerung und des Meinungsumschwunges konnte die Schlichtung eines nicht erreichen: Eine Einigung bzw. das Schmieden eines authentischen Kompromisses auf Grundlage eines Interessenausgleichs zwischen beiden Konfliktparteien. Sie taugte daher weder um die Projektbefürworter und -gegner in ihren Positionen näher zueinander zu bringen noch um die Projektgegner von ihrem Protest abzubringen. Außerdem leistete das Verfahren aufgrund der genannten kritischen Einwände keinen nennenswerten Beitrag zugunsten einer Demokratisierung im Bereich der Stadtentwicklung.
3.1.4 Vierte Phase: Die Landtagswahl und die Volksabstimmung über das Stuttgart 21-Kündigungsgesetz im Jahr 2011 als vorläufiger Schlusspunkt der Auseinandersetzung
Mit der 15. Landtagswahl am 27. März 2011 und der Volksabstimmung über das S 21-Kündigungsgesetz am 27. November 2011 fanden in Baden-Württemberg zwei eng miteinander im Zusammenhang stehende politische Ereignisse statt, die das vorläufige Ende des Konfliktes um das Bauprojekt markierten. Dabei war das Ergebnis der Landtagswahl in doppelter Hinsicht überraschend: Zum einen stieg die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Landtagswahl 2006 im Bundesland auf 66,3 Prozent (+12,8 Prozent) und in Stuttgart auf 73,1 Prozent (+16,1 Prozent). Dieser Beteiligungsanstieg kann als Indiz für die starke Politisierung der Bevölkerung in Baden-Württemberg und insbesondere in der Landeshauptstadt interpretiert werden (Brettschneider/Schwarz 2013: 262). Zum anderen ermöglichte der Wahlausgang mit einem Stimmenanteil von 24,2 Prozent für die Grünen und einem Anteil von 23,1 Prozent für die SPD erstmals die Bildung einer grün-roten Landesregierung unter der Führung von Winfried Kretschmann als Ministerpräsidenten.[57] Zwar war die CDU mit 39 Prozent der Stimmen (–5,2%) immer noch die stärkste Kraft in Baden-Württemberg, aber auch ihr Koalitionspartner FDP schwächelte mit 5,3 Prozent (–5,4%), so dass eine Fortsetzung der schwarz-gelben Landesregierung keine Option darstellte. Damit wurde die seit 58 Jahren bestehende CDU-Dominanz in Baden-Württemberg zum ersten Mal gebrochen (Brettschneider/Schwarz 2013: 262). Doch welche Einflussfaktoren waren für das ungewöhnliche Wahlergebnis ausschlaggebend und welche Rolle übernahm in diesem Zusammenhang das Thema Stuttgart 21?
Einen ersten Erklärungsansatz liefert der öffentliche Meinungsumschwung infolge der Atomkatastrophe in Japan, Fukushima. Demnach wurde die ursprüngliche Themen-Agenda für die Landtagswahl durch das externe Ereignis „durcheinander gewirbelt“ und die Atompolitik zum „dominanten Sachthema“ (Brettschneider/Schwarz 2013: 265). Im Gegensatz zur CDU und den anderen Parteien profitierten die Grünen „von dem großen Kompetenz- und Glaubwürdigkeits-Vorsprung, der ihnen von der Bevölkerung bei der Atompolitik beigemessen wird“ (Brettschneider/Schwarz 2013: 265). Daneben nahm aber auch das Thema Stuttgart 21 einen spürbaren Einfluss auf die Wahlentscheidung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg (Brettschneider/Schwarz 2013: 265–271). Einer Umfrage der Universität Hohenheim zufolge gaben immerhin 44,0 Prozent der Befragten an, dass Stuttgart 21 für ihre Wahlentscheidung „wichtig“ oder „sehr wichtig“ sei, 36,4 Prozent äußerten sich diesbezüglich unentschlossen und 19,6 Prozent gaben an, dass das Thema für ihre Wahlentscheidung nicht wichtig sei (Brettschneider/Schwarz 267–269). In Bezug auf die subjektive Wichtigkeit von Stuttgart 21 zeigten sich klare Unterschiede zwischen den verschiedenen Wählerschaften: Während das Thema für die Wähler der CDU, der SPD und der FDP eine relativ geringe Bedeutung einnahm, war es für die Grünen-Wähler umso wichtiger. Durch ihre klare Opposition zu S 21 konnten die Grünen einerseits ihre eigenen Anhänger bzw. ihre Stammwähler mobilisieren und andererseits relativ viele Stimmen von Wechselwählern, d.h. Personen mit einer zuvor anderen Parteienpräferenz, gewinnen (Brettschneider/Schwarz 2013: 269–270; 295). Damit kann festgehalten werden, dass sich die klare Position der Grünen gegenüber Stuttgart 21 und ihre langfristige Beteiligung innerhalb der Protestbewegung für sie vorteilhaft in Bezug auf die Landtagswahl 2011 in Baden-Württemberg auswirkte. Die politische Strategie der Grünen, sich durch ihre Beteiligung an den S 21-Protesten bürgernah und gegen das politische Establishment gerichtet zu präsentieren, um dadurch mehr Zustimmung zu erhalten, ging demnach auf (Brettschneider/Schwarz 2013: 271). In Bezug auf die Arbeit der schwarz-gelben Landesregierung war in der Bevölkerung mit 56 Prozent hingegen eine relativ hohe Unzufriedenheit vorhanden. Dies zeigte sich z.B. auch an der relativ geringen Beliebtheit des ehemaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus: Mit einem durchschnittlichen Beliebtheitswert von –0,2 auf einer Skala von –5 bis +5 war der CDU-Spitzenkandidat seinen Kontrahenten Nils Schmid von der SPD (+1,1) und Winfried Kretschmann von den Grünen (+1) während des Wahlkampfes weit unterlegen (Brettschneider/Schwarz 2013: 270).
Es bleibt daher zu vermuten, dass der bereits beschriebene autoritäre Politikstil während der Stuttgart 21-Auseinandersetzung und nicht zuletzt auch der gewaltvolle Polizeieinsatz am schwarzen Donnerstag beide Anteil an den Wahlverlusten der schwarz-gelben Landesregierung hatten. Demnach wurden bei der Landtagswahl auch der ignorante und rücksichtslose Umgang der Politik mit den Protestierenden abgestraft. Zwar gelang es Stefan Mappus und der schwarz-gelben Regierung ihr politisches Image durch die sogenannte Schlichtung unter der Leitung von Heiner Geißler wieder leicht aufzubessern und außerdem auch für etwas mehr Zustimmung in Bezug auf das Stuttgart 21-Projekt zu sorgen; ihre Niederlage bei der Landtagswahl am 27. März 2011 konnten sie dadurch trotzdem nicht mehr verhindern.
Am 9. Mai 2011 wurde der Koalitionsvertrag der neuen grün-roten Landesregierung nach mehrtägiger Verhandlung unterzeichnet und der Öffentlichkeit präsentiert. Gerade in Bezug auf das Thema Stuttgart 21 konnten sich beide Koalitionspartner jedoch nicht einigen: „Während die Grünen den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofes zu einem Durchgangsbahnhof ablehnten, befürworteten die SPD-Vertreter dieses Projekt“ (Brettschneider/Schwarz 2013: 271).[58] Trotz ihres Dissenses vereinbarten beide Regierungsparteien den Kompromiss, eine Volksabstimmung zu diesem Thema durchführen zu lassen: Die Bevölkerung in Baden-Württemberg sollte letztlich selbst die Möglichkeit erhalten, über Stuttgart 21 zu entscheiden. Diese Idee passte zur konzeptionellen Neuausrichtung der grün-roten Landesregierung. Offenbar hatte man aus den Fehlern der vorigen Regierung gelernt und wollte ihren autoritären Politikstil durch eine „Politik des Gehörtwerdens“ ersetzen (Brettschneider/Schwarz 2013: 272). Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: „Wir wollen Baden-Württemberg zum Musterland demokratischer Beteiligung machen“ (Bündnis90/Die Grünen/SPD 2011: 2). An anderer Stelle wird die Vereinbarung zugunsten der Volksabstimmung genau begründet: „Die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 spaltet unser Land. Auch beide Koalitionsparteien vertreten unterschiedliche Meinungen zu diesem Projekt. (...) Beide Parteien respektieren die jeweilige andere Position und sind sich einig in dem Bestreben, den Streit um Stuttgart 21 zu befrieden und die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Dazu befürworten beide Parteien die Durchführung einer Volksabstimmung: Die Bürgerinnen und Bürger sollen entscheiden.“ (Bündnis90/Die Grünen/SPD 2011: 29–30).
Am 27. November 2011 waren 7,6 Mio Wahlberechtigte in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, über „einen Ausstieg des Landes aus der Finanzierung des Projekts Stuttgart 21“ abzustimmen (Kersting/Woyke 2012: 96). Damit konnten die Bürger zwar nicht über das Bauprojekt selbst abstimmen, wohl aber über das nach Artikel 60 Absatz 3 der Landesverfassung zur Volksabstimmung gebrachte S 21-Kündigungsgesetz der Grünen, das einen Ausstieg aus den vertraglichen Verpflichtungen des Landes bezüglich der Mitfinanzierung von Stuttgart 21 vorsah. In Bezug auf die Abstimmung mussten die Bürger Ja ankreuzen, insofern sie gegen die Fortführung des Projektes und gegen die Mitfinanzierung des Landes Baden-Württemberg waren und Nein ankreuzen, insofern sie für den Weiterbau und für die Mitfinanzierung des Landes waren. Die Formulierung der Frage auf den amtlichen Stimmzetteln rief zum Teil deutliche Kritik hervor, da sie missverständlich interpretiert werden konnte (Brettschneider/Schwarz 2013: 274–275). Insgesamt kann aber die Informationsarbeit der Landesregierung im Vorfeld der Volksabstimmung durchaus gewürdigt werden. So wurden z.B. Informationsbroschüren an alle Haushalte versandt, in denen die Projektgegner und -befürworter mit jeweils zehn Argumenten ausführlich und ausgewogen zu Wort kamen (Staatsministerium Baden-Württemberg 2011). Entsprechend urteilte auch der Verein Mehr Demokratie e.V. in seinem Monitoring zur Volksabstimmung: „Das Abstimmungsheft der Landesregierung ist ausgewogen gestaltet. Beide Seiten kommen zu gleichen Teilen zu Wort. Die Stimmberechtigten sind nach der Lektüre in der Lage, sich eine Meinung zu bilden“ (Weber, zit. nach Brettschneider/Schwarz 2013: 274). Im Grußwort der Broschüre von Winfried Kretschmann und Nils Schmid heißt es: „Bei Stuttgart 21 geht es nicht nur um ein Verkehrsprojekt. Ein großer Teil des Protests richtet sich auch gegen eine bestimmte Art von politischem Stil in der Vergangenheit. Diesen Stil hat die neue Landesregierung geändert. Wir haben verstanden – die Menschen werden ernst genommen.“ Beide Politiker setzten sich unabhängig ihrer parteipolitischen Präferenzen, u.a. in einer kurzen Videobotschaft, für eine rege Beteiligung der baden-württembergischen Bevölkerung bei der Volksabstimmung ein.[59]
Das Ziel einer hohen Beteiligung wurde bei der Volksabstimmung am 27. November 2011 zweifellos erreicht: In Baden-Württemberg beteiligten sich mit 48,3 Prozent fast die Hälfte der Stimmberechtigten und in Stuttgart waren es mit 67,8 Prozent sogar mehr als zwei Drittel. Damit konnte eine überdurchschnittlich hohe Beteiligungsquote im Vergleich zu anderen Volksabstimmungen in anderen Bundesländern erzielt werden (Brettschneider/Schwarz 2013: 282). Wie schon bei der Landtagswahl zu beobachten war, konnte die beschriebene Auseinandersetzung über Stuttgart 21 auch im Hinblick auf die Volksabstimmung zu einem verstärkten öffentlichen Interesse und zu einer Politisierung der Bevölkerung beitragen. Ohne die Protestbewegung wären demnach weder der Regierungswechsel noch die daraus erst hervorgegangene Durchführung der Volksabstimmung zustande gekommen. „Es liegt eine nicht geringe Ironie darin, dass die nachhaltigsten Effekte einer Bewegung, die (...) vor allem wegen ihrer Spontaneität und Autonomie sowie ihrer antirepräsentativen Rhetorik geschätzt wurde, in der Veränderung parlamentarischer Mehrheiten und der Durchsetzung einer Volksabstimmung bestanden“ (Thaa 2013: 8). Ihr Hauptziel, die Verhinderung des Bauprojektes, konnten die Projektgegner aufgrund des Ergebnisses der Volksabstimmung aber nicht erreichen: Demnach stimmte eine Mehrheit von 58,9 Prozent gegen das Kündigungsgesetz und damit für eine Fortführung des Bauprojektes, während eine Minderheit von 41,1 Prozent für das Gesetz und damit gegen eine Fortführung des Projektes votierte (Brettschneider/Schwarz 2013: 285–286).[60] Damit konnte das Kündigungsgesetz nicht beschlossen werden und die Deutsche Bahn AG hatte nach vielen Monaten der Unklarheit aufgrund des grün-roten Regierungswechsels und der bevorstehenden Volksabstimmung wieder Planungssicherheit. Der vorläufige Vergabe- und Baustopp wurde aufgehoben und die Bauarbeiten fortgesetzt. Das Ergebnis stellte einen unerwartet deutlichen Sieg für die Projektbefürworter dar und bedeutete für die Projektgegner gleichzeitig einen herben Rückschlag. Schließlich waren sie es, die selbst auf eine Volksabstimmung zum Stuttgart 21-Thema gedrängt und sich darüber eine Delegitimierung des Bauprojektes erhofft hatten. „Die empfindlichste Niederlage der Projektgegner aber lag darin, dass sie selbst in der Stadt Stuttgart (...) keine Mehrheit für einen Ausstieg gewinnen konnten“ (Thaa 2015: 293). Damit war der Einwand, die Volksabstimmung hätte aufgrund der unmittelbaren Betroffenheit der Einwohner in der Landeshauptstadt Stuttgart und nicht im gesamten Bundesland stattfinden sollen, von vornherein entkräftet, denn auch hier hatten die Projektbefürworter gewonnen. Ein anderer Einwand bezüglich der Ergebnisse der Volksabstimmung ist dagegen plausibel: Nach dem hohen Quorum, das die Verfassung in Baden-Württemberg im Fall von Volksabstimmungen vorsieht, hätten die Projektgegner für den Beschluss des Kündigungsgesetzes nicht nur eine einfache Mehrheit benötigt, sondern zusätzlich das Ja von mindestens einem Drittel aller Stimmberechtigten (Kersting/Woyke 2012: 96). „Das hätte, bei knappen Mehrheitsverhältnissen, eine für Volksabstimmungen unrealistisch hohe Wahlbeteiligung erfordert“ (Thaa 2015: 293). Auch mit diesem berechtigten Einwand lässt sich aber nicht leugnen, dass es neben der öffentlichen Meinung der Projektgegner offenbar noch eine gegenteilige öffentliche Meinung gab. Demnach fand eine schweigende Mehrheit die Argumente der Projektbefürworter überzeugender und Stuttgart 21 unterstützenswert: „Die Volksabstimmung hat verdeutlicht, wie die Meinungsverteilung in der Bevölkerung tatsächlich aussieht: Es gibt einen großen Anteil von Projekt-Gegnern ‒ aber eben auch einen noch größeren Anteil von Menschen, die nicht wollten, dass sich die Landesregierung aus der Finanzierung von Stuttgart 21 zurückzieht“ (Brettschneider/Schwarz 2013: 296).
Von der Niederlage bei der Volksabstimmung konnte sich die Protestbewegung nicht mehr erholen. Insbesondere der gelegentlich zum Vorschein kommende Anspruch mit ihrer Stimme für das Volk sprechen zu können, war zutiefst erschüttert: „Wir sind das Volk! ‒ diese gelegentlich mit einem Absolutheitsanspruch vorgetragene Parole einiger Gegner von Stuttgart 21 war so nicht mehr tragbar“ (Brettschneider/Schwarz 2013: 296). Zwar finden die Montagsdemonstrationen in Stuttgart bis zum heutigen Tag weiterhin statt und auch das Aktionsbündnis existiert immer noch. Mit Rüdiger Bäßler (2016) ist aber darauf hinzuweisen, dass die Protestbewegung nach dem Regierungswechsel 2011 nie wieder annähernd so viel Unterstützung und Präsenz in der Stadt generieren konnte, wie im Sommer 2010 und sie ihr Momentum folglich zu verloren haben scheint. Da sich die aktuelle Situation aufgrund von veränderten Tatsachen und Konstellationen in den politischen Gremien prinzipiell immer wieder wandeln kann, ist es hier sinnvoll, nur von einem vorläufigen Schlusspunkt der S 21-Auseinandersetzung zu sprechen.
3.2 Mehr Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung – eine kritische Bestandsaufnahme
Die Stuttgart 21-Auseinandersetzung hat zusammen mit vielen anderen Konflikten in Bezug auf Bau- und Infrastrukturprojekte in verschiedenen deutschen Städten[61] teilweise zum Umdenken im Bereich der Stadtentwicklung beigetragen: Demnach gehören reine Top-Down-Ansätze in der Stadtpolitik weitgehend der Vergangenheit an und es werden neue, vielfältige und innovative Möglichkeiten der Information und Einbeziehung von Einwohnern in die städtebaulichen Planungsprozesse erprobt. Dialogorientierte Beteiligung (informell) und direktdemokratische Beteiligung (formell) ergänzen dabei das Spektrum der konventionellen und gesetzlich vorgeschriebenen Bebauungsplanverfahren und liegen gegenwärtig im Trend: „ Bürgerbeteiligung ist en vogue. Kein politischer Mandatsträger, keine Verwaltungsmitarbeiterin kann es sich heute noch leisten, diese kraftvolle Bewegung zu ignorieren“ (Nanz/Fritsche 2012: 9). Obwohl die beobachtbare Ausweitung der Beteiligungsangebote im Bereich der Stadtentwicklung zunächst positiv im Sinne des Leitziels einer Demokratisierung der Kommunalpolitik erscheint, sind in der Literatur ebenfalls wichtige Einwände gegen diese Veränderungen zu beachten. Demnach muss die naive Sichtweise, dass quantitativ mehr Bürgerbeteiligung in der Stadtplanung und -entwicklung quasi automatisch auch zur qualitativen Verbesserung der Demokratie in den Städten beiträgt, revidiert werden. Die Qualität von zusätzlichen Beteiligungsangeboten im Bereich der Stadtentwicklung stellt sich im Hinblick auf die politische Praxis durchaus differenziert dar: Bedeuten die zusätzlichen Angebote der Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtentwicklung demnach tatsächlich einen Einflussgewinn für die Bürger? Welche Probleme können sich bei der Umsetzung von Bürgerbeteiligungsverfahren in der politischen Praxis ergeben? Und wie, d.h. mit welchen Methoden, sollten diese Probleme überwunden werden?
3.2.1 Kritik an der konventionellen Bürgerbeteiligung nach dem Baugesetzbuch und Anforderungen dialogorientierter Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung
Die Gemeinden und Städte sind nach dem Baugesetzbuch (BauGB) dazu verpflichtet, die Öffentlichkeit über ihre Planungen zu informieren und alle Bürger, die von den baulichen Maßnahmen betroffen sind, in einem zweistufigen Verfahren zu beteiligen. In einer ersten Phase (Stufe 1) sieht das BauGB vor, dass die betroffenen Bürger möglichst frühzeitig über a) die allgemeinen Ziele und Zwecke, b) sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen und c) die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten sind. Da das BauGB in Bezug auf die Durchführung der ersten Phase kaum konkrete Vorgaben macht, bleibt den Kommunen diesbezüglich viel Handlungsspielraum überlassen (Erzigkeit 2005: 58). Die zweite Phase (Stufe 2) beinhaltet die Auslegung der Planung und die förmliche Beteiligung der Betroffenen. Diesbezüglich hat die Kommune wenig Gestaltungsfreiheit und muss sich an die konkreten Vorgaben des Baugesetzbuches halten. Demnach hat die planende Behörde ihren Entwurf mit den dazugehörigen Begründungen und Gutachten einen Monat lang öffentlich einsehbar auszulegen, z.B. im Rathaus oder in einem anderen Verwaltungsgebäude (Erzigkeit 2005: 58). Während der Frist können Stellungnahmen zum Bebauungsplan bei der planenden Behörde eingereicht werden, die verpflichtet ist, sich mit allen Einwänden auseinanderzusetzen und eine abschließende Bewertung abzugeben. Dabei ist die Behörde an das sog. Abwägungsgebot gebunden: „Demnach sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen, d.h. es wird unter Berücksichtigung der Gesamtsituation entschieden, ob die jeweils formulierten Bedenken berücksichtigt oder zurückgewiesen werden“ (Erzigkeit 2005: 59). Nach der Abwägung „kann der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. Mit der Bekanntmachung in der Presse tritt der Bebauungsplan als verbindliche Rechtsnorm in Kraft“ (Erzigkeit 2005: 59).
Das Hauptproblem in Bezug auf das gesetzlich vorgeschriebene Planverfahren ist, dass es zwar die Information und Anhörung der betroffenen Bürger verlangt, ihre frühzeitige Einbeziehung und Mitwirkung an den städtebaulichen Planungsprozessen aber nicht zwingend vorsieht.[62] Die Stadtplanung bleibt in der politischen Praxis daher in der Regel der Entscheidungskompetenz der Kommunalverwaltung und -politik überlassen. Für die planenden Behörden und die politisch Verantwortlichen besteht häufig kein Anlass dafür, die Handlungsspielräume während der ersten Stufe des Bebauungsplanverfahrens tatsächlich zu nutzen und mit Leben zu füllen: „Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird von den Gemeinden oft nur als Pflichtveranstaltung durchgeführt. Die Planungen sind häufig schon in einem Entwurfsstadium, so dass die Vorstellung der Öffentlichkeit nicht mehr berücksichtigt werden kann. Die Bürger werden zwar angehört und auch beteiligt im Sinne des Gesetzes, jedoch ist die aktive Mitwirkung bei der Entwicklung der Planungskonzeption oft nicht beabsichtigt“ (Erzigkeit 2005: 60). Genau dieses Problem war auch in Bezug auf Stuttgart 21 zu beobachten: Die Bürger hatten während des gesetzlichen Planverfahrens zwar formell die Möglichkeit, sich über das Bauprojekt zu informieren und Einwände vorzubringen; de facto waren sie aber zu keinem Zeitpunkt in die Position versetzt, ihr Veto gegen Stuttgart 21 einzulegen oder zumindest die Prüfung von Alternativen zu veranlassen. Trotz der deutlichen Zunahme unkonventioneller Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung in den letzten Jahren, macht die konventionelle Bürgerbeteiligung nach dem BauGB gegenwärtig noch den Großteil aller Beteiligungsangebote aus. Entsprechend beruht Stadtplanung auch heute noch vorrangig auf der Information der Betroffenen über die bereits fertiggestellten Entwürfe der planenden Behörde, ohne dass darin ein echter Dialog oder eine faire Verhandlung zwischen den Städteplanern, Kommunalpolitikern und Einwohnern über die Gestaltung der Zukunft in ihrem Lebensumfeld ermöglicht wäre. Es stellt sich daher die Frage danach, welchen qualitativen Anforderungen dialogische Bürgerbeteiligung in der politischen Praxis der Stadtplanung und -entwicklung eigentlich genau genügen müsste.
Wie am Stuttgart 21-Beispiel deutlich wurde, ist vor allem die frühzeitige Information und Einbeziehung der Betroffenen während des Planungsprozesses für die Legitimität sowie für das Gelingen von Infrastruktur- und Bauprojekten entscheidend. Mit anderen Worten wäre es in Stuttgart vermutlich nicht in der geschilderten Intensität zum Konflikt zwischen den Projektbefürwortern und -gegnern gekommen, hätten die Bahn und die politisch Verantwortlichen die Einwohner bereits früher informiert und in die Planung miteinbezogen. Nach den Recherchen dieser Arbeit wäre es womöglich gar nicht zum Konflikt zwischen beiden Seiten gekommen, weil die Bahn während der Planung selbst noch ein Interesse am Erhalt des Kopfbahnhofes hatte und dieser Erhalt auch ein Teilziel der Projektgegner darstellte. Die frühzeitige Information und Einbeziehung von Bürgern in die städtebaulichen Planungsprozesse stellt für die Kommunen eine Kommunikationsherausforderung dar. Wie die folgende Darstellung zeigt, besteht offenbar nämlich ein Zusammenhang zwischen den üblichen Kommunikationsformen in der Kommunalpolitik und dem zeitlichen Beteiligungsparadoxon (siehe Abbildung 3, auf der nächsten Seite). Das zeitliche Beteiligungsparadoxon besagt kurzgefasst, dass das Interesse der Bürger zu Beginn eines Planverfahrens „aufgrund des abstrakten Problemdrucks“ eher gering ausfällt, obwohl die Einflussmöglichkeiten zu diesem Zeitpunkt eigentlich am größten sind, und es sich am Ende des Verfahrens genau umgekehrt verhält (König/König 2014: 7).
Abbildung 3: Kommunikationsformen im zeitlichen Beteiligungsparadoxon
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Die Darstellung wurde von König/König (2014: 7) übernommen.
Mit ihrer Darstellung bieten König & König auch eine Erklärung für das Beteiligungsparadoxon: Da die Kommunikation während der Phase der Politikherstellung in den Kommunen gewöhnlich intern abläuft und der Öffentlichkeit damit weitgehend verschlossen bleibt, sind die meisten Bürger zu diesem frühen Zeitpunkt weder ausreichend informiert noch interessiert, um ihre Einflussmöglichkeiten zu nutzen. Sobald aber die Politik mit dem Beschluss eines Bauprojektes vor die Presse tritt und damit die Phase der Politikdarstellung einleitet, steigert sich das öffentliche Interesse, wobei die Umsetzung des Projektes zu diesem Zeitpunkt kaum noch rückgängig zu machen oder zu verändern ist. Um das Beteiligungsparadoxon zu überwinden oder zumindest abzuschwächen, müssten laut König/König (2014: 7) „die üblicherweise eher intern stattfindende Politikherstellung mit der Politikdarstellung verbunden“ und „Bürgerbeteiligung von Anfang an mitgedacht“ werden. Das bedeutet, dass die Kommunen in Zukunft ihre Kommunikationsgewohnheiten überdenken und bestenfalls auch verändern müssten. Soll dialogorientierte Beteiligung in der Stadtentwicklung eine Chance haben, müssten demzufolge die planenden Behörden die Politikdarstellung ganz an den Anfang der städtebaulichen Planungsprozesse stellen.
Dialogorientierte Beteiligung bringt Bürger, zivilgesellschaftliche Akteure und Entscheidungsträger frühzeitig im politischen Prozess zusammen (Nanz/Fritsche 2012: 11). Der Handlungsspielraum hierfür liegt nach dem BauGB im informellen Bereich, was bedeutet, dass darüber, wie von den politisch Verantwortlichen mit den Ergebnissen umgegangen wird, keinerlei rechtliche Verbindlichkeit besteht: „Die Bürger haben keinen Anspruch darauf, dass die Gemeinde ihren Argumenten in der Sache folgt, selbst wenn die Argumente von vielen Bürgern vorgetragen werden“ (Erzigkeit 2005: 59). Aus diesem Grund setzt das Gelingen dialogorientierter Beteiligung ein wechselseitiges Vertrauen zwischen den Entscheidungsträgern und den Einwohnern einer Kommune voraus, wobei dieses Vertrauen auch im Zuge des Verfahrens erst noch entstehen kann. Dabei kommt es von Seiten der planenden Behörde und der Politiker darauf an, dass sie Bereitschaft zeigen, sich auf einen ergebnisoffenen Beteiligungsprozess einzulassen und ihre Entscheidungskompetenzen mit den teilnehmenden Bürgern zu teilen: „Verwaltung und Politik müssen bereit sein, die Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger anzuerkennen und in bestimmten Bereichen Entscheidungsmacht zu teilen“ (Nanz/Fritsche 2012: 13). Dialogorientierte Beteiligung verbleibt häufig auf der Schwelle der Beeinflussung der Öffentlichkeit und Konsultation, ohne dass die Ergebnisse entscheidungsrelevant wären und die Veranstalter den begrenzten Anspruch der Verfahren den Teilnehmenden gegenüber klar kommuniziert hätten. Es besteht demnach das Risiko, dass dialogorientierte Beteiligung von den planenden Behörden und Politikern zum Zwecke der Scheinbeteiligung instrumentalisiert wird. Mit dem strategischen Instrument der Scheinbeteiligung versuchen Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter ihr Image aufzubessern und/oder feststehende Beschlüsse nachträglich zu legitimieren: „Oftmals werden partizipative Prozesse lediglich mit dem Ziel initiiert die Beziehung zwischen Bürgerschaft auf der einen und Verwaltung und Politik auf der anderen Seite zu verbessern – ohne dass es einen echten Handlungsspielraum gibt, weil die wesentlichen Entscheidungen bereits getroffen wurden“ (Nanz/Fritsche 2012: 12–13). In Verfahren der Scheinbeteiligung sind die Machtverhältnisse zwischen Regierenden und Regierten asymmetrisch und behalten die Entscheidungsträger weitgehend die Kontrolle über die Ergebnisse der “Bürgerbeteiligung“. Gegen den Verdacht der Scheinbeteiligung hilft ein transparentes und für alle Betroffenen nachvollziehbares Vorgehen in Bezug auf die Organisation, Durchführung und den Umgang mit den Ergebnissen der Beteiligung (Nanz/Fritsche 2012: 12).
Trotz der beschriebenen Problematik der Scheinbeteiligung, muss konstatiert werden, dass es im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung mittlerweile auch ernst gemeinte Versuche der dialogorientierten Bürgerbeteiligung gibt, die die genannten Qualitätskriterien zumindest teilweise erfüllen. Von der Politik bzw. von oben eingeräumte Bürgerbeteiligung und der Anspruch auf politische Selbstbestimmung der Bürger müssen im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung daher nicht in einen Widerspruch zulaufen. Um dies zu belegen, möchte ich mich im Folgenden kurz dem Beispiel der Konversion in der Stadt Mannheim zuwenden, das in vielfacher Hinsicht ein positives Gegenbeispiel zur Top-down-Politik im Fall von Stuttgart 21 darstellt. Die Mannheimer Konversion konnte dabei die fünf hier entwickelten Erfolgskriterien – 1. frühzeitige Information und Einbeziehung, 2. wechselseitiges Vertrauen, 3. Ergebnisoffenheit, 4. Bereitschaft zur Teilung von Entscheidungskompetenz und 5. transparentes sowie nachvollziehbares Vorgehen – alle weitgehend erfüllen.
3.2.2 Konversion in Mannheim – Bürger in der Rolle als Stadtplaner und -entwickler
Die Stadt Mannheim ist seit einigen Jahren mit der Stadtentwicklungsaufgabe beschäftigt, über 500 ha freiwerdendes Militärgelände zurück in eine zivile Nutzung zu überführen. Bei den Flächen handelt es sich um ehemaliges, exterritoriales Sperrgebiet, das den dort stationierten US-Truppen zum Aufenthalt und zu Übungszwecken diente. Was, mit anderen Worten, einst Militärstützpunkt und amerikanisches Staatsgebiet war, soll zukünftig wieder ein Teil Mannheims werden. Dieser Umwandlungsprozess wird Konversion genannt (Konversion Mannheim 2016).[63] Zunächst waren für die politisch Verantwortlichen bestimmte Fragen zu klären: Was soll auf den frei werdenden Flächen langfristig entstehen? Und wie kann die Konversion in Mannheim umgesetzt werden? Vor allem aufgrund der Größe des Vorhabens kam laut Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz die Idee einer breit angelegten Bürgerbeteiligung auf: „Die Idee einen besonders breiten bürgerschaftlichen Beteiligungsprozess anzufangen, basiert auf der Überlegung, dass eine so große Aufgabe tatsächlich die Intelligenz der Vielen braucht“ (KM 2016).[64] Anstatt einen “Masterplan“ für die Bebauung und Nutzung der verschiedenen Areale vorzugeben und dann von oben politisch durchzusetzen, wählten die Entscheidungsträger in Mannheim einen anderen und neuen Weg. Es wurde entschieden, dass die Bürger den Konversionsprozess von Anfang an (mit-) gestalten und also vorübergehend selbst in die Rolle eines Stadtplaners und -entwicklers schlüpfen sollten: „Nicht als Begleiter, sondern als Lenker des Prozesses, gestalten sie zusammen mit Gemeinderat und Verwaltung Ideen für das Mannheim von morgen“ (KM 2016). Dass dieser Anspruch nicht überhöht oder nur eine Strategie zur Imagepolitik war, zeigen die aufwendige Organisation, der wohl strukturierte Aufbau und die gut dokumentierten Ergebnisse der ersten Beteiligungsphase, dem sogenannten Mannheimer Weißbuchprozess.[65] Unter dem Motto „1000 Ideen für eine Stadt, die sich neu baut“ konnten alle Bürger „auf zahlreichen Veranstaltungen im Internet sowie per Post“ ihre Ideen, Standpunkte und Vorschläge in Bezug auf die vielen frei werdenden Konversionsflächen einbringen (KM 2016).
Insgesamt sind die Inklusivität des Weißbuchprozesses sowie die Geduld und Ausdauer, mit der dieser von offizieller Seite durchgeführt wurde, zu würdigen: Von der Bürgerinformationsveranstaltung am 7.4.2011 bis zur endgültigen Ausformulierung der zentralen Eckpunkte am 31.12.2011 dauerte der Prozess insgesamt neun Monate. Neben der interessierten Bürgerschaft wurden auch bestimmte Zielgruppen, Verbände, Bürgerinitiativen, der Gemeinderat, die Verwaltung, Parteien und Experten in den Weißbuchprozess miteinbezogen (Weißbuch 2012: 16). Zur Auswertung der 1.000 Ideen wurde ein Bürgerforum eingerichtet, wobei sich die Teilnehmenden hierfür in fünf thematische Arbeitsgruppen aufteilten (Weißbuch 2012: 69–83).[66] Aus dieser Zusammenarbeit haben sich auch Initiativen gegründet, die gegenwärtig soziale Wohngruppenprojekte auf bestimmten Flächen realisieren.[67] Dies liefert eine wichtige Erkenntnis, denn im Gegensatz zu Stuttgart 21 hatten die Initiativen im Rahmen des Mannheimer Weißbuchprozesses keinen Grund, sich als Gegner gegenüber den Politikern und der Verwaltung zu artikulieren, da beide Seiten von Beginn an kooperativ zusammenagierten. Dies betont auch der Konversionsbeauftragte, Dr. Konrad Hummel: „Für einzelne Flächen (...) haben sich Initiativen gegründet – nicht gegen die Stadt, sondern für die Idee. Hier wird deutlich, dass Mannheim genau dann stark wird, wenn sich so viele wie möglich mit so vielen Ideen wie möglich beteiligen und wenn diese Vielen vor allem – im wahrsten Sinne des Wortes – nach Freiräumen suchen“ (Weißbuch 2012: 12).[68] Damit ist im Übrigen nicht gesagt, dass es im Rahmen der Kooperation zwischen den Initiativen und der Stadt nicht auch Spannungen, Irritationen oder Streit gab. Einen zusätzlichen Baustein der Beteiligung stellten die Zielgruppenworkshops dar, mittels denen die Stadt aktiv auf Jugendliche, Migranten, Studierende und Auszubildende zugegangen ist, um auch ihre Vorschläge einzubeziehen. Die Workshops richteten sich im doppelten Sinne an Zielgruppen: Zum einen wurden junge Menschen angesprochen, weil die Konversion vor allem ihre Zukunft betrifft. Zum anderen handelt es sich bei den Jugendlichen und Migranten um Gruppen, die durchschnittlich seltener als die Gesamtbevölkerung aus Eigeninitiative heraus an Beteiligungsangeboten teilnehmen. Die Workshops dienten daher als Instrument, um ihrer Unterrepräsentation bei der Gestaltung der städtischen Zukunft Mannheims entgegenzuwirken. Sie zielten auf Beteiligungsgerechtigkeit und mehr politische Gleichheit. Leider gibt es bisher keine Zahlen und Statistiken darüber, ob die Unterrepräsentation von Migranten und Jugendlichen in Mannheim tatsächlich verhindert werden konnte. Allerdings wurden einige Vorschläge der Workshops bereits in die Planung einbezogen und werden auf den Konversionsflächen bereits umgesetzt.[69] Eine transparente Öffentlichkeitsarbeit, die zum einen über Informationsveranstaltungen und Besichtigungsfahrten vor Ort und zum anderen über die sorgfältige Dokumentation des aktuellen Standes der Konversion in den jährlich erscheinenden Weißbüchern und auf der offiziellen Homepage (http://www.konversion-mannheim.de/) erfolgt, ist ein zentraler Organisationsbaustein der Mannheimer Konversion. Die Hauptaufgabe der Vermittlung zwischen Politik und Verwaltung einerseits und der interessierten bzw. engagierten Bürgerschaft andererseits übernehmen dabei die sog. Zukunftslotsen. Die ehrenamtlichen Zukunftslotsen agieren z.B. im Rahmen von Arbeitskreisen und runden Tischen als neutrale Moderatoren und helfen in ihrer Funktion dabei, Stadtentwicklungsthemen während des Beteiligungsprozesses voranzubringen (KM 2016). Das Kriterium für die Mitarbeit als Lotse ist, dass die jeweilige Person nicht Vereins-, Unternehmens- oder Parteisprecher sein und auch keine kommerziellen Interessen auf den jeweiligen Flächen verfolgen darf. Zukunftslotsen werden aus einer Bewerberliste gemischt nach Geschlecht, Alter und Herkunft ausgelost (KM 2016).[70]
Zum Abschluss des Weißbuchprozesses wurden aus den inhaltlichen Schnittmengen der eingebrachten Beiträge insgesamt fünf Eckpunkte formuliert, die am 14.2.2012 vom Mannheimer Gemeinderat beschlossen wurden. Die planerischen Eckpunkte, die mit dem Beschluss des Gemeinderats vor die Klammer allen Planungsrechts und der Einzelflächendefinitionen gestellt wurden, werden im Weißbuch (2012: 15) aufgezählt. Die Eckpunkte wurden fortan auch als die Qualitätsmarken: Grün, Ingenieursmeile, Wohnen, Kultur und Energie bezeichnet (KM 2016). Nach dem Urteil des Konversionsbeauftragten Hummel erfolgte die Markenbildung dabei von den Bürgern und für die Bürger, d.h. sie war in seinen Worten das „Ergebnis eines intensiven Ideenfindungs- und Diskussionsprozesses und nicht einer rein additiven Sammlung oder eines vom Prozess losgelösten Marketings“ (Weißbuch 2012: 13). Ein wenig unklar bleibt dabei, wer die Eckpunkte letztlich eigentlich formulierte. Allem Anschein nach erledigte dies die Verwaltung, was nicht heißen muss, dass die 1000 Ideen mit den fünf Marken ungewissenhaft oder fälschlich wiedergegeben wurden. Nach den Flächen- und Entwicklungsplänen im Weißbuch (2012: 38–55) zu urteilen, bilden die Marken Grün und Wohnen einen deutlichen Schwerpunkt, der auch schon ein wichtiges Teilergebnis des Bürgerbeteiligungsprozesses darstellte: „Es soll eine hohe Ausgewogenheit zwischen Siedlungs- und Grünflächen herrschen, es sollen Experimentierräume des sozialen Miteinanders möglich und hohe Ökostandards umgesetzt werden“ (Weißbuch 2012: 104). Im Folgenden soll deshalb kurz beschrieben werden, wie die Marken Grün und Wohnen im weiteren Konversionsprozess zu konkreten Plänen weiterverarbeitet wurden und inwieweit verschiedene Projektentwürfe bis heute schon realisiert sind.[71]
Unter dem Motto Mannheim bewegt und verbindet entsteht bis 2023 ein Grünzug, der sich wie ein Gürtel um das Stadtgebiet Mannheims erstrecken und die Konversionsflächen durch Grünanlagen und Parks miteinander verbinden soll (Weißbuch 2013: 11). „Ziel ist die Realisierung des großen, umspannenden Stadtnaturraumes vom Rhein im Nordwesten zum Neckar und im Süden zum Rhein hin“ (BUGA23 2016a).[72] Die Idee, den geplanten Grünzug mit einer Bundesgartenschau zu kombinieren, stammt aus der Bürgerschaft: „Von Seiten der Bürgerschaft wurde 2011 häufig die Nutzung unverbundener Flächen als großzügig zu gestaltende Verbindungsflächen mit urbanem Gärtnern, einer Bundesgartenschau und offenen Erlebnisräumen gefordert“ (Weißbuch 2013: 11). Diese Forderung nahmen Politik und Verwaltung in der Folgezeit auf: Nachdem die Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft prinzipiell Bereitschaft zeigte, „einen gesamtstädtischen Grüngürtel (...) bei der Planung für eine Bundesgartenschau 2023 zu berücksichtigen“, gab die Stadt eine Machbarkeitsstudie des Büros sinai aus Berlin in Auftrag, die bei „Betrachtung des gesamten Grüngürtels ein Konzept mit verbundenen Parklandschaften (...)“ ergab (Weißbuch 2013: 11). Im Stadtzentrum soll der Grünzug mit acht, offenen Parklandschaften beginnen.[73] Hier ist ein „lebenswerter, attraktiver, urbaner Standort“ vorgesehen, „der Natur nicht nur ausstellt, sondern einwebt in seine Struktur, täglich erfahrbar macht und seinen Bürgerinnen, Bürgern und Gästen die Erfahrung einer modernen, städtischen Naturkultur anbieten kann“ (BUGA23 2016a). Der Gemeinderat stimmte am 29.2.2013 zugunsten einer Bewerbung Mannheims für die Bundesgartenschau 2023, die der dbg später übergeben wurde (BUGA23 2016b: 6–7).
Doch mit der Bewerbung der Stadt entfachte in der Öffentlichkeit eine Kontroverse über die Kosten und den Nutzen einer Bundesgartenschau. Die BUGA23-Gegner argumentierten, dass die Realisierung der Bundesgartenschau Kosten in Höhe von ca. 60 Mio. Euro verursachen würde und Mannheim dieses Geld besser für andere Kernaufgaben, z.B. für Straßen, Schulen, Feuerwehr und Kinderbetreuung, verwenden sollte. Zudem sahen die Gegner das Naturschutzgebiet der Feudenheimer Au bedroht und hielten die Ziele der Stadt (Konversion, Grünzug, Frischluftschneise) auch ohne die Bundesgartenschau für realisierbar (Keine BUGA 2023: 2016). Die Befürworter einer Gartenschau, zu denen neben den politischen Entscheidungsträgern der Stadt auch einige Pro-Initiativen und Unterstützer aus der Bürgerschaft zählten, rechneten hingegen mit prognostizierten Einnahmen von 6,85 Mio. Euro für die Stadt Mannheim und hofften, dass dieses Geld zur Finanzierung des geplanten Grünzuges verwendet werden könnte (BUGA23 2016b: 14). Die BUGA23 bedeutet nach der Meinung der Befürworter keine finanzielle Belastung der Stadt, sondern stelle angeblich die Finanzierungsgrundlage für die wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung des Grünzuges dar (BUGA23 2016b: 14).[74] Und das Schutzgebiet der Feudenheimer Au würde nach der Ansicht der Befürworter durch die Gartenschau nicht zerstört, sondern durch zusätzliche Parklandschaften und Naturflächen ergänzt.
Die BUGA23-Gegner waren überwiegend ältere Einwohner aus den wohlhabenden Stadtteilen in Nähe der Feudheimer Au: „Die Sorgen vor Veränderungen sind hier sehr ausgeprägt“, kommentierte Oberbürgermeister Kurz die aus seiner Sicht unbegründeten Fortschrittsängste der BUGA23-Gegner in einem Artikel (Prothmann/Dartsch 2013).[75] Als Konsequenz aus dem öffentlichen Dissens und den verhärteten Fronten zwischen Pro- und Kontra-Anhängern entschieden sich die politisch Verantwortlichen der Stadt Mannheim dazu, einen Bürgerentscheid zuzulassen. Dies taten sie auch, um ihren umfassenden Beteiligungsansatz glaubwürdig fortzuführen (Weißbuch 2013: 17). Der Beschluss zur Durchführung des Bürgerentscheids im Gemeinderat erfolgte und am 22.09.2013 waren alle Wahlberechtigten in Mannheim zur Abstimmung über die Austragung der BUGA23 aufgerufen. Das Mindestalter zur Abstimmung wurde vom 18. auf das 16. Lebensjahr gesetzt, um auch Jugendliche in die Entscheidung einzubeziehen. Das Endergebnis des Bürgerentscheids fiel mit 50,7 Prozent mit einer knappen Mehrheit für die Durchführung der BUGA23 in Mannheim aus, wobei die Wahlbeteiligung 59,5 Prozent betrug (Mannheimer Morgen 2013). Oberbürgermeister Kurz äußerte sich zufrieden über das Resultat, hatte er im Vorfeld des Bürgerentscheids doch selbst aktiv für die BUGA23 geworben (Mannheimer Morgen 2013). Im Anschluss an den Bürgerentscheid wurde die Arbeit an der Marke Grün und den dazugehörigen Teilprojekten fortgesetzt (Weißbuch 2014: 17; 20–21).
Ein gutes Beispiel für die gelungene Kooperation zwischen Bürgerinitiativen und der Politik im Rahmen der Mannheimer Konversion stellen die sozialen Wohnprojekte dar, die Bestandteil der Marke Wohnen sind und in Zukunft auf dem sog. Turley-Gelände realisiert werden. Wie schon angedeutet, haben sich aus der Zusammenarbeit der AG Wohnen während des Bürgerforums die Initiativen 13ha Freiheit, Solidarischer Wohn- und Kulturraum (SWK) und umBau Turley zusammengetan, die auf dem Turley-Areal ähnliche Ideen des gemeinschaftlichen Wohnens verwirklichen wollen (KM 2016).[76] Sie vereint dabei ein gemeinsames Selbstverständnis, wonach sie a) ihre Zusammensetzung selbst, bewusst und freiwillig wählen, b) selbstorganisiert und selbstverwaltet sind, c) sich gegenseitig Hilfe leisten und ihre Wohnform auf Dauer anlegen, d) Wert auf Gemeinschaft und die Schaffung von Gemeinschaftsräumen legen, e) sich aktiv um die Nachbarschaft und das Quartier kümmern (KM 2016). Die drei Wohngruppen veranstalten monatlich einen “Runden Tisch – Gemeinschaftliches Wohnen in Mannheim“, in dem sie anderen Initiativen und Einzelpersonen, die ebenfalls soziale Wohngruppen realisieren wollen, ihre Hilfe anbieten und sie mit ihren Erfahrungen beraten. Im Rahmen des Konversionsprozesses konnte sich in Mannheim ein Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen etablieren. Aber was macht die Wohngruppen denn eigentlich genau zu sozialen und sogar politischen Projekten?
Der Schwerpunkt liegt auf gemeinschaftlichem Wohnen, d.h. neben den privaten Wohnbereichen, die Singles, Familien oder Wohngemeinschaften mit ihren je unterschiedlichen Lebensentwürfen für sich beziehen können, gibt es zusätzliche Bereiche, z.B. eine Küche, einen Freizeitraum, einen großflächigen Balkon und einen Gemeinschaftsgarten im Hinterhof, die von allen Bewohnern jeder Zeit genutzt werden können: „Wir setzen damit ein Signal gegen die zunehmende Vereinzelung und soziale Kälte in unserer Gesellschaft“ (13ha Freiheit 2016).[77] Der Gemeinschaftsanspruch wird dabei mit einem Anspruch auf größtmögliche Inklusivität und wechselseitige Akzeptanz verbunden: „Alle Projektbeteiligten möchten eine bunte und vielfältige Gemeinschaft mit Jungen und Alten, mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, mit Menschen mit und ohne Handicaps und verschiedener sexueller Orientierung. Wir arbeiten alle daran, einen für uns freien Lebensraum zu schaffen“ (13ha Freiheit 2016).[78] Um dem Anspruch nach Inklusivität nachzukommen, soll auf dauerhaft niedrige Mieten geachtet werden. Dies funktioniert zum einen durch die Finanzierung der Sanierung bzw. des Baus der Wohnungen über Privatkredite, die in Form der Mieten zu einem bestimmten Zeitpunkt und maximal 2 Prozent Zinsen an den jeweiligen Kreditgeber zurückgezahlt werden. Zum anderen funktioniert dies über die Mietshäuser Syndikat GmbH als Dachverband, die zwar nicht in die Entscheidungsbefugnisse der jeweiligen Wohngruppe eingreifen kann, aber dafür sorgt, dass die Immobilie langfristig Gemeineigentum und dem spekulativen Immobilienmarkt insofern entzogen bleibt (13 ha Freiheit 2016).[79]
Außerdem ist der Anspruch der Selbstorganisation und Selbstverwaltung zentral für die Wohngruppe 13ha-Freiheit, was bedeutet, dass die Regeln des alltäglichen Lebens miteinander nur bedingt vorgegeben sind und zum Großteil von den Mitgliedern selbst und untereinander vereinbart bzw. ausgehandelt werden müssen. Was ist demnach zu tun, wenn Mitglieder der Wohngruppe zu viel Lärm machen und sich das Problem auch nach mehrfacher Ansprache nicht erledigt? Wie ist darauf zu reagieren, wenn Mitglieder nicht auf die Hygiene-Bedürfnisse der anderen Rücksicht nehmen? Zur Konfliktlösung sieht die Wohngruppe eine bestimmte Handhabung vor: „Supervision und Mediation sollen im Konfliktfall durchgeführt werden. Dazu soll es auch Angebote und Fortbildungen für die Bewohner_innen geben“ (13ha Freiheit 2016). Die Selbstverwaltung geschieht dabei vor allem über Vollversammlungen, zu denen zwar keine Teilnahmepflicht besteht, die aber das Zusammenleben grundlegend regeln und zwar nach dem Konsensprinzip (13ha Freiheit 2016). Obwohl es zumindest fraglich erscheint, ob die Ansprüche der Inklusivität, der zwanglosen Konfliktbewältigung und des Konsenses in der 13ha Freiheit-Wohngruppe tatsächlich immer zu erreichen sind, liefert sie doch zumindest ein Beispiel dafür, wie politische Selbstbestimmung und Demokratie schon im kleinsten Rahmen ausprobiert, praktiziert und gemeinsam mit anderen gelebt werden kann. Dem Doppelanspruch nicht nur soziale Wohngruppe, sondern auch eine “Schule der Demokratie“ zu sein, kommen sie z.B. dadurch nach, dass sie sich im Turley-Beirat mit anderen Akteuren wie Investoren, Initiativen, Verbänden und der Stadtverwaltung über wichtige Entscheidungen in Bezug auf den Fortgang der Planungen im Quartier beraten (Weißbuch 2014: 44; KM 2016).[80] Im Sommer diesen Jahres wurden die letzten Sanierungs- und Bauarbeiten abgeschlossen und die drei Wohngruppen haben ihr neues Zuhause auf dem Turley-Gelände bezogen. Die Kooperation der Stadt Mannheim mit den Initiativen umfasste zwei Schritte: 1. Die MWSP Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Mannheim erwarb das Turley-Areal, um es der Bodenspekulation zu entziehen, und trat daraufhin in Verhandlung mit potenziellen Interessenten, darunter auch die drei Wohngruppen. 2. Mit der Gründung des Turley-Beirats ermöglichte die Stadt Mannheim, dass die Wohngruppen gemeinsam mit anderen Akteuren und Einwohnern aus der Nachbarschaft in einen langfristigen und offenen Beratungsprozess über die weitere Planung des Quartiers einbezogen wurden.
Die Konversion in Mannheim ist lange noch nicht abgeschlossen und wird weiterhin die Kraft, die Zeit und den Einsatz der daran Beteiligten in Anspruch nehmen. Dennoch lässt sich bereits sagen, dass damit einer der bisher umfangreichsten und nachhaltigsten Beteiligungsprozesse im Bereich der Stadtentwicklung in Deutschland initiiert wurde. Entsprechend begeistert äußerte sich Oberbürgermeister Kurz über die Ergebnisse der Beteiligung (Weißbuch 2013: 5): „Ich habe noch selten eine Diskussionskultur auf so hohem Niveau erlebt. Das ist nicht nur Beteiligung von Bürgern, sondern ein echter Teilhabeprozess.“ Der Charakter der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Mannheimer Konversion basiert dabei auf drei Ebenen (Weißbuch 2014: 17): 1. Beteiligung an Verwaltungsprozessen (Bürgerforum, Planungsgruppen), 2. Direktdemokratische Elemente (Bürgerentscheid), 3. Teilhabe als offene Mitverantwortung und Kooperation mit Investoren und Stadtplanung (Workshops, Turley Beirat).
Im Zeitraum vom 22. 11.2012 bis zum 15.02.2013 wurde die Untersuchung Demokratie Audit Mannheim des Mannheimer Zentrums für Europäische Zentralforschung (MZES) durchgeführt, um die politischen Einstellungen der Bürger in Mannheim zu ermitteln: „Die Ergebnisse des ersten Demokratie Audits Mannheim zeigen eine starke Verbundenheit der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt sowie eine hohe Zufriedenheit mit dem Leben in dieser Kommune. Die politischen und administrativen Institutionen der Stadt genießen Vertrauen und Unterstützung. Dies spiegelt sich auch in eher positiven Beurteilungen der Performanz von Institutionen, wie beispielsweise des Oberbürgermeisters oder der Stadtverwaltung, wider“ (Deth 2014: 155). Das Ergebnis einer hohen Zufriedenheit mit der Stadt und dem Funktionieren der Demokratie geht dabei teilweise auch auf die großzügige Beteiligung im Rahmen der Mannheimer Konversion zurück. Entsprechend gaben 79 Prozent der Befragten an, von der Konversion in Mannheim zu wissen und 43,2 Prozent äußerten sich zufrieden bezüglich der Beteiligung (Weißbuch 2014: 14). Dagegen gaben nur 13,4 Prozent an, dass das Beteiligungsangebot nicht ausreiche, 35 Prozent erklärten zwar kein Interesse an einer konkreten Beteiligung im Rahmen der Mannheimer Konversion zu haben, aber ausreichend informiert werden zu wollen und nur 8,4 Prozent gaben an, überhaupt kein Interesse zu haben (Weißbuch 2014: 14). Insgesamt hat die umfassende Beteiligung im Rahmen der Konversion in Mannheim einen Anteil an der relativ stark ausgeprägten Demokratiezufriedenheit in der Stadt. Hierauf deutet auch die Vielzahl an positiven Rückmeldungen und Statements von beteiligten Bürgern in Bezug auf den Konversionsprozess, von denen einige im dritten Weißbuch (siehe 2014: 30–39) abgedruckt sind. Aber es zeigt sich auch, dass längst nicht alle Bürger die Beteiligungsangebote nutzen wollen oder können, da sie entweder kein Interesse bzw. keine Zeit haben oder aber aus anderen Gründen verhindert sind. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass entsprechend dem Bundestrend auch in Mannheim die sozial Aktiven, höher Gebildeten und Wohlhabenden, politisch wesentlich aktiver sind: „Ein niedriges Bildungsniveau, soziale Inaktivität sowie das Fehlen einer deutschen Staatsbürgerschaft hingegen fördern politische Inaktivität“ (Weißbuch 2014: 14).[81] Mit den Workshops für Jugendliche und Migranten sowie den sozialen Wohnprojekten wurden im Rahmen der Mannheimer Konversion zwar auch Wege bestritten, um der Beteiligungsgerechtigkeit ein Stück näher zu kommen und politische Gleichheit so gut wie möglich sicherzustellen. Aber auch diese Maßnahmen können ein gewisses Maß an Ungleichheit nicht verhindern.
Es wird an dieser Stelle deutlich, dass der Grundsatz der politischen Gleichheit nicht als absoluter Maßstab der Demokratie gelten kann, da das konstitutive Spannungsverhältnis zwischen politischer Freiheit und politischer Gleichheit nicht einseitig zugunsten der Gleichheit aufgelöst werden darf. Der Preis wäre es, die Freiheit zu zerstören. Was wäre das wohl für eine Demokratie, in der die Wahlpflicht eingeführt und auch Bürgerbeteiligung nicht mehr freiwillig, sondern als Bürgerpflicht abzuleisten, wäre? Es wäre nicht zuletzt eine angeordnete Demokratie, die mit dem in dieser Arbeit zugrunde gelegten Begriff der politischen Beteiligung und auch mit den drei vorgestellten Demokratietheorien völlig inkompatibel wäre. Es wäre eventuell zwar eine gleichere Demokratie, aber es wäre – und hier passt der Begriff von Markus Miessen – ein Alptraum der Partizipation.[82] Dies bedeutet auf der anderen Seite aber auch nicht, dass der Anspruch politischer Gleichheit fallengelassen oder etwa zugunsten der Freiheit geopfert werden müsste – dies wäre nämlich gleichbedeutend mit der einseitigen Auflösung des Spannungsverhältnisses nur diesmal in die andere Richtung der politischen Freiheit. Beteiligungsbarrieren müssen abgebaut und niedrigschwellige Angebote, da, wo es möglich ist, geschaffen werden. Es bleibt insofern noch sehr viel zu tun.
4 Eine Bewertung der drei Demokratieverständnisse unter Berücksichtigung der dargestellten unkonventionellen Partizipationsbeispiele in der Stadtentwicklung
Zu These 1: Das deliberative Modell von Habermas ist nicht dazu geeignet, um die Rolle unkonventioneller Partizipation im Bereich der Stadtentwicklung angemessen zu beschreiben. Diese Vermutung lässt sich in Bezug auf die dargestellten Partizipationsbeispiele bestätigen: Das Problem in Bezug auf das deliberative Modell von Habermas ist, dass er die Rolle unkonventioneller Partizipation mit dem Diskursprinzip und den Kommunikationsbedingungen normativ überfrachtet: In einer deliberierenden Öffentlichkeit sollen die Teilnehmer eines öffentlichen, inklusiven, informierten, machtfreien und unparteiischen Meinungs- und Willensbildungsprozesses eine öffentliche Meinung generieren. Aber ist dieser Gedanke nicht viel zu optimistisch und wirklichkeitsfern? Welche politische Öffentlichkeit oder welches Verfahren sollte in der Lage sein, die anspruchsvollen Bedingungen auch nur annähernd zu erfüllen und aus der unübersichtlichen Vielfalt an Stimmen und Meinungen in den pluralistischen Gesellschaften von heute eine öffentliche Meinung zu generieren? In Kleingruppen stellt Konsensfindung bereits eine Herausforderung dar, wogegen sie in Bezug auf größere politische Einheiten (Kommune, Land, Bund) bereits kaum noch möglich erscheint. Dies wurde auch in Bezug auf die untersuchten Fallbeispiele im Bereich der Stadtentwicklung deutlich: Die Stuttgart 21-Auseinandersetzung hat gezeigt, in was für einen, unauflöslichen Dissens sich die Projektbefürworter und -gegner mit ihren gegenteiligen Meinungen in Bezug auf Stuttgart 21 begaben. Erst das Ergebnis des Volksentscheids konnte klären, dass es neben der (unterschiedlich begründeten) Kontra-Meinung der Protestbewegung auch eine Pro-Stuttgart-21-Meinung in der politischen Öffentlichkeit gab, die sogar von einer knappen Mehrheit in Stuttgart und Baden-Württemberg vertreten wurde. Was den Konflikt in Stuttgart zumindest vorläufig beenden konnte, waren nicht etwa die überzeugenden Argumente der S 21-Befürworter, sondern die relativ eindeutige Niederlage der Projektgegner beim Volksentscheid. Natürlich spielten Argumente eine wichtige Rolle in Bezug auf die Information der Öffentlichkeit im Vorfeld des Volksentscheids, aber sie trugen nicht zur Lösung des Konfliktes im Sinne eines rationalen Konsenses bei. Auch im Rahmen der Mannheimer Konversion haben die politisch Verantwortlichen der Stadt die Durchführung eines Bürgerentscheids beschlossen, um die Kontroverse über die Kosten und den Nutzen der Bundesgartenschau 2023 vorläufig zu beenden und eine Lösung in Bezug auf die Streitfrage (BUGA23 Ja-oder-Nein?) zu erzwingen. Obwohl in Mannheim alle von der Konversion Betroffenen in einem frühzeitigen und umfassenden Beteiligungsprozess eingebunden wurden und der Vorschlag der Veranstaltung einer Bundesgartenschau aus der Bürgerschaft selbst kam, konnte der Dissens zwischen den BUGA23-Befürwortern und den BUGA23-Gegnern nicht verhindert werden. Dies ist im Vergleich zum Stuttgart 21-Beispiel eine wichtige Erkenntnis, die zeigt, dass Dissense und Konflikte in Beteiligungsprozessen auch entstehen können, wenn diese, wie im Fall der Mannheimer Konversion, nach relativ hohen Qualitätsstandards durchgeführt werden. Das knappe Ergebnis des Bürgerentscheids von 50,7 Prozent zwang die BUGA23-Gegner letztlich dazu, ihre Niederlage in der Streitfrage zu akzeptieren. Zwang und bindende Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip sind für Habermas allerdings unvereinbar mit dem Anspruch des kommunikativen Handelns, nach dem es das primäre Ziel sein sollte, nur den zwanglosen Zwang des besseren Arguments gelten zu lassen und dadurch ein intersubjektives Einverständnis mit anderen zu erzielen. Hier wird eine zentrale Schwäche des deliberativen Modells von Habermas deutlich, denn mit seinem auf vorbehaltlose Verständigung und Open-End-Diskussion ausgerichteten Modell, fehlt ihm ein Rezept dafür, wie mit unauflöslichen Dissensen und Konflikten umzugehen sei: Was soll die Deliberation beenden, wenn es darin nicht von selbst zur Einigung zwischen den Diskursteilnehmern kommt?
Aus dieser Sicht wäre den politisch Verantwortlichen in Mannheim allein die Möglichkeit geblieben, weiter auf die BUGA23-Gegner einzureden und sie mit besseren Argumenten doch noch zu überzeugen. Aber was ist, wenn sich die BUGA23-Gegner gar nicht überzeugen lassen wollten, da für sie mit dem Erhalt des Naturschutzgebietes der Feudenheimer Au emotionale Werte verknüpft waren? Auch in Stuttgart ging es für die S 21-Gegner nicht nur um verkehrliche, ökonomische, soziale oder ökologische Argumente, sondern offenbar auch um postmaterielle Werte bzw. um das Bewahren von positiv besetzten Orten (z.B. den Kopfbahnhof und den Schlossgarten). Sind in einer politischen Auseinandersetzung Identität und Emotionen im Spiel, dann wird man keinen Erfolg damit haben, die Gegenseite mit rationalen Argumenten überzeugen oder an ihre Vernunft appellieren zu wollen. Die Scheu vor zwingenden Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip verunmöglicht es der Habermasschen Konzeption, neben der Legitimität auch die notwendige Effektivität und Stabilität des politischen Prozesses im Auge zu behalten. Die nach dem Mehrheitsprinzip getroffenen Beschlüsse im Gemeinderat stellen aber selbstverständlich die Grundlage aller städtebaulichen und landschaftlichen Planungsprozesse der Stadtentwicklung dar, weil es für die politischen Repräsentanten absurd und unmöglich wäre, jeden Einwand gegen konkrete Planentwürfe ernst nehmen und durch Argumente zerstreuen zu wollen. Das Gleiche gilt aber auch im Hinblick auf Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung: Die Teilnehmer an solchen Verfahren nehmen sich teilweise nach ihrer Arbeit Zeit, um sich in Gruppen gemeinsam für verschiedene Bereiche der städtischen Zukunft zu engagieren. Da wäre es einfach nur frustrierend und nicht zielführend, keine geeigneten Entscheidungsmechanismen nach dem Mehrheitsprinzip anwenden zu können und ständig jeden Einzelnen von einem Vorschlag bzw. einer Lösung überzeugen zu müssen. Auch eine demokratische Stadtentwicklung braucht mehrheitliche Abstimmungsmechanismen, um Zeit zu sparen, effektiv zu sein und nach außen hin eine gewisse Planungssicherheit gegenüber Investoren und Baufirmen gewährleisten zu können.
Eine weitere Schwachstelle des Habermasschen Modells ist die darin enthaltene, strikte Vorrangstellung des kommunikativen Handelns gegenüber dem strategischen Handeln. Es wird damit eine interessenlose und verständigungsorientierte Haltung der politischen Akteure verlangt, die sowohl empirisch wie auch normativ fragwürdig ist. Denn warum sollten materielle Eigeninteressen nicht in die Deliberationsprozesse eingebracht werden dürfen, wenn Verteilungsfragen in Bezug auf die meisten öffentlichen Entscheidungen doch zumindest teilweise auch eine Rolle spielen? Die Stuttgart 21-Gegner gingen auf die Straße, um sich gegen die massiven Eingriffe in ihrem direkten Lebensumfeld zu wehren – natürlich hatten sie kein Interesse an den mit den Bauarbeiten verbundenen Veränderungen (Abriss des Kopfbahnhofes) und Widrigkeiten (Baulärm und -schmutz). Dies bedeutet aber nicht, dass die Proteste in Stuttgart deshalb auf ein Not-In-My-Back-Yard-Phänomen (NIMBY) zu reduzieren wären. Vielmehr ist zu vermuten, dass sich Eigeninteressen und andere Motive bei den Protestierenden vielfach überlagerten. Auch die erwähnten, sozialen Wohnprojekte hatten ihr kollektives Gruppeninteresse an dauerhaft günstigen Mietpreisen bei gleichzeitig hoher Wohnqualität gleich zu Beginn des Mannheimer Konversionsprozesses artikuliert und sind daraufhin in eine Kooperation mit der Stadt getreten. Warum hätten sie ihre Eigeninteressen allerdings nicht einbringen sollen?
Nach dem Schleusenmodell von Habermas soll die öffentliche Meinung von der Zivilgesellschaft mit Protest und zivilem Ungehorsam propagiert werden, so dass der Gebrauch der administrativen Macht innerhalb des politischen Systems auf den offiziellen Machtkreislauf umgestellt wird und die Doppelrolle der Bürger als Adressaten und Autoren des Gesetzes aufgeht. Es gibt aber, wie in Bezug auf Stuttgart 21 deutlich wurde, nicht eine öffentliche Meinung in der politischen Öffentlichkeit. Vielmehr bilden sich darin häufig gegenteilige und verschieden begründete Meinungspaare (Ja/Nein) zu bestimmten Streitfragen, die im öffentlichen Wettkampf in den politischen Arenen darum streiten, Mehrheiten hinter sich zu bringen bzw. die Meinungshoheit zu gewinnen. Den Mannheimer Konversionsprozess kann das Schleusenmodell auch nicht erklären, da es von einer strikten Arbeitsteilung zwischen der institutionellen Politik und der Zivilgesellschaft ausgeht. Unkonventionelle Beteiligung reicht laut Habermas nicht in den Bereich politischer Teilhabe, sondern meint vor allem Beeinflussung und Konsultation der institutionellen Politik. Diese Trennung wurde in Mannheim aber teilweise aufgehoben, indem die Bürger zeitweilig dazu eingeladen wurden, selbst in die Rolle des Stadtentwicklers zu schlüpfen. Bürgerbeteiligung meinte im Rahmen der Mannheimer Konversion auch Verantwortung zu übernehmen und mit der Verwaltung und anderen Akteuren in verschiedenen, kooperativen Arrangements zusammen zu arbeiten. Das deliberative Modell ist daher nicht in der Lage, die Fallbeispiele angemessen zu erklären.
Zu These 2: Das radikaldemokratische Modell von Mouffe ist ebenfalls nicht dazu geeignet, um die Rolle unkonventioneller Partizipation im Bereich der Stadtentwicklung angemessen zu beschreiben. Die These muss relativiert werden, weil sich während des Forschungsprozesses herausgestellt hat, dass die Theorie von Mouffe einige bedeutende Stärken, aber wie zunächst erwartet, auch bedeutende Schwächen hat. Die Stuttgart 21-Auseinandersetzung lässt sich mit ihrem Modell gut erklären. Die Top-down-Politik der S 21-Befürworter hat z.B. viel Ähnlichkeit mit dem, was Mouffe als Politik der Mitte[83] bezeichnet: Die Rhetorik der Alternativlosigkeit und das Primat ökonomischer Zielsetzungen, die für das Agieren der Bahn und der politisch Verantwortlichen charakteristisch waren, stehen hiefür symptomatisch. Dass, wie in Stuttgart, eine linksorientierte Protestbewegung entstand und gegen die neoliberale Stadtentwicklung aufbegehrte, ist nach der Mouffschen Konzeption explizit erwünscht und vorgesehen. Ihr Modell bietet in diesem Zusammenhang durchaus geeignete Analyseinstrumente, um a) die Entstehung, b) das strategische Vorgehen und c) den Organisationsaufbau der Bewegung in Stuttgart zu erklären.
Kollektive Identitäten definieren sich nach Mouffe bekanntlich, indem sie sich durch eine Wir-Sie-Unterscheidung von einem anderen abgrenzen und sich dadurch im Raum des Politischen erst selbst hervorbringen. Die Stuttgart 21-Gegner konstituierten sich entsprechend in Abgrenzung zum Bauvorhaben, das sie wegen der enormen Kosten als “Milliardengrab“ bezeichneten, und zu den Projektbefürwortern, die sie wegen dem Verdacht der eigenen Vorteilsnahme als “Maultaschen Connection“ bezeichneten. Ein strategischer Vorteil der Protestbewegung war, dass sie nicht auf einer Ablehnung von S 21 verharrten, sondern mit der Kopfbahnhof-21-Variante selbst einen positiven Gegenentwurf anboten, der ihrer Meinung nach einfacher und günstiger zu realisieren war. Mit der Ausbuchstabierung einer angeblich besseren Alternative zu Stuttgart 21 führten die Gegner die Rhetorik der Alternativlosigkeit der Projektbefürworter ad absurdum. Damit ist hier, auf lokalpolitischer Ebene, ein Praxisbeispiel dafür gegeben, was Mouffe damit gemeint haben könnte, wenn sie neben dem ersten negativen Moment der Disartikulation der neoliberalen Hegemonie ein zweites positives Moment der Reartikulation einer hegemonialen Alternative fordert. Die bei den Protesten verwendeten Zeichen „Kopfbahnhof 21“ oder „oben bleiben!“ brachten nicht nur die Präferenz einer anderen Verkehrslösung zum Ausdruck, sondern wurden zu Symbolen für eine politisch selbstbestimmte und unter finanziellen, ökologischen sowie sozialen Aspekten nachhaltigen Stadtentwicklung. Mit ihrem utopischen Gegenentwurf wies die Bewegung in Stuttgart über ihr konkretes Anliegen (Verhinderung von Stuttgart 21) hinaus und bot damit auch anderen städtischen Bewegungen eine Inspirationsquelle für ihre je eigenen Proteste.
Der Dissens wurde von der Protestbewegung mittels unterschiedlichen Protestformen (wie z.B. Schwabenstreiche, Massendemonstrationen, ziviler Ungehorsam) öffentlich inszeniert und artikuliert.[84] Im Übrigen blieb von der Bewegung der Kodex weitgehend gewahrt, ihre Gegner zwar politisch besiegen zu wollen, ihnen aber dennoch mit Respekt zu begegnen. Zwar waren einige, stark moralisierenden Ausdrücke, wie z.B. “Lügenpack“, gegenüber der Bahn und der Politik eventuell etwas unglücklich gewählt, allerdings deuteten ihre überwiegend friedlichen Protestaktionen doch unmissverständlich auf eine agonistische Wir-Sie-Relation. Umgekehrt beging der Ministerpräsident Mappus mit dem Polizeieinsatz am schwarzen Donnerstag (30.09.2010) den Fehler, die agonistische Relation zwischen dem Staat und den Demonstranten, wenn auch nur für einen kurzen Moment, in eine antagonistische Freund-Feind-Relation verwandelt zu haben. Ob Mappus und die CDU-Landesregierung nun direkt (Anordnung) oder indirekt (Billigung) die Verantwortung für den Einsatz trugen, ist dabei nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass sie mit ihrem autoritären und disrespektierlichen Umgang mit den Projektgegnern und ihren Einwänden das politische Klima dafür schufen, in dem ein solcher Einsatz überhaupt zur Möglichkeit wurde. Bei der Landtagswahl 2011 wurde der autoritäre Politikstil von Mappus und der CDU-Landesregierung jedenfalls deutlich abgestraft. Das Ergebnis der Landtagswahl ermöglichte eine Machtübernahme der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg, die mit ihrer Politik des Gehörtwerdens ein deutliches Signal zugunsten mehr Beteiligung setzte. In Bezug auf den Organisationsaufbau über das Aktionsbündnis lässt sich sagen, dass den Einzelgruppen ihre Unabhängigkeit bezüglich der Wahl ihrer Protestmethoden und -begründungen weitgehend überlassen blieb, das Bündnis aber ihre Aktivitäten miteinander koordinierte. Die Organisation der Bewegung in Stuttgart erinnerte demnach an die Bildung der Äquivalenzketten, die Mouffe in ihrer Konzeption als Organisationsprinzip für das neue linke Projekt vorschlägt. Aber kann die Bewegung in Stuttgart als Bestandteil des neuen linken Projektes verstanden werden, auf das es Mouffe absieht?
Nein, den überhöhten Anspruch dem neuen linken Projekt anzugehören und damit Teil der Äquivalenzkette radikaldemokratischer Kräfte zu sein, erfüllte die Bewegung gegen Stuttgart 21 nicht. Hier zeigt sich die Begrenztheit der Erklärungskraft des Mouffschen Modells: Die Forderung, dass sich alle linksgerichteten Bewegungen zum Zwecke einer (Welt-) Revolution gegen die Hegemonie des Neoliberalismus[85] verbünden sollten, um dann gemeinsam gegen Unterdrückung und zugunsten mehr Freiheit und Gleichheit zu kämpfen, erscheint überzogen und träfe, wenn überhaupt, nur auf sehr wenige Beispiele der unkonventionellen Partizipation zu. Natürlich ließe sich etwa in Bezug auf die Anti-Globalisierungsbewegung oder die Occupy-Bewegung argumentieren, dass hier eine Internationalisierung des Protestes gegen den entfesselten Kapitalismus und die damit einhergehenden globalen Ungerechtigkeiten sichtbar wurde. Auf die Protestierenden gegen Stuttgart 21 traf dieser Anspruch aber nicht zu, weshalb ihr Protest nicht als Bestandteil einer (radikal-) demokratischen (Welt-)Revolution gegen die neoliberale Hegemonie gedeutet werden kann. Vielmehr fanden die Proteste nach dem Volksentscheid ihr jähes Ende, da sich die meisten Bürger womöglich wieder anderen Verpflichtungen und Tätigkeiten (z.B. Arbeit, Familie und Freizeit) zuwandten. Das Engagement der meisten Protestierenden in Stuttgart war punktuell und regional begrenzt, ohne damit sagen zu wollen, dass es deshalb weniger Wert gewesen sei. Aber genau das impliziert Mouffe, indem sie den Fokus ihrer Theorie auf das neue linke Projekt und damit auf die Bühne der Weltpolitik richtet. Was ist mit städtischen Initiativen und Bewegungen? Ist ihre unkonventionelle Partizipation nach Meinung von Mouffe weniger Wert, weil sie keinen Beitrag für das neue linke Projekt leisten, regionalspezifische Anliegen verfolgen und dabei nicht zur (all-)umfassenden Kapitalismuskritik ansetzen? Im Übrigen bleibt gegen Mouffes pauschale Kritik an der neoliberalen Ordnung einzuwenden, dass ihr zu entgehen scheint, dass an den gegenwärtigen kapitalistischen Verhältnissen nicht nur Banken, Unternehmen und Politiker mitwirken, sondern wir alle als Bürger und Konsumenten. Wenn wir uns aber längst mit den kapitalistischen Verhältnissen arrangiert haben und unser Alltagsleben unauflöslich mit ihnen verwoben ist, wie und warum sollten wir die Hegemonie des Neoliberalismus dann als Gegner begreifen und nicht als selbstverständlichen Teil von uns selbst akzeptieren? Um den Widerspruch zu verdeutlichen, kann ein Beispiel genannt werden: Stellen wir uns vor, ein Student nimmt im Rahmen seiner Semesterferien an Protesten der Occupy-Bewegung teil und muss bis zum Ende des nächsten Monats noch einige Prüfungen bestehen. Wäre es für ihn nicht rational, an seine Karriere zu denken und nach einigen Tagen des Protestes wieder nach Hause zu fahren, um zu lernen? Oder nehmen wir die Anti-Globalisierungsaktivisten: Wie viele von ihnen gehen nicht auch zum Discounter oder Supermarkt, um sich dort billige Klamotten oder Nahrungsmittel zu kaufen, die nicht unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden? Diese latenten Widersprüche sollen nicht übermäßig moralisiert werden, zeigen aber, wie schwer oder unmöglich es sein kann, konsequent gegen die neoliberale Hegemonie zu kämpfen.
Eine wichtige Annahme von Mouffe ist, dass Dissens, Gegnerschaft und Konflikt als wertvolle Elemente der modernen Demokratie anerkannt werden sollten, weil damit die Emotionen der Menschen besser geweckt und die Bevölkerung stärker politisiert werden würde, als dies in Bezug auf die Politik der Mitte der Fall wäre. Diese These lässt sich im Hinblick auf die Stuttgart 21-Auseinandersetzung bestätigen. Zwar konnte die Protestbewegung ihr politisches Ziel (Baustopp von Stuttgart 21) aus verschiedenen Gründen nicht erreichen, aber dennoch konnte sie beachtliche (Teil-)Erfolge erzielen: So wären a) die Information der Öffentlichkeit mit Pro- und Kontra-Argumenten, b) der Anstieg der Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011 sowie der mit dem Wahlergebnis verbundene Regierungs- und Politikwechsel und c) die bei der Volksabstimmung ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung ohne die Massenproteste in Stuttgart nicht denkbar gewesen. Indem die Gegner ihren Dissens mit dem Stuttgart 21-Projekt und seinen politischen Befürwortern öffentlich artikulierten und inszenierten, sorgten sie für mehr Responsivität der repräsentativen Demokratie auf lokalpolitischer Ebene und trugen damit auch zur Kompensation ihrer wachsenden Legitimationsdefizite bei.
Wie der Politikstil des Gehörtwerdens in einen Ansatz zugunsten einer frühzeitigen und umfassenden Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtentwicklung umgesetzt wurde, hat exemplarisch die Mannheimer Konversion gezeigt.[86] Diese wiederum - und hier zeigen sich die Schwächen des agonistischen Modells - kann Mouffe nicht erklären. Dem ist so, weil Mouffe es in ihrer Theorie als Wesensmerkmal kollektiver Identitäten begreift, dass sie sich im Raum des Politischen über Wir-Sie-Unterscheidungen und den Einsatz von Ausschluss und Macht selbst hervorbringen müssten. Politik hat damit unvermeidlich mit Abgrenzung und Konflikt zu tun. Das Maximalziel wäre demnach, dass sich die Akteure mit ihren unterschiedlichen Werten, Forderungen und Machtinteressen auf eine Gegner-Relation (Agonismus) einließen und sich nicht als Feinde (Antagonismus) ansehen würden. Aber hier begeht Mouffe einen widersprüchlichen Fehler im Rahmen ihrer eigenen Theorie. Denn wenn wir die radikaldemokratische Kernthese akzeptieren, dass die Demokratie ohne Letztbegründung auskommt (Grundlosigkeit der Demokratie), dann darf ihr die politische Theorie von außen weder Konsens, Gemeinsamkeit und Verständigung (Habermas), noch Dissens, Gegnerschaft und Konflikt (Mouffe) als notwendige Bedingungen zuschreiben. Es ist durchaus interessant, dass gerade Mouffe, die Habermas im Rahmen ihrer Theorie häufig als Ausgangspunkt ihrer Kritik an einem einseitig konsensorientierten Politikbegriff verwendet, selbst einen ganz ähnlichen Fehler begeht, indem sie nämlich ihrerseits einen einseitig dissensorientierten Politikbegriff entwirft. In ihrer Versteiftheit auf Dissens entgeht Chantal Mouffe, dass politische Selbstbestimmung für zivilgesellschaftliche Gruppen in der politischen Praxis nicht zuletzt auch über Kooperation mit staatlichen Akteuren aufgehen kann. Im Gegensatz zum Stuttgart 21-Beispiel zeigt die Mannheimer Konversion, dass ein kooperatives Zusammenagieren zwischen der Bürgerschaft und der Politik bzw. der Verwaltung in der Stadtentwicklung durchaus möglich sein kann, wenn die Beteiligung an entsprechenden Entscheidungsprozessen frühzeitig und umfassend erfolgt. Die Wohngruppenprojekte waren ein Beispiel dafür, dass die politische Selbstbestimmung von linken Bürgerinitiativen in der Stadtentwicklung nicht automatisch auf eine konfliktive Wir-Sie-Dichotomie mit den politisch Verantwortlichen hinauslaufen muss. Warum hätten sich die sozialen Wohngruppen gegen die politisch Verantwortlichen der Stadt Mannheim auflehnen sollen, wenn Letztere sich von ihrer Projektidee von Beginn an begeistert zeigten und mit ihnen über die genaue Realisierung berieten? Es gab für sie keinen Grund sich gegen das Projekt der Konversion und gegen die Stadt Mannheim zu stellen. Insgesamt ist dem Modell von Mouffe darin zuzustimmen, dass Dissens, Gegnerschaft und Konflikt wertvoll und belebend für die moderne Demokratie sein können. Dies konnte im Hinblick auf die Aktivitäten der Protestbewegung gegen S 21 und die daraus resultierende Auseinandersetzung gezeigt werden. Nicht übereinzustimmen ist Mouffe aber darin, dass Dissens, Gegnerschaft und Konflikt für das Gelingen der modernen Demokratie zwingend notwendig wären. Dies ließ sich in Bezug auf das Beispiel des Konversionsprozesses in der Stadt Mannheim bestätigen.
Zu These 3: Das pragmatische Modell von Mansbridge ist am besten dazu geeignet, um die Rolle unkonventioneller Partizipation im Bereich der Stadtentwicklung angemessen zu beschreiben. Diese Vermutung lässt sich im Hinblick auf die dargestellten Partizipationsbeispiele bestätigen. Bezüglich der Theorie von Mansbridge hat es sich als Vorteil erwiesen, dass sie darin die politische Praxis normativ weder auf Konsens noch auf Dissens festgelegt. Stattdessen geht es ihr um die Vereinbarkeit beider Elemente in der pluralistischen Demokratie: In öffentlichen Deliberationen sollen die verschiedenen Akteure einer politischen Gemeinschaft selbst herausfinden, welches ihre Präferenzen, Werte und Interessen in Bezug auf ein politisches Thema sind und welche Lösungsmöglichkeiten sich daraus ergeben. Mit dem Vier-Phasen-Modell wird zudem eine konkrete Verfahrensweise dafür angegeben, wie Akteure in der politischen Praxis zu gegenseitigen Übereinstimmungen, integrierten Lösungen, fairen Kompromissen oder Abstimmungsergebnissen nach dem Mehrheitsprinzip gelangen können. Die Anwendbarkeit des pragmatischen Modells von Mansbridge auf die Stuttgart 21-Auseinandersetzung und die Mannheimer Konversion wird im Folgenden demonstriert.
Aus der Perspektive des pragmatischen Modells entstand die S 21-Auseinandersetzung aufgrund der fehlenden Dialog- und Verhandlungsbereitschaft der Projektbefürworter gegenüber der Zivilgesellschaft. Demnach fand keine öffentliche Deliberation über die Legitimität von Stuttgart 21 statt. Die Weigerung der Bahn und der Politiker sich mit kritischen Einwänden bezüglich der Auswirkungen der Baumaßnahmen auf das direkte Lebensumfeld der Einwohner zu befassen (vs. mutual communication) und Stuttgart 21 wegen der zunehmenden Bedenken in der Öffentlichkeit auf Alternativen hin zu überprüfen (vs. weighing and reflecting), lösten demnach den Widerstand und die Protestbereitschaft bei den Projektgegnern aus. Dies wurde in Umfragen bestätigt, nach denen die Mehrheit der Protestierenden ihr Engagement mit den Demokratiedefiziten während der Planung des S 21-Projektes und im Umgang der politisch Verantwortlichen mit den Einwänden der Projektgegner begründete. Stuttgart 21 kann demnach als Symptom für die wachsenden Legitimationsdefizite repräsentativer Demokratie auf lokalpolitischer Ebene interpretiert werden. Und die Proteste waren eine Gegenreaktion auf die Demokratiedefizite und zielten auf mehr politische Selbstbestimmung bzw. Bürgerbeteiligung.
Weil im Planungsprozess sukzessive Kostensteigerungen bezüglich Stuttgart 21 bekannt wurden und diese z.T. durch erhebliche Steuermittel gegenfinanziert werden sollten, begriffen immer mehr Einwohner das Thema als öffentliche Angelegenheit. Neben den Baumaßnahmen und ihren negativen Begleiterscheinungen (Zerstörung positiv besetzter Orte, Baulärm und -schmutz) war es vor allem auch der freigiebige Umgang der Politiker mit den Steuergeldern, der das Eigeninteresse vieler Projektgegner berührte. Entsprechend gab in den Umfragen eine große Mehrheit der Protestierenden die hohen Kosten als Hauptmotiv für ihr unkonventionelles Engagement an. Die Frage nach der Realisierung von S 21 stellte ein kollektives Handlungsproblem dar, denn mit der Verwendung von erheblichen Steuermitteln stellt sich immer die Frage, ob diese Ausgaben gerechtfertigt sind und ob das Geld nicht besser für andere Zwecke verwendet werden könnte. Genau wie die Legitimitätsfrage blieb aber auch die Finanzierungsfrage von S 21 durch die Top-down-Politik der Befürworter einer öffentlichen Diskussion weitgehend entzogen und damit unbehandelt. Die Politiker entschieden einfach, dass das Bauprojekt für die Stadt unverzichtbar sei und das dafür auch erhebliche Steuermittel investiert werden könnten, ohne dabei die Einwohner nach ihren Präferenzen, Werten und Interessen zu befragen. Diese Haltung spiegelt ein autoritäres Demokratieverständnis wider, nach dem die turnusmäßig gewählten Repräsentanten öffentliche Entscheidungen im Bereich der Stadtentwicklung allein und ohne Rücksprache treffen können. Dass dieses Verständnis nicht (mehr) dazu taugt, um die Stadtgesellschaft im Ganzen zufriedenzustellen, sondern mit den gestiegenen Partizipationsansprüchen vieler Einwohner geradezu in einen Konflikt zuläuft, hat die S 21-Auseinandersetzung eindrucksvoll bewiesen. Zusammenfassend kann der S 21-Konflikt mit dem Vier-Phasen-Modell beschrieben werden: 1. Entstehung und Mobilisierung der Protestbewegung 2007 bis 2010 (pre-deliberation), 2. Schlichtungsverfahren und Information der Öffentlichkeit mit Pro- und Kontra-Stuttgart 21-Argumenten im Vorfeld der Volksabstimmung (full scale deliberation), 3. Die Volksabstimmung über das S 21- Kündigungsgesetz 2011 (fair aggregation).
Mit den normativen Maßstäben von Jane Mansbridge kann zudem aufgezeigt werden, warum das sog. Schlichtungsverfahren nicht wirklich zur Schlichtung bzw. Lösung des Konfliktes beitragen konnte. Zwar wurden die Maßstäbe des gegenseitigen Respekts, der Klärung der Interessen und des epistemischen Wertes darin teilweise erfüllt. Jedoch konnten mit dem Verfahren die Maßstäbe der Abwesenheit von Macht und der gleichen Möglichkeiten bzw. Inklusion nicht erfüllt werden, weil die eigentliche Entscheidung längst getroffen war und das Ergebnis der Schlichtung damit bereits im Voraus feststand. Der Schlichterspruch von Geißler basierte zudem nicht auf dem freiwilligen Übereinkommen beider Konfliktparteien und hatte keinerlei rechtliche Verbindlichkeit. Insgesamt stellt die Schlichtung ein Beispiel für schlechte Deliberation dar bzw. kann als Negativbeispiel dafür gelten, wie Bürgerbeteiligung nicht organisiert werden sollte. Erst mit der Volksabstimmung zum Stuttgart 21-Kündigungsgesetz im November 2011 konnte doch noch eine rechtsverbindliche und abschließende Entscheidung bezüglich des Konfliktes getroffen werden. Zwar wurde durch das zwingende Abstimmungsergebnis zugunsten einer Fortführung des Stuttgart 21-Projektes der normative Maßstab der Abwesenheit von Macht nicht erfüllt, aber nach dem pragmatischen Modell ist dies ein regulatives Ideal, welches zum Zwecke einer mehrheitlichen Entscheidungsfindung übergangen werden kann, wenn sich anders keine Lösung finden lässt. Und wer würde wohl behaupten, dass sich in Bezug auf den festgefahrenen Dissens zwischen den S 21-Projektbefürwortern und -gegnern noch ein anderer Weg der Konfliktbewältigung hätte finden lassen? Von der grün-roten Landesregierung war es aus Sicht des pragmatischen Modells daher richtig und notwendig, dass sie die Legitimitätsfrage bezüglich Stuttgart 21 abschließend dem Votum der Bürgerschaft in Baden-Württemberg überließ. Damit räumte sie einerseits das Demokratiedefizit aus, das dem Projekt anhaftete, und erzwang andererseits zumindest ein vorläufiges Ende in Bezug auf die Streitfrage. Nach der Beurteilung des pragmatischen Modells hätte der Konflikt in Stuttgart aber potenziell verhindert werden können, wenn die Projektbefürworter bereits während der frühen Planungsphase im Rahmen von öffentlichen Deliberationen auf die Präferenzen, Werte und Interessen der Einwohner eingegangen wären oder aber zumindest zu einem späteren Zeitpunkt einmal in Verhandlung mit den S 21-Projektgegnern getreten wären.
Insoweit es in dieser Arbeit beurteilt werden kann, hat die Bürgerbeteiligung in Mannheim den normativen Maßstäben von Mansbridge (gegenseitiger Respekt, Abwesenheit von Macht, Klärung der Interessen, epistemischer Wert, gleiche Möglichkeiten und Inklusion) weitgehend entsprochen und insofern einen wertvollen Beitrag zur Demokratisierung der Stadtentwicklung geleistet. Die Konversion ist daher als ein Beispiel für gute Deliberation zu beurteilen bzw. liefert ein Positivbeispiel dafür, wie Bürgerbeteiligung gelingen kann. Im Vergleich zu Stuttgart 21 hat sich in Mannheim der frühe Zeitpunkt der Beteiligung als Vorteil erwiesen: Schon vor der eigentlichen Planung und den dafür notwendigen Beschlüssen im Gemeinderat wurden alle Einwohner im Rahmen des Weißbuchprozesses dazu eingeladen, ihre Vorschläge und Gestaltungswünsche in Bezug auf die ehemaligen Militärflächen mitzuteilen. Die Stadt Mannheim legte keinen “Masterplan“ zur Bebauung oder Nutzung der Konversionsflächen vor, sondern ließ sich dabei auf die Präferenzen, Werte und Interessen der Bürger ein. Aber die Beteiligung im Rahmen der Konversion ging über das einmalige Abfragen von Vorschlägen und Ideen hinaus und bot den Bürgern in verschiedenen Kontexten und Aufgabenbereichen umfassende Möglichkeiten, um den Prozess aktiv und nachhaltig mitzugestalten. Nicht nur die Beeinflussung von politischen Entscheidungen war das Ziel in Mannheim, sondern die Bürger sollten darüber hinaus auch tatsächliche politische Teilhabe und Mitverantwortung in Bezug auf die Konversion übernehmen.
Die weitere Projektentwicklung der Marken Grün und Wohnen lässt sich auch mit dem Vier-Phasen-Modell von Mansbridge erklären. Zur Entwicklung der Marke Grün: Der Vorschlag, die Realisierung eines Grünzuges mit dem Event einer Bundesgartenschau in Mannheim zu kombinieren, stammte aus einer Arbeitsgruppe, die sich während des Weißbuchprozesses kooperativ über mögliche Projektideen beriet (pre-deliberation). Nachdem die Stadt die Idee aufgegriffen und sich für die Bundesgartenschau 2023 beworben hatte, regte sich in der Öffentlichkeit unerwartet Widerstand gegen das Event, da viele Einwohner das Naturschutzgebiet der Feudenheimer Au bedroht sahen und zu hohe Kosten befürchteten. Ähnlich wie in Stuttgart spaltete die öffentliche Kontroverse die Bürgerschaft auch in Mannheim in BUGA23-Befürworter und BUGA23-Gegner, so dass sich zwei unvereinbare Positionen gegenüberstanden (full-scale-deliberation). Um dennoch zu einem Ergebnis zu kommen, wurde ein Bürgerentscheid durchgeführt, der knapp für die Durchführung der BUGA 2023 in Mannheim ausfiel (fair aggregation).
Das Beispiel zeigt, dass Konsens und Verständigung in der Stadtentwicklung auch im Fall von frühzeitiger und umfassender Beteiligung nicht immer durchzuhalten sind und es auch dann gelegentlich zu unauflöslichen Konflikten kommen kann. Ist dies der Fall, bedarf es einer Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip, um bezüglich der Streitfrage eine Lösung zu erzwingen und damit nicht nur die Legitimität, sondern auch die Effektivität und Stabilität, des politischen Prozesses zu gewährleisten. Dieser Leitsatz wurde von den Verantwortlichen in Mannheim beherzigt, indem sie sich für einen Bürgerentscheid zur Streitfrage (BUGA23-Ja-oder-Nein?) entschieden. Genau dieser Leitsatz ist es auch den Mansbridge propagiert, indem sie mit ihrem pragmatischen Modell für ein komplementäres Verhältnis zwischen konsensualen und aggregativen Entscheidungsmechanismen eintritt. Ihre Konzeption ist deshalb flexibel und kann auf verschiedene, realpolitische Anforderungen in den pluralistischen Demokratien von heute reagieren.
Zur Entwicklung der Marke Wohnen: Auch die Projektidee der sozialen Wohngruppen entstand aus einer Arbeitsgruppe während des Weißbuchprozesses. Es gründeten sich drei Initiativen, die auf dem Turley-Areal ähnliche Vorstellungen des gemeinschaftlichen Wohnens realisieren wollten. Die Gruppen formulierten nicht nur ein gemeinsames Selbstverständnis (Selbstverwaltung, soziale Gemeinschaft, Nachbarschaftspflege u.a.), sondern artikulierten auch ein materielles (Selbst-)Interesse. Ihr kollektives Interesse lag darin, dauerhaft kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen, was über die Finanzierung mit Privatkrediten einerseits und die Eigentumsverwaltung über das Mietshäuser-Syndikat andererseits gelingen sollte. Ihre Präferenzen, Werte und Interessen fanden die drei Wohngruppen in Beratungen selbst heraus (pre-deliberation). Mit ihren Vorstellungen und Finanzierungskonzepten begaben sich die Initiativen dann in einen Verhandlungsprozess mit den Entscheidungsträgern, der Stadtverwaltung, den Investoren und Architektenbüros, um ihre Projektidee voranzubringen (negotiation). Mittlerweile sind die Renovierungs- und Bauarbeiten auf dem Turley-Gelände abgeschlossen, so dass die Wohngruppen ihre Wohnungen bereits beziehen konnten.
Das Beispiel der Wohngruppen zeigt, dass sich materielle (Selbst-) Interessen nicht einfach, wie Habermas impliziert, durch eine künstliche Trennung zwischen strategischem und kommunikativem Handeln aus den öffentlichen Deliberationen heraushalten lassen. In der politischen Praxis scheinen sich die Überzeugungen und Interessen der Menschen häufig stark zu überlagern, weshalb materielle Forderungen, genau wie Mansbridge im Rahmen ihrer Theorie propagiert, den gleichen Stellenwert wie etwa Argumente in den öffentlichen Beratungsprozessen erhalten sollten. Es ist nicht möglich und auch nicht erstrebenswert die Eigeninteressen aus den öffentlichen Deliberationen herauszuhalten, wenn die darin verhandelten politischen Themen meistens auch verteilungspolitische Aspekte berühren. Und dies gilt besonders für den Bereich der Stadtentwicklung. Denn mit der Modernisierung und städteplanerischen Umgestaltung von Innenstadtbereichen gehen immer auch mehr oder weniger bewusst gesteuerte, soziale Verdrängungsprozesse einher (Stichwort: Gentrifizierung). Wenn, wie z.B. in Stuttgart, ein modernes Büro- und Bankenviertel entstehen soll, dient dies vorrangig den Interessen eines bestimmten Klientels von Einwohnern und nicht zu gleichen Teilen allen Stuttgartern. Die Stuttgart 21-Befürworter hätten nach dem pragmatischen Modell von Mansbridge frühzeitig mit den Projektgegnern in Verhandlung treten und ihnen im Rahmen ihrer städtebaulichen Planung einen Interessenausgleich anbieten können. Womöglich hätte sich ein fairer Kompromiss zwischen ihnen schmieden lassen. Für die ideologische Linke mag sich dies nach einem Plädoyer für die Käuflichkeit und Bestechlichkeit von Protestbewegungen gegenüber der staatlichen Seite anhören. Aber was soll eigentlich schlecht daran sein, mit den politischen Entscheidungsträgern und Behörden in kooperative Verhandlungen bezüglich der Realisierung von Stadtentwicklungsprojekten zu treten? Dass dies mit Berührungsängsten verbunden sein dürfte und nicht ohne Lernbereitschaft und Kompromissfähigkeit auf beiden Seiten funktioniert, ist klar. Das Beispiel der sozialen Wohngruppen im Rahmen der Mannheimer Konversion zeigt aber, dass das politische Bestreben nach Autonomie und Selbstverwaltung von linken Initiativen nicht zwingend im Widerspruch zum Agieren und den politischen Zielen der kommunalen Behörden und Entscheidungsträger stehen muss. Im Fall der Konversion wurden die Bestrebungen nach alternativen Wohnkonzepten und sozialen Freiräumen jedenfalls von Anfang an in den Konversionsprozess mit aufgenommen. Im Vergleich zu Stuttgart 21 hatte dies den Vorteil, dass die linksorientierten Initiativen keinen Grund hatten, sich als Gegner gegenüber dem Stadtentwicklungsprojekt der Konversion in Mannheim und den politischen Entscheidungsträgern zu artikulieren. Die politische Selbstbestimmung zivilgesellschaftlicher Akteure muss demnach nicht zwingend, wie Mouffe annimmt, in eine Wir-Sie-Dichotomie und in Dissens, Gegnerschaft sowie Konflikt zulaufen. Im Gegenteil kann es sich, wie das Beispiel in Mannheim zeigt, auch für linke Initiativen lohnen, in ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Politikern und Behörden zu treten.
Fazit
Wie in dieser Masterarbeit festgestellt wurde, reichen die Effektivität und Stabilität des politischen Prozesses allein nicht mehr aus, um die Einwohner in Bezug auf die öffentlichen Entscheidungen im Bereich der Stadtentwicklung zufriedenzustellen. Im Gegenteil wollen die Bürger stärker einbezogen werden und auch mitreden, wenn es, wie im Fall von Stuttgart 21, um den Bau von Großprojekten oder, wie im Fall der Mannheimer Konversion, um die Neugestaltung und (Wieder-)Aneignung des urbanen Raumes geht. Zwar deuten die Zahlen und Statistiken seit Jahren auf einen Rückgang konventioneller Beteiligungsformen, wie z.B. die Teilnahme an Wahlen oder die Mitarbeit in Parteien und Verbänden, aber zugleich scheint das Bedürfnis nach unkonventionellen Beteiligungsformen, wie z.B. die Teilnahme an Protest und Bürgerbeteiligungsangeboten, gerade auf der lokalpolitischen Ebene zuzunehmen. Daher war es im Rahmen dieser Arbeit richtig und wichtig, zunächst die Hauptbegriffe konventionelle und unkonventionelle Partizipation, Protestbewegung und Bürgerbeteiligung zu klären (Teil 1) und die politische Theorie daraufhin auf die Rolle der unkonventionellen Partizipation in der repräsentativen Demokratie zu befragen (Teil 2).
Die Darstellung der Stuttgart 21-Auseinandersetzung hat gezeigt, dass die Top-down-Politik der Projektbefürworter bzw. ihre fehlende Dialog- und Verhandlungsbereitschaft für den Widerstand und die Proteste der Projektgegner verantwortlich waren (Teil 3.1). Das politische Agieren der Bahn und der Verantwortlichen in Stuttgart stand dabei symptomatisch für das Problem, was in dieser Arbeit einleitend als die wachsenden Legitimationsdefizite der repräsentativen Demokratie bezeichnet wurde (Einleitung). Zwar wurde die Entscheidung zugunsten von Stuttgart 21 legal getroffen, dennoch war eine öffentliche Auseinandersetzung über die Legitimität und Finanzierbarkeit des Bauvorhabens nie beabsichtigt. Die Projektbefürworter stellten die Öffentlichkeit vor vollendete Tatsachen und rechtfertigten ihr Bauvorhaben mit einer Rhetorik der Alternativlosigkeit (Teil 3.1.1). In ihrer Stadtentwicklungspolitik kam außerdem das Primat ökonomischer Zielsetzungen zum Ausdruck. Schließlich ging es bei S 21 zum einen um die Anbindung der Stadt an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn und die dadurch zu erzielende Fahrzeitersparnis (Infrastrukturprojekt) und zum anderen um den Bau eines neumodernen Einkaufs-, Büro- und Bankenviertels in der Innenstadt (Städtebauprojekt). Wie gezeigt wurde, formierte sich gegen das Stuttgart 21-Projekt zwischen 2007 und 2010 eine vielgestaltige Protestbewegung (Teil 3.1.2). Ihr Protest richtete sich aber nicht nur gegen das Bauprojekt, sondern auch gegen die damit im Zusammenhang stehenden a) hohen Kosten, b) Demokratiedefizite und c) ökologischen Risiken.
Die Projektgegner verharrten nicht einfach in einer Ablehnung gegenüber Stuttgart 21, sondern erstellten mit Kopfbahnhof 21 auch ein Gegenkonzept, das zum Symbol für eine politisch selbstbestimmte und nachhaltige Stadtentwicklung werden sollte. Obwohl die Projektgegner ihr eigentliches politisches Ziel (Verhinderung S 21) nicht erreichten, leisteten sie mit ihrem unkonventionellen Engagement doch einen wichtigen Beitrag zur Kompensation der Demokratiedefizite auf lokalpolitischer Ebene. Der konkrete Beitrag der Bewegung bestand erstens in einer Steigerung der Qualität der öffentlichen Debatte. Zu nennen wäre z.B. das Schlichtungsverfahren, dass aus verschiedenen Gründen zwar nicht zur Konfliktbewältigung taugte, wohl aber zur Information der Öffentlichkeit mit Pro- und Kontra-Argumenten beitrug (Teil 3.1.3). Ohne die Proteste und die Eskalation des Konfliktes am schwarzen Donnerstag hätte die Schlichtung nie stattgefunden. Zweitens war die Bewegung mitverantwortlich für eine Politisierung der Bevölkerung in Stuttgart und Baden-Württemberg, die sich z.B. in der hohen Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2011 widerspiegelte (Teil 3.1.4). Drittens beeinflusste die Bewegung das Ergebnis der Landtagswahl zugunsten des grün-roten Regierungswechsels. Der Wechsel bedeutete auch eine qualitative Veränderung des Politikstils von einer Top-down-Politik zu einer Politik des Gehörtwerdens, die sogleich in der Entscheidung zur Durchführung einer Volksabstimmung über das S 21-Kündigungsgesetz zum Ausdruck kam. Auch bei der Volksabstimmung konnte eine relativ hohe Wahlbeteiligung erreicht werden, was abermals auf eine Politisierung der Bevölkerung in der Region Stuttgart schließen lässt. Dies ist ein wichtiges Ergebnis der Arbeit, das zeigt, dass Protestbewegungen, wenn sie ihren Dissens und Konflikt mit der Top-down-Politik der Verantwortlichen im Bereich der Stadtentwicklung öffentlich artikulieren und inszenieren, damit zur Steigerung der substanziellen Qualität und Legitimität des politischen Prozesses beitragen können. Wie die S 21-Auseinandersetzung zeigt, können Dissens und Konflikt demnach tatsächlich einen wertvollen Beitrag zur Politisierung der Bevölkerung und (Wieder-)Belebung der repräsentativen Demokratie auf lokalpolitischer Ebene leisten (siehe Mouffe, Teil 2.2). Genau wie es das Vier-Phasen-Modell vorgibt, lässt sich der Stuttgart 21-Konflikt mit den Phasen pre-deliberation (Formierung der Protestbewegung zwischen 2007 und 2010), full-scale-deliberation (Pro- und Kontra-Argumente während der Schlichtung und im Vorfeld der Volksabstimmung) und fair aggregation (Landtagswahl und Volksabstimmung 2011) erklären. Dass der S 21-Konflikt überhaupt entstand, lag demnach daran, dass es im Vorfeld der Entscheidung zugunsten von Stuttgart 21 keine öffentliche Deliberation über die Legitimität des Bauprojektes gab (siehe Mansbridge, Teil 2.3).
Im nächsten Schritt (Teil 3.2) widmete sich die Masterarbeit dem Trend zugunsten mehr Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung. Grundlegend hierfür war der Leitgedanken, dass quantitativ mehr Bürgerbeteiligung nicht unbedingt zur qualitativen Verbesserung der Demokratie in den Städten beitragen muss. Die konventionelle Bürgerbeteiligung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens konnte zunächst als unzureichend eingestuft werden, weil die Einwohner darin in der Regel zwar über die bereits fertiggestellten Planentwürfe informiert werden, aber ein echter Dialog oder eine faire Verhandlung über die Gestaltung des städtischen Lebensumfeldes darin nicht stattfindet (Teil 3.2.1). Nach der Kritik an der konventionellen (formellen) Bürgerbeteiligung wurden einige Erfolgskriterien für unkonventionelle (informelle) Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtentwicklung ausgearbeitet: 1. frühzeitige Information und Einbeziehung, 2. wechselseitiges Vertrauen, 3. Ergebnisoffenheit, 4. Bereitschaft zur Teilung von Entscheidungskompetenz und 5. transparentes sowie nachvollziehbares Vorgehen. Dass diese Ansprüche weitgehend zu realisieren sind, zeigte die Mannheimer Konversion (3.2.2). Im Weißbuchprozess setzten die politisch Verantwortlichen in Mannheim den Einwohnern keinen “Masterplan“ dafür vor, wie die ca. 500 ha freiwerdenden Militärflächen in eine zivile Nutzung (zurück-)überführt werden sollten, sondern gingen dabei von den Ideen der Bürger aus. Nach dem Motto der 1000 Ideen für Mannheim wurden zunächst alle Bürger nach ihren Vorschlägen befragt. Die Rückmeldungen wurden in einem Bürgerforum von einigen Arbeitsgruppen zu fünf Marken verarbeitet, die fortan die Grundlage für den weiteren Konversionsprozess in Mannheim bildeten. Genau wie es das Vier-Phasen-Modell vorgibt, erfolgte die weitere Entwicklung der Marke Grün (Projekt Grünzug und Bundesgartenschau 23) nach den Phasen pre-deliberation (AG), full-scale-deliberation (BUGA23-Kontroverse) und fair aggregation (Bürgerentscheid über die BUGA23). Die Projektentwicklung der Marke Wohnen (Projekt soziale Wohngruppen) erfolgte dagegen ganz einfach nach den Phasen pre-deliberation (AG) und negotiation (Verhandlungen mit der Stadt zur Nutzung des Turley-Areals). Damit ist hier ein Beispiel für eine freiwillige Kooperation zwischen linken Bürgerinitiativen und der Stadt Mannheim gegeben, die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit keiner öffentlichen Debatte oder einer fairen Abstimmung, sondern nur der Verhandlung, bedurften.
Die Beteiligungsangebote in Mannheim brachten nicht nur den Einwohnern gegenüber Vorteile (wie z.B. die frühzeitige Einbeziehung ihrer Präferenzen, Werte und Interessen, die konkrete Realisierung ihrer Projektideen und die Verbesserung ihrer Problemverarbeitungskompetenzen: Democratic Skills), sondern wirkten sich als vertrauensbildende Maßnahmen auch vorteilhaft für die Verantwortlichen aus. Nach den Ergebnissen einer ersten wissenschaftlichen Umfrage (Mannheimer Demokratie Audit) äußerte sich eine deutliche Mehrheit der befragten Mannheimer zufrieden a) über die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Konversion, b) über das Agieren der politischen Entscheidungsträger und c) über den Zustand der städtischen Demokratie. Der frühzeitige und umfassende Beteiligungsansatz im Rahmen der Mannheimer Konversion stellte von daher, und dies ist ein zentrales Ergebnis der Masterarbeit, eine Win-Win-Situation für die Bürger einerseits und für die Politiker andererseits dar. Die relativ hohen Zufriedenheitswerte in Bezug auf die Staatstätigkeit und die städtische Demokratie in Mannheim zeigen, dass ehrlich gemeinte und wirksame Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtentwicklung von den Einwohnern auch honoriert wird und die politischen Repräsentanten dadurch an Vertrauen und Beliebtheit (zurück-)gewinnen können. Genau in diesem Sinne kann Bürgerbeteiligung einen Beitrag zur Kompensation der wachsenden Demokratiedefizite leisten. Sie kann die Akzeptanz von und die Identifikation mit Stadtentwicklungsprojekten von Beginn an fördern und den Einwohnern dadurch begreifbar machen, dass ihre politische Selbstbestimmung und Autonomie im Einklang zur Mitverantwortung an der Stadtgesellschaft stehen sollte. Stadtentwicklung ist demnach kein “Wunschkonzert“ und darf nicht den Partikularinteressen der Wenigen dienen. Zwar sollen die eigenen Interessen in den öffentlichen Deliberationen eingebracht werden dürfen, aber sie stehen dort stets auch den Interessen der anderen Mitglieder der Stadtgemeinschaft gegenüber, die nicht einfach ignoriert oder übergangen werden dürfen. Erst durch die Artikulation der eigenen Interessen können die Mitglieder einer Stadtgemeinschaft aber überhaupt herausfinden, ob diese Interessen im Konflikt zueinander stehen oder sich daraus, frei nach Mansbridge, Übereinstimmungen, Win-Win-Lösungen oder faire Kompromisse bilden lassen. Stadtentwicklung ist mit einem ständigen Verhandlungs- und Aushandlungsprozess zu vergleichen, der wesentlich mehr ist, als nur ein Nullsummenspiel.
Problematisch ist es, wenn bestimmte Gruppen an den Bürgerbeteiligungsprozessen nicht teilnehmen können oder wollen. Zwar wurden im Rahmen der Mannheimer Konversion auch bestimmte Maßnahmen gegen die Unterrepräsentation von Migranten und Jugendlichen ergriffen (Zielgruppenworkshops), aber es bleibt fraglich, wie wirksam diese tatsächlich waren. Wenn Freiwilligkeit, wie in dieser Arbeit, eine Bedingung für politische Partizipation darstellt, muss ein gewisses Maß an politischer Ungleichheit akzeptiert und einkalkuliert werden. Dennoch bedarf es einer intensiveren Suche nach effektiven, niedrigschwelligen Angeboten, wenn Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtentwicklung nicht zu einer exklusiven Veranstaltung der politisch Selbstbewussten, zeitlich Flexiblen und besser Ausgebildeten werden soll. Bürgerbeteiligung läuft ansonsten Gefahr, das egalitäre Projekt der Demokratie zu konterkarieren und nicht zur Kompensation, sondern eher noch zur Verfestigung, der Demokratiedefizite beizutragen. Diesbezüglich ist auch die politische Theorie gefordert, ihre von oben herabblickende Warte und ihren intellektuellen Habitus einmal zu hinterfragen. Wenn z.B. Jürgen Habermas nicht nur Kommunikation, sondern auch rationale Argumentation, zur Bedingung seines deliberativen Modells macht, schließt er viele (oder aufgrund seiner Kommunikationsbedingungen sogar die meisten?) Menschen von vornherein aus. Auch die verhandlungstheoretische Konzeption von Mansbridge setzt auf Dialog und Verhandlung, womit eine anspruchsvolle Kommunikation gefordert wird. In dieser Hinsicht ist es begrüßenswert, dass in der Diskurstheorie von Laclau und Mouffe schon Handlungen als Artikulationen gelten können, womit sie auch nicht-sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten mit einbeziehen und ihr Politikverständnis damit insgesamt wesentlich inklusiver ist.
Ein weiteres Problem betrifft die Übertragbarkeit des frühzeitigen und umfas-senden Beteiligungsansatzes der Mannheimer Konversion auf andere Kommunen. Die Situation mit den 500 ha freiwerdenden Militärflächen in Mannheim war speziell. Ob auch andere Kommunen den zeitlichen, personellen und finanziellen Mehraufwand der Verwaltung stemmen könnten, den ein solch aufwendiger und langanhaltender Beteiligungsprozess eben auch bedeutet, bleibt fraglich. Vor allem aufgrund der potenziellen Ungeeignetheit mancher politischen Themen (man denke z.B. an die Unterbringung von Flüchtlingen) als Gegenstand von Bürgerbeteiligung, sollte es letztlich den Entscheidungsträgern in den Kommunen selbst überlassen bleiben, wann und in welchem Umfang sie Bürgerbeteiligung im Bereich der Stadtentwicklung durchführen können und wollen. Auch nach Mansbridge sollen öffentliche Deliberationen die repräsentative Demokratie nur dort, wo es sinnvoll und möglich erscheint, ergänzen, aber keinesfalls ersetzen. In diesem Zusammenhang ist an dieser Stelle nochmal deutlich darauf hinzuweisen, dass mit dieser Masterarbeit kein grundsätzliches Plädoyer für mehr direkte Demokratie gehalten wird. Mit der Volksabstimmung über das S 21-Kündigungsgesetz und dem Bürgerentscheid in Bezug auf die Austragung der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim konnten hier zwar zwei für den politischen Prozess jeweils sehr wichtige direktdemokratische Abstimmungen dargestellt und diskutiert werden. Die Rolle dieser konfirmativen Referenden[87] bestand in beiden Fällen darin, durch das Votum der Bürgerschaft nach dem Mehrheitsprinzip eine Entscheidung in Bezug auf eine anders nicht mehr zu lösende Kontroverse (Stuttgart 21-Ja-Nein?/BUGA23-Ja-Nein?) zu erzwingen. Eine direktdemokratische Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip schien in beiden Fällen die fairste Art und Weise zu sein, um den Konflikt vorläufig zu beenden. Zwar können die mit politischen Wahlen und direktdemokratischen Abstimmungen unausweichlich verbundenen Niederlagen unzweifelhaft sehr schmerzhaft sein. So wurde mit der Volksabstimmung in Stuttgart den Projektgegnern z.B. vor Augen geführt, dass ihr Anspruch mit ihrer Stimme für das Volk sprechen zu können, von Beginn an fehlgeleitet und illusorisch war, da es neben ihrer ablehnenden Meinung gegen Stuttgart 21 auch eine zweite öffentliche Pro-Meinung gab, die mit Stuttgart 21 offenbar mehr Chancen (z.B. Arbeitsplätze und Investitionen) als Risiken (z.B. hohe Kosten) verband. Aber die Möglichkeit des Scheiterns und die Fähigkeit mit solchen Niederlagen umzugehen gehören nunmal zur Staatsform der Demokratie. Ein echter Demokrat akzeptiert seine Niederlage durch das Votum der Wählerschaft, gratuliert vielleicht noch der Gegenseite (oder auch nicht), schüttelt sich dann kurz und versucht es beim nächsten Mal eventuell wieder mit einer Kampagne. In diesem Sinne warten auch die Stuttgart 21-Gegner auf ihre nächste Chance. Und wer weiß, ob sich diese nicht noch einmal bietet, wenn man sich die Kostensteigerungen ansieht.
Im Übrigen haftet den häufig zu vernehmenden Rufen nach mehr direkter Demokratie mittlerweile längst ein etwas schaler Beigeschmack an. Denn die Rechtspopulisten sind heutzutage, ähnlich wie Mouffe dies prophezeit hatte, weltweit auf dem Vormarsch und es sind nicht zuletzt auch sie, die vehement die direkte Demokratie fordern. Dies tun sie aber unter dem Vorwand, um die repräsentative Demokratie und den Rechtsstaat zu unterwandern. Die Gefahr von rechts ist gegenwärtig, dieser Exkurs zum Schluss sei mir verziehen, längst bedrohlich für den Bestand der liberalen Demokratien geworden. Dazu kommt nicht erst seit der Flüchtlingskrise noch eine Inflation rechtsextremer Gewalttaten (z.B. die Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte oder die Mordanschläge der NSU). Die politische Theorie hat sich seit Jahren den progressiven und demokratiefreundlichen Kräften, wie z.B. den neuen sozialen Bewegungen, zugewandt. Auch diese Masterarbeit hat mit den Protesten in Stuttgart oder den linken Wohnprojekten in Mannheim diesen Weg eingeschlagen. Aber es soll abschließend zumindest darauf hingewiesen werden, dass es gegenwärtig nicht mehr nur um die substanzielle Legitimität des politischen Prozesses, sondern auch um die aktive Verteidigung der rechtsstaatlichen Institutionen und Grundrechte in den liberalen Demokratien, geht. Die Inflation politischer Gewalttaten (man denke auch an den islamistischen Terrorismus) muss auch von der Politikwissenschaft stärker in den Blick genommen werden. Dabei hilft es nicht, die oben genannten Phänomene nicht als politische Partizipation zu bezeichnen und damit ihren politischen Charakter leugnen zu wollen. Es sollte vielleicht in einem interdisziplinären Forschungsvorhaben zwischen der Psychologie und der Politikwissenschaft nach Erklärungsansätzen für die gegenwärtige Inflation politischer Gewalt gesucht werden, um auch die dunkle Seite der politischen Partizipation besser verstehen (nicht rechtfertigen) zu können und über politische Handlungsmöglichkeiten bzw. eine langfristige Verteidigungsstrategie im Sinne einer wehrhaften liberalen Demokratie und Gesellschaft nachzudenken. Wenn das politische Establishment, d.h. die Spitzenpolitiker und die großen Volksparteien in ihren Programmen, weiterhin so handelten, als ob ihre neoliberale Politik alternativlos sei, dann dürfen sie sich, laut Mouffe, nicht über die Entpolitisierung und das Aufkommen des Rechtspopulismus wundern, da die Letzteren oftmals die Einzigen seien, die sich gegen den neoliberalen Kurs der anderen Parteien noch wirklich auflehnten und damit die “kleinen Leute“ ansprächen. Zwar klingt dies ein wenig zu sehr nach einer direkten Schuldzuweisung auf der einen und einer Pauschalisierung auf der anderen Seite (so als gäbe es neben der Politik der Mitte und dem Rechtspopulismus in den liberalen Demokratien von heute keine anderen politischen Wahlmöglichkeiten mehr). Dennoch zeigt das Wiedererstarken der Rechten und damit auch des Rechtsextremismus in Deutschland zu Zeiten, in denen die schwarz-rote Regierungskoalition in Berlin nicht mehr in der Lage und/oder Willens ist, effektive Maßnahmen gegen die zunehmende soziale Schieflage und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft zu unternehmen, doch die prinzipielle Plausibilität der Argumentation von Mouffe. So gäbe es vermutlich genug Anknüpfungspunkte, um zu zeigen, dass es sich bei der gegenwärtigen Mobilisierung der Rechten häufig gerade um diejenigen Modernisierungsverlierer und Abgehängten in der Gesellschaft handelt, die sich in ihren Interessen und Bedürfnissen von der Politik nicht mehr ernstgenommen fühlen und sich gegenüber dem politischen Establishment abgewandt haben.
Literaturverzeichnis
Bäßler, Rüdiger (2016): Stuttgart 21, war da was? In: Die Zeit am 22.02.2016. Im Internet unter: http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-02/stuttgart-21-landtags-wahlkampf-gegner-kosten/komplettansicht (Zugriff am 5.11.2016).
Baumgarten, Britta/Rucht, Dieter (2013): Die Protestierenden gegen „Stuttgart 21“ – einzigartig oder typisch? In: Brettschneider, Frank/Schuster, Wolfgang (Hg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS, 97–126.
Bebnowski, David (2013): Der trügerische Glanz des Neuen: Formierte sich im Protest gegen „Stuttgart 21“ eine soziale Bewegung? In: Brettschneider, Frank/Schuster, Wolfgang (Hg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS, 127–148.
Brettschneider, Frank (2013): Die „Schlichtung“ zu „Stuttgart 21“ – Wahrnehmungen und Bewertungen durch die Bevölkerung. In: Brettschneider, Frank/Schuster, Wolfgang (Hg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS, 185–208.
Brettschneider, Frank/Schwarz, Thomas (2013): „Stuttgart 21“, die baden-württembergische Landtagswahl und die Volksabstimmung. In: Brettschneider, Frank/Schuster, Wolfgang (Hg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS, 261–298.
Buchstein, Hubertus/Neymanns, Harald (2002): Online-Wahlen. Opladen: Leske + Budrich.
BUGA23 (2016a): Bundesgartenschau23. Mannheim Verbindet. Im Internet unter: http://www.buga2023.de/ (Zugriff am 5.11.2016).
BUGA23 (2016b): Bundesgartenschau23. Mannheims Grüne Zukunft. Information Grünzug Nordost und BUGA 2023. Im Internet als PDF verfügbar unter: http://www.buga2023.de/sites/default/files/ mannheims_grune_ zukunft_-_information_grunzug_nordost_ und_buga_2023.pdf (Zugriff am 5.11.2016).
Bündnis 90/Die Grünen/SPD Baden-Württemberg (2011): Der Wechsel beginnt. Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD Baden-Württemberg. Baden-Württemberg 2011–2016. Stuttgart.
Castells, Manuel (2012): Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press.
Cobb, Roger/Ross, Jennie-Keith/Ross, Marc-Howard (1976): Agenda Building as a Comperative Political Process. In: American Political Science Review 70 (1), 1976, 126–138.
Cornelius, Sabrina/Dehoust, Eva/Häfner, Carolin (2013): „Einbahnstraßen-kommunikation ist nicht die Lösung“ – Fragen an Lothar Frick. In: Brettschneider, Frank/Schuster, Wolfgang (Hg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS, 209–218.
DB AG (2016a): Deutsche Bahn AG: Die Kosten. Neuordnung Bahnknoten Stuttgart (S21) im Internet unter: http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/projekt/finanzierung-und-kosten/s21-neuordnung-bahnknoten-stuttgart/kosten/ (Zugriff am 5.11.2016).
DB AG (2016b): Deutsche Bahn AG. Die Finanzierung. Neuordnung Bahnknoten Stuttgart (S21) im Internet unter: http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/pro-jekt/finanzierung-und-kosten/s21-neuordnung-bahnknoten-stuttgart/finanzie-rung/ (Zugriff am 5.11.2016).
Decker, Frank (2006): Direktdemokratische Beteiligung auf Bundesebene. Die Diskussion um die Einführung von Plebisziten in das Grundgesetz. In: Hoecker, Beate (Hg.): Politische Partizipation zwischen Konvention und Protest. Eine studienorientierte Einführung. Opladen: Barbara Budrich, 133–155.
Deth, Jan W. van (2009): Politische Partizipation. In: Kaina, Viktoria/Römmele, Andrea (Hg.): Politische Soziologie. Ein Studienbuch. Wiesbaden: Springer VS, 141–161.
Deth, Jan W. van (2014): Demokratie in der Großstadt. Ergebnisse des ersten Mannheimer Demokratie Audit. Wiesbaden: Springer VS.
Erzigkeit, Ilse (2005): „Die Bürger sind frühzeitig über die Ziele der Planung zu unterrichten...“. Im Planungsrecht vorgesehene Möglichkeiten von Mitwirkung und Konfliktlösung – Beispiele erfolgreicher Mediation. In: Schüßler, Achim (Hg.): von unten von oben – Lebensräume zwischen Planung und Selbstregelung. Darmstadt: Archimed, 56–69.
Flügel, Oliver (2004): Démocratie a venir: Jacques Derrida. In: Flügel, Oliver/Heil, Reinhard/Hetzel, Andreas (Hg.): Die Rückkehr des Politischen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 19–42.
Flügel, Oliver/Heil, Reinhard/Hetzel, Andreas (2004): Die Rückkehr des Politischen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Freedom House (2016): Freedom in the World 2016. Im Internet unter: https:// freedomhouse.org/sites/default/files/FITW_World_Map_ nolabels_GF2016_FINAL. pdf (Zugriff am 5.11.2016).
Fuchs-Goldschmidt, Inga (2008): Konsens als normatives Prinzip der Demokratie. Zur Kritik der deliberativen Theorie der Demokratie. Wiesbaden: Springer VS.
Göschel, Albrecht (2013): „Stuttgart 21“. Ein postmoderner Kulturkonflikt. In: Brettschneider, Frank/Schuster, Wolfgang (Hg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS, 149–172.
Habermas, Jürgen (1994): Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. 4. durchgesehene und um ein Nachwort und Literaturverzeichnis erweiterte Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (1996): Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie. Frankfut a. M.: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen (2005): Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Hacker, Peter M.S. (2001): Verstehen wollen. In: Schulte, Joachim/Wenzel, Uwe J. (Hg.): Was ist ein „philosophisches“ Problem? Frankfurt am Main: Fischer, 54–71.
Hadjar, Andreas/Becker, Rolf (2007): Bildungsexpansion und politisches Engagement – Unkonventionelle politische Partizipation im Zeitverlauf. In: Bode, Ingo/Evers, Adalbert/Klein, Ansgar (Hg.): Bürgergesellschaft als Projekt. Eine Bestandsaufnahme zu Entwicklung und Förderung zivilgesellschaftlicher Potenziale in Deutschland. Wiesbaden: Springer VS, 101–124.
Hoecker, Beate (2006): Politische Partizipation zwischen Konvention und Protest. Eine studienorientierte Einführung. Opladen: Barbara Budrich.
Holtmann, Everhard (2015): Die Entwicklung der Demokratie. Legitimations-verlust und Reformbedarf? In: Harles, Lother/Lange, Dirk (Hg.): Zeitalter der Partizipation. Paradigmenwechsel in Politik und politischer Bildung? Schriftenreihe der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung. Schwalbach: Wochenschau, 63–73.
Hummel, Konrad (2015): Demokratie in den Städten. Neuvermessung der Bürgerbeteiligung – Stadtentwicklung und Konversion. Baden-Baden: Nomos.
Jörke, Dirk (2004): Die Agonalität des Demokratischen: Chantal Mouffe. In: Flügel, Oliver/Heil, Reinhard/Hetzel, Andreas (Hg.): Die Rückkehr des Politischen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 164–184.
Jörke, Dirk (2014): Die populistische Herausforderung der Demokratietheorie. In: Landwehr, Claudia/Schmalz-Bruns, Rainer (Hg.): Deliberative Demokratie in der Diskussion. Schriftenreihe der Sektion Politische Theorie und Ideengeschichte in der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft. Band 28, 369–391.
Keine BUGA 2023 (2016): Keine Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Im Internet unter: http://www.keine-buga2023.org/ (Zugriff am 5.11.2016).
Kersting, Norbert/Woyke, Wichard (2012): Vom Musterwähler zum Wutbürger? Politische Beteiligung im Wandel. Münster: Aschendorff.
Kersting, Norbert (2015): Das Zeitalter politischer Partizipation. Partizipativer Wandel oder globales Disengagement? In: Harles, Lother/Lange, Dirk (Hg.): Zeitalter der Partizipation. Paradigmenwechsel in Politik und politischer Bildung? Schriftenreihe der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung. Schwalbach: Wochenschau, 49–62.
König, Wolfgang/König, Mathias (2014): Bürgerbeteiligung in der Kommune verbindlich verankern – Der doppelte Doppelcharakter von Bürgerbeteiligung in der Kommune und seine Konsequenzen. In: eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung, 2014 (1), 1–14.
Konversion Mannheim (2016): Die offizielle Informationsseite im Internet unter: http://www.konversion-mannheim.de/ (Zugriff am 5.11.2016).
Krüger, Sebastian (2012): Stuttgart 21 – Interessen, Hintergründe, Widersprüche. In: Informationen zur Raumentwicklung, 11/12, 589–603.
Laclau, Ernesto/Mouffe, Chantal (2006): Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus. 3. Aufl. Wien: Passagen.
Mannheimer Morgen (2013): Bürgerentscheid: Mannheim: 50,7 Prozent für BUGA 2023. In: Mannheimer Morgen am 22.09.2013. Im Internet unter: http://www.morgenweb.de/mannheim/mannheim-stadt/ bundesgartenschau-mannheim/mannheim-50-7-prozent-fur-buga-2023-1.1213055 (Zugriff am 5.11.2016).
Mansbridge, Jane (1983): Beyond Adversary Democracy. Chicago: University of Chicago Press.
Mansbridge, Jane (1990): Beyond Self-Interest. Chicago: University of Chicago Press.
Mansbridge, Jane (2006): Conflict and Self-Interest in Deliberation. In: Besson, Samantha/Marti, José Luis (Hg.): Deliberative Democracy and its Discontents. Aldershot/Burlington: Ashgate, 107–132.
Mansbridge, Jane (2009): Deliberative and Non-Deliberative Negotiations. HKS Faculty Research Working Paper Series RWP09-010. John F. Kennedy School of Government. Harvard University.
Mansbridge, Jane/Bohman, James/Chambers, Simone/Estlund, David/Føllesdal, Andreas/Fung, Archon/Lafont, Cristina/Manin, Bernard/Martin, José L. (2010): The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy. In: The Journal of Political Philosophy, 18 (1), 64–100.
Mansbridge, Jane (2014): What Is Political Science For? In: Perspectives on Politics, 12 (1): 8–17.
Mansbridge, Jane (2015): A Minimalist Definition of Deliberation. In: Heller, Patrick/Vijayendra, Rao (Hg.): Deliberation and Development. Rethinking the Role of Voice and Collective Action in Unequal Societies. Washington DC: World Bank Group, 27–50.
Miessen, Markus (2012): Alptraum Partizipation. Berlin: Verve Verlag.
Möckli, Silvano (1995): Direkte Demokratie in der Schweiz. Ein Mittel zur Behebung von Funktionsmängeln der repräsentativen Demokratie? In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Sonderband 1/95, 289–299.
Mouffe, Chantal (2007a): Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Mouffe, Chantal (2007b): Pluralismus, Dissens und demokratische Staatsbürgerschaft. In: Nonhoff, Martin (Hg.): Diskurs – radikale Demokratie – Hegemonie. Zum politischen Denken von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Bielefeld: Transcript.
Mouffe, Chantal (2008): Das demokratische Paradox. Wien: Turia & Kant.
Mouffe, Chantal (2011): Postdemokratie und die zunehmende Entpolitisierung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 1–2, 3–5.
Mouffe, Chantal (2013): Demokratische Politik im Zeitalter des Postfordismus. In: Marchart, Oliver (Hg.): Facetten der Prekarisierungsgesellschaft. Bielefeld: Transcript, 205–215.
Nanz, Patrizia/Fritsche, Miriam (2012): Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteure, Chancen und Grenzen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Nonhoff, Martin (2007): Diskurs – radikale Demokratie – Hegemonie. Zum politischen Denken von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Bielefeld: Transcript.
Ohme-Reinicke, Annette (2012): Das große Unbehagen. Die Protestbewegung gegen “Stuttgart 21“: Aufbruch zu neuem bürgerlichen Selbstbewusstsein. Stuttgart: Schmetterling Verlag.
Prothmann, Hardy/Dartsch, Lydia (2013): Bundesgartenschau 2023 – Mannheims utopischer Bürgerentscheid. In: Die Zeit am 21.09.2013. Im Internet unter: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-09/buergerent-scheid-mannheim-bundesgartenschau (Zugriff am 5.11.2016).
Roth, Roland/Rucht, Dieter (2008): Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch. Frankfurt a. M.: Campus Verlag.
Roth, Roland (2011): Bürgermacht. Eine Streitschrift für mehr Partizipation. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Rucht, Dieter (2013): Demokratie ohne Protest? Zur Wirkungsgeschichte sozialer Bewegungen. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen 26 (3), 65–70.
Rucht, Dieter (2014): Die Bedeutung von Online-Mobilisierung für Offline-Proteste. In: Voss, Kathrin (Hg.): Internet und Partizipation. Bottom-up oder Top-down? Politische Beteiligungsmöglichkeiten im Internet. Wiesbaden: Springer VS, 115–128.
Schlager, Alexander (2010): Die Proteste gegen „Stuttgart 21“. In: Sozial. GeschichteOnline 4 (2010), 113–137. Im Internet unter: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/ Derivate-25690/08_Schlager_Stuttgart.pdf (Zugriff am 5.11.2016).
Schlichtung S21 (2016): Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Schlichtungsgesprächen. Im Internet unter: http://www.schlichtung-s21.de/teilnehmer.html (Zugriff am 5.11.2016).
Schubert, Klaus/Klein, Martina (2011): Das Politiklexikon. 5. aktualisierte Aufl., Bonn: Dietz.
Schultze, Rainer-Olaf (1995): Partizipation. In: Nohlen, Dieter/Schultze, Rainer-Olaf (Hg.): Politische Theorien (Lexikon der Politik Bd. 1). München: C. H. Beck, 396–406.
Smith, Graham (2009): Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation. Cambridge u.a: Cambridge University Press.
Spieker, Arne/Brettschneider, Frank (2013): Alternative Streitbeilegung? Die „Schlichtung“ zu „Stuttgart 21“ aus Sicht der TeilnehmerInnen. In: Brettschneider, Frank/Schuster, Wolfgang (Hg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS, 219–242.
Staatsministerium Baden-Württemberg (2011): Information der Landesregierung Baden-Württemberg zur Volksabstimmung am 27. November 2011. Stuttgart.
Statusbericht Bürgerhaushalt (2015): 8. Statusbericht des Portals Buergerhaus-halt.org. Juni 2015. Bundeszentrale für Politische Bildung. Im Internet unter: http://www.buergerhaushalt.org/sites/ default/files/downloads/8._Statusbericht_Buergerhaushalte_in _Deutschland_Juni_2015.pdf (Zugriff am 5.11.2016).
Stuckenbrock, Uwe (2013): Das Projekt „Stuttgart 21“ im zeitlichen Überblick. In: Brettschneider, Frank/Schuster, Wolfgang (Hg.): Stuttgart 21. Ein Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS, 15–76.
Thaa, Winfried (2013): „Stuttgart 21“ – Krise oder Repolitisierung der repräsen-tativen Demokratie? In: Politische Vierteljahresschrift, 54 (1), 1–20.
Thaa, Winfried (2015): Die Auseinandersetzung um „Stuttgart 21“ und die Zukunft der repräsentativen Demokratie. In: Sommer, Jörg (Hg.): Kursbuch Bürgerbeteiligung. Berlin: Verlag der Deutschen Umweltstiftung, 284–306.
Thurich, Eckart (2011): pocket politik. Demokratie in Deutschland. Im Internet unter: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/ (Zugriff am 5.11.2016).
Vatter, Adrian (2007): Direkte Demokratie in der Schweiz. Entwicklungen, Debatten und Wirkungen. In: Freitag, Markus/Wagschal, Uwe (Hg.): Direkte Demokratie. Bestandsaufnahmen und Wirkungen im internationalen Vergleich. Berlin: LIT Verlag, 71–114.
Verba, Sidney/Schlozman, Kay L./Brady, Henry E. (1995): Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge: Harvard University Press.
Vieregg-Rössler GmbH (2015): Aktualisierung der Baukosten-Prognose von 2008 für das Projekt Stuttgart 21. Vieregg-Rössler GmbH. Innovative Verkehrsberatung. München.
Vieregg-Rössler GmbH (2016): Ermittlung der Ausstiegskosten für das Projekt Stuttgart 21 zum Stand Ende Januar 2016. Vieregg-Rössler GmbH. Innovative Verkehrsberatung. München.
Weißbuch (2012): Weißbuch I. Offene Räume – Starke Urbanität. Konversion und Bürgerbeteiligung in Mannheim. Mannheim, Februar 2012. Im Internet als PDF verfügbar unter: http://www.konversion-mannheim.de/sites/default/files/weissbuch.pdf (Zugriff am 5.11.2016).
Weißbuch (2013): Weißbuch II. Konversion und Bürgerbeteiligung in Mann-heim. Mannheim, Februar 2013. Im Internet als PDF verfügbar unter: http://www.konversion-mannheim.de/sites/default/files/ weissbuch_doppelseiten_scr.pdf (Zugriff am 5.11.2016).
Weißbuch (2014): Weißbuch III. Konversion und Bürgerbeteiligung in Mannheim. Mannheim, Februar 2014. Im Internet als PDF verfügbar unter: http://www.konversion-mannheim.de/sites/default/files/ weissbuch_iii.pdf (Zugriff am 5.11. 2016).
Weixner, Bärbel M. (2006): Direktdemokratische Beteiligung in Ländern und Kommunen. In: Hoecker, Beate (Hg.): Politische Partizipation zwischen Konvention und Protest. Eine studienorientierte Einführung. Opladen: Barbara Budrich, 100–132.
Williams, Melissa S. (2012): Beyond the Empirical-Normative Divide: The Democratic Theory of Jane Mansbridge. In: Political Science & Politics, 45 (4), 797–805.
Wortschatz (2016): Das Onlineportal Wortschatz der Universität Leipzig. Im Internet unter: http://wortschatz.uni-leipzig.de/ (Zugriff am 5.11.2016).
Zeit Online (2016): Tausende Pegida-Anhänger demonstrieren zum Jahrestag. In: Zeit Online am 16.10.2016. Im Internet unter: http://www.zeit.de/ gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/dresden-pegida-jahrestag-demo (Zugriff am 5.11.2016).
Zielcke, Andreas (2010a): Geistige Kessellage. „Der große Wurf“ und das kleine Zeitfenster: Warum Stuttgart 21 an einem unheilbaren Mangel leidet. Ein überfälliger Rückblick. In: Süddeutsche Zeitung am 19.10.2010. Im Internet unter: http://www.winnehermann.de/ 2010/wp-content/uploads/2010/10/20101019_SZ_Geistige_ Kessellage.pdf (Zugriff am 5.11.2016).
Zielcke, Andreas (2010b): Stuttgart 21: Schlichtung und Wahrheit.
In: Süddeutsche Zeitung am 3.12.2010. Im Internet unter: http://www.sueddeutsche.de/kultur/heiner-geissler-und-stuttgart-die-lizenz-zur-vollstreckung-1.1031587 (Zugriff am 5.11.2016).
13ha Freiheit (2016): 13ha Freiheit. Startseite im Internet unter: http://www.13hafrei heit.de/startseite.html (Zugriff am 5.11.2016).
[...]
[1] Vgl. Freedom House: Map of Freedom 2016 unter: https://freedomhouse.org/sites/ default/files/FITW_World_Map_nolabels_GF2016_FINAL.pdf (Zugriff am 5.11.2016).
[2] Das angesprochene Problem der wachsenden Legitimationsdefizite wird in der Literatur auch als Krise der Demokratie oder als Postdemokratie diskutiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird diese Diskussion aber nicht im Vordergrund stehen. Es geht eher darum, das Problem als aktuellen Anlass zu nehmen, um erst die Demokratietheorie und danach die politische Praxis nach geeigneten Lösungsmöglichkeiten zu befragen.
[3] Sowohl aus Platzgründen als auch aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine geschlechterneutrale Sprache verzichtet. Mit Begriffen wie Bürger, Politiker usw. sind selbstverständlich immer Frauen sowie auch Männer angesprochen.
[4] Kursive Textstellen sind als Hervorhebungen des Verfassers dieser Arbeit zu verstehen.
[5] Deshalb kann „die philosophische Arbeit“, die nach Hacker (2001: 71) darin besteht, „die Formen des Mißverstehens begrifflicher Zusammenhänge“ zu beseitigen, „nicht zum Abschluß kommen“ und muss von jeder Generation gewissermaßen „von vorne“ in Angriff genommen werden. In diesem Sinne soll dieser Definitionsteil einen Beitrag zum besseren Verständnis von konventioneller und unkonventioneller Partizipation leisten.
[6] Für internationale Beispiele von Bürgerhaushalten siehe Roland Roth (2011: 179-213).
[7] Bürgerhaushalte werden im Rahmen dieser Masterarbeit nicht eingehender untersucht.
[8] Die Bedeutung deliberativer Meinungs- und Willensbildung für die Legitimation und Rationalisierung demokratischer Gesetzgebungsprozesse wird von Jürgen Habermas noch eingehender thematisiert (vgl. Teil 2.1).
[9] Die Bedeutung von politischer Auseinandersetzung und Protest für die Konstruktion von kollektiven Identitäten in der liberalen Demokratie wird von Chantal Mouffe noch genauer herausgearbeitet (vgl. Teil 2.2).
[10] Diese Fragen werden im zweiten Teil der Arbeit (2) aber noch ausführlich behandelt.
[11] Im Folgenden wird in dieser Arbeit aus Platzgründen nur noch von konventioneller und unkonventioneller Partizipation die Rede sein.
[12] Die genannten Synonyme sind im Portal Wortschatz der Universität Leipzig abrufbar. Vgl. im Internet unter: http://wortschatz.uni-leipzig.de/ (letzter Zugriff am 5.11.2016).
[13] Aus diesem Grund werden die Begriffe soziale Bewegungen und Protestbewegungen im Rahmen dieser Arbeit äquivalent verwendet.
[14] Ein Beispiel dafür ist die fremden- und islamfeindliche Bewegung PEGIDA (Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung des Abendlandes), die in Dresden gerade erst wieder viele tausende Demonstranten mobilisieren konnte: http://www.zeit.de/gesellschaft/ zeitgeschehen/2016-10/dresden-pegida-jahrestag-demo (Zugriff am 5.11.2016).
[15] Was mit den wachsenden Legitimationsdefiziten der repräsentativen Demokratie gemeint ist, wurde in der Einleitung bereits beschrieben. Inwiefern unkonventionelle Partizipation eine Kompensation in Bezug auf die angesprochene Problematik leisten kann, wird im Rahmen der Diskussion zum Schluss der Arbeit (vgl. Teil 4) erläutert.
[16] Als Synonyme für den Begriff „Deliberation“ sind die Begriffe „Beratschlagung“ und „Überlegung“ geeignet (vgl. Duden Fremdwörterbuch, 5. Aufl., S. 169). Hier ist mit dem Begriff allerdings der öffentliche Meinungs- und Willensbildungsprozess gemeint, der politischen Entscheidungen laut Jürgen Habermas im Idealfall vorausgehen soll.
[17] Nicht dem einzelnen Subjekt soll, wie nach Emanuel Kant, die Beurteilung der moralischen Richtigkeit von Gesetzesnormen zufallen, sondern die Selbstgesetzgebung kann nur dialogisch bzw. unter Einbeziehung des Anderen erfolgen. Das Diskursprinzip von Habermas ist insofern als eine intersubjektive Umdeutung des individualistisch ver-kürzten Autonomiebegriffs von Kant zu verstehen (Habermas 1994: 154; 1996: 48-49).
[18] Dass nur argumentiert werden darf, ist auch eine wichtige Kommunikationsbedingung.
[19] Der Qualitätsmaßstab lautet “rationale Akzeptabilität” und nicht objektive Wahrheit. Da „noch so gut begründete Behauptungen falsch sein können“, gehe es in rationalen Diskursen darum, „die besten der jeweils erreichbaren Informationen und Gründe (...)“ geltend zu machen (Habermas 2005: 56-57). Auch die in einer Beratung erzielten, richtigen Ergebnisse sind damit streitbar. Mit dieser prinzipiellen Zukunftsoffenheit von Diskursen möchte Habermas dem gesellschaftlichen Pluralismus gerecht werden, der in den komplexen und heterogenen Gesellschaften von heute nunmal vorhanden ist.
[20] Die innere Peripherie besteht aus einem Netzwerk von Institutionen, die mit Selbstverwaltungsrechten oder deligierten staatlichen Kontroll- und Hoheitsfunktionen anderer Art ausgestattet sind, wie z.B. Universitäten, Versicherungen, Standesvertre-tungen, Kammern, Wohlfahrtsverbände (Habermas 1994: 430).
[21] Die zuliefernden Akteure sind nicht dem staatlichen und auch nicht dem ökonomischen Bereich zuzuordnen, sondern dem Bereich der Zivilgesellschaft, welcher einen Resonanzboden und Lautverstärker für „die gesellschaftlichen Problemlagen in den privaten Lebensbereichen“ darstellt (Habermas 1994: 443).
[22] Die Öffentlichkeit definiert Habermas (1994: 436) allgemein „als ein Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen, also von Meinungen (...).“ Hier ließen sich aus der Gesamtmenge von Kommunikationsflüssen „themenspezifisch gebündelte öffentliche Meinungen“ herausdestillieren (Habermas 1994: 436).
[23] Die drei genannten Modelle zum Karriereverlauf neuer politischer Themen hat Jürgen Habermas von (Cobb et al. 1976) übernommen.
[24] Habermas entlehnt den Begriff der kommunikativen Macht von Hannah Arendt und bezeichnet damit die Fähigkeit, den Anderen mit Argumenten von der eigenen Meinung zu überzeugen. Die Termini der administrativen und sozialen Macht stehen dagegen einem Machtbegriff näher, der die Fähigkeit zur Instrumentalisierung eines fremden Willens für die jeweils eigene Zwecke meint. Nur wenn die kommunikative Macht über das Medium des Rechts in administrative Macht umgewandelt wird, sei Letztere als ein legitimes Mittel und nicht als eine den Bürgern aufoktroyierte Gewalt zu verstehen (Habermas 1994: 182-187).
[25] Seit dem Erscheinen von Hegemony and Socialist Strategy gelten Ernesto Laclau und Chantal Mouffe als wichtige Vertreter dieser Richtung (Laclau/Mouffe 2006). In den letzten zehn Jahren hat ihr politisches Denken den politik- und sozialwissenschaftlichen Theoriediskurs zunehmend beeinflusst (vgl. Nonhoff 2007: 7-8).
[26] Unter dem Begriff „Antagonismus“ kann „Gegensatz, Gegnerschaft, Widerstreit“ oder „Widerstand“ verstanden werden (vgl. Duden Fremdwörterbuch, 5. Aufl., S. 64). Chantal Mouffe meint mit dem Begriff aber offenbar die prinzipiell vorhandenen Konfliktpoten-ziale zwischen politischen Identitäten, die in Gesellschaften notwendigerweise existieren.
[27] Der Begriff „Kontingenz“ kann als „Zufälligkeit“ oder „Möglichsein“ übersetzt werden und steht im Gegensatz zur Notwendigkeit im philosophischen Sinne (vgl. Duden Fremdwörterbuch, 5. Aufl., S. 426).
[28] Die dekonstruktivistische Philosophie und die Konzeption der Démocratie a venir von Jacques Derrida liefert einen sehr wichtigen Referenzpunkt für radikaldemokratische Denkansätze (siehe Flügel 2004).
[29] Mouffe entwickelt ihr agonistisches Demokratiemodell in einer kritischen Auseinandersetzung mit den deliberativen Ansätzen von John Rawls und Jürgen Habermas (vgl. Mouffe 2008; Jörke 2004: 170-173).
[30] Vgl. hierzu die Ausarbeitung des hegemonietheoretischen Diskursverständnisses von Laclau/Mouffe (2006: 127-187), welches hier nur stark verkürzt erläutert werden konnte.
[31] Nonhoff (2007: 8-9) hat deshalb darauf hingewiesen, dass es sich beim Ansatz von Laclau/Mouffe eigentlich nicht primär um eine Diskurstheorie im klassischen Sinne handelt, sondern eher um „eine Sozialtheorie und eine Politische Theorie, die das Soziale im Modus der Diskursivität verfasst sieht.“
[32] Ein rationaler Konsens, wie ihn Habermas fordert, stellt für Mouffe (2007a: 19) ein Ding der Unmöglichkeit dar, weil ein solcher Konsens immer auf dem illegitimen Ausschluss anderer, alternativer Optionen basiere. In Bezug auf politische Streitfragen könne es demnach niemals eine allgemeingültige öffentliche Meinung geben.
[33] Der Minimalkonsens ist als ein ”Agree-how-to-disagree” zwischen den politischen Gegnern zu verstehen, welches den „gemeinsamen Regelkanon“ ihrer agonistischen Konfrontation festlegt (Mouffe 2007a: 70).
[34] Nach Mouffe (2007a: 34-43) spielen menschliche Leidenschaften und ihr Bedürfnis nach kollektiver Identifikation eine wichtige Rolle in der Politik. Allerdings benötigen diese Affekte ein demokratisches Ventil in Form einer agonistischen Konfrontation, damit sie sich nicht über Antagonismen entfalten und dadurch den Aufstieg rechtspopulistischer oder religiös-fundamentalistischer Bewegungen ermöglichen.
[35] Mouffe vertritt die provokante These, dass die Konsensorientierung in der politischen Theorie und Praxis zur Verstärkung des Rechtspopulismus beigetragen hätten (vgl. Jörke 2014).
[36] Der Kampf zugunsten einer Demokratisierung der Demokratie funktioniert wie folgt: „Die formalen Prinzipien der Freiheit und Gleichheit werden zu diesem Zweck immer wieder neu interpretiert und auf soziale Konfigurationen übertragen, in denen Unterdrückungsverhältnisse existieren“ (Jörke 2004: 178).
[37] Damit sind hier die wachsenden Legitimationsdefizite in repräsentativen Demokratien angesprochen, die in dieser Arbeit in der Einleitung (vgl. S. 1-2) problematisiert wurden.
[38] Habermas zählt zu den Vertretern der klassisch-deliberativen Demokratietheorie. Seine Texte und vor allem seine Habilitationsschrift „Die Transformation der öffentlichen Sphäre“ stellen häufig den Ausgangspunkt für die Kritik von Mansbridge dar (vgl. Mansbridge 2006: 109-115; 2009: 3-5; Mansbridge et al. 2010: 66-67).
[39] Das Demokratiemodell von Mansbridge wird hier als pragmatisch bezeichnet, da sie gegenüber den anderen beiden Autoren stärker die Praktikabilität ihrer Theorie in der politischen Praxis in den Blick nimmt. Damit wird sie, wie noch zu zeigen sein wird, der Aufgabe gerecht, die Rolle unkonventioneller Partizipation in der repräsentativen Demokratie sowohl normativ als auch empirisch angemessen erklären zu können.
[40] Diese minimalistische Definition stammt von John Dryzek (Mansbridge 2015: 27).
[41] Die Unerreichbarkeit eines Ideals ist aus dieser Perspektive noch kein definitives Argument gegen das Ideal. Obwohl z.B. die meisten Menschen das Ideal der Ehrlichkeit in ihrem Leben nicht immer vollkommen erfüllen werden, ist ihre prinzipielle Orientierung an diesem Ideal deshalb lange noch nicht falsch.
[42] Die vier Formen stellen deliberative Entscheidungsmechanismen ohne zwingende Macht dar. Sie unterscheiden sich aber von der klassisch-deliberativen Demokratie-theorie, nach der die Beteiligten die Deliberation mit verschiedenen Meinungen über das Gemeinwohl beginnen, aber nach einem rationalen Argumentationsprozess mit den Anderen zu einem wechselseitigen Einverständnis bzw. zu einem einzigen richtigen Ergebnis auf der Basis der gleichen Begründung gelangen (Mansbridge et al. 2011: 70).
[43] Hier zeigen sich sowohl Differenzen als auch Übereinstimmungen zur agonistischen Demokratietheorie von Mouffe (vgl. Teil 2.2). Einerseits können Deliberationsprozesse nach Mansbridge nicht einseitig auf Konflikt hin festgelegt werden, andererseits erkennt auch sie die wichtige Bedeutung von Wir-Sie-Unterscheidungen für die Herausbildung von politischen Identitäten an.
[44] In der politischen Praxis sind die dritte Verhandlungsphase und die zweite Deliberationsphase kaum voneinander zu trennen. Häufig beginnen z.B. die Verhandlungen direkt nachdem die Konflikte und Gemeinsamkeiten zwischen den Akteuren geklärt wurden (Mansbridge 2006: 119).
[45] Das Beispiel stammt von der Politik- und Managementwissenschaftlerin Mary Parker Follett, die schon 1925 auf die Möglichkeit von integrierten Lösungen aufmerksam gemacht hat (Mansbridge 2009: 15).
[46] An dieser Stelle wird auf eine ausführliche Beschreibung der klassischen Erzählung des Prisoners’ Dilemma verzichtet. Für mehr Hinweise siehe (Mansbridge 1990: 141-142).
[47] Es handelt sich hierbei um die klassische Frage nach good governance, d.h. um die Frage nach der Legitimität und Effektivität von Regierungstätigkeit: Wie ist die Ausübung staatlichen Zwanges in Form von positiven und negativen Sanktionen zu gestalten?
[48] Bargainingprozesse zählt Mansbridge auch zur dritten Verhandlungsphase. Obwohl sie das Bargaining analytisch von integrierten und kooperativ-distributiven Verhandlungen trennt, gesteht sie ein, dass in der politischen Praxis häufig Mix-Formen aller drei Verhandlungstypen angewendet werden. Das Bargaining wird hier nicht näher erläutert.
[49] In Beyond adversary democracy hat Mansbridge (1983) bereits darauf aufmerksam gemacht, dass aggregative und konsensuale Formen der Entscheidungsfindungen in jeweils unterschiedlichen Kontexten sinnvoll sind und daher nur ein Mix aus Verfahren der Aggregation und Deliberation zu legitimen und effektiven Politikergebnissen in den pluralistischen Demokratien führen kann.
[50] Mit diesem wissenschaftstheoretischen Doppelanspruch hat Jane Mansbridge ein Stück weit zur Überwindung der traditionellen Trennlinie zwischen normativen und empirischen Ansätzen in den Sozialwissenschaften beigetragen (Williams 2012).
[51] Im Folgenden wird im Rahmen dieser Arbeit aus Platzgründen nur noch von Stuttgart 21 oder abgekürzt von S 21 die Rede sein.
[52] Die vier Phasen in Bezug auf den Fall Stuttgart 21 sind nicht mit dem Vier-Phasen-Modell von Jane Mansbridge zu verwechseln, das in Kapitel 2.3 bereits erläutert wurde.
[53] Bei der K 21-Alternative der Projektgegner handelte es sich wohl um die gleiche Variante, die die Bahn in der frühen Projektentwicklungsphase gegenüber Stuttgart 21 bevorzugte (vgl. S. 72).
[54] Für eine Übersicht in Bezug auf weitere Aktionsformen, Unterstützergruppen und Ereignisse, die für die S 21-Proteste im Sommer 2010 eine Rolle spielten (vgl. Stuckenbrock 2013: 42-45).
[55] Zuvor versuchte sich Ministerpräsident Mappus (CDU) im Konflikt um Stuttgart 21 durch seinen autoritären und unnachgiebigen Führungsstil zu profilieren. Aufgrund der öffentlichen Kritik wegen der Ereignisse am schwarzen Donnerstag änderte Mappus allerdings seine Strategie und zeigte sich gesprächsbereit.
[56] Alle Teilnehmer des Schlichtungsverfahrens sind mit einem Steckbrief auf der folgenden Homepage zu finden: http://www.schlichtung-s21.de/teilnehmer.html (Zugriff am 5.11.2016). Hier sind auch die Sitzungsprotokolle der Schlichtung als PDF-Version zum Download verfügbar.
[57] Die Formulierung grün-rot drückt die Mehrheitsverhältnisse bei der Landtagswahl aus.
[58] Die befürwortende Position der SPD-Vertreter in Bezug auf Stuttgart 21 war selbst während des Wahlkampfes noch nicht ganz eindeutig, weshalb sie im Rahmen dieser Arbeit nicht zum politischen Lager der S 21-Befürworter gezählt wurden.
[59] Siehe das Video im Internet unter: https://www.youtube.com/watch?v=CQAgWicsuEk.
[60] Als Erklärung für die Abstimmungsergebnisse können vor allem die traditionelle parteipolitische Prägung der einzelnen Stadt- und Landkreise und der vermutete Schaden bzw. Nutzen von Stuttgart 21 für die einzelnen Stadt- und Landkreise angeführt werden (Brettschneider/Schwarz 2013: 289-290).
[61] Man denke hier z.B. an die Proteste gegen den Bau der Elbhilharmonie in Hamburg oder gegen den Bau des Flughafens in Berlin-Schönefeld.
[62] Die frühzeitige Information und Beteiligung in Stufe 1 ist vom Gesetzgeber zwar durchaus erwünscht, aber sie ist, im Gegensatz zur Auslegung und formellen Beteiligung in Stufe 2, nicht rechtsverbindlich.
[63] Auf der Internetseite www.konversion-mannheim.de (Zugriff am 5.11.2016) wird umfassend über die Hintergründe und aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Konversion in Mannheim informiert. Hier befindet sich ein Video, das Informationen über die Projekte und den Planungsstand gewährt. Im Folgenden werden Zitate von der Homepage immer mit (KM 2016) abgekürzt.
[64] Siehe Video im Internet unter: www.konversion-mannheim.de (Zugriff am 5.11.2016).
[65] Im Internet unter: http://www.konversion-mannheim.de/buergerbeteiligung/weissbuch-prozess (Zugriff am 5.11.2016) wird der Mannheimer Weißbuchprozess kurz erklärt. Hier sind auch die veröffentlichten Weißbücher 2012, 2013, 2014 als PDF zum Download verfügbar, in denen die Verwaltung den Beteiligungsprozess genau dokumentiert hat.
[66] Es waren insgesamt über 1.000 eingereichter Ideen, Vorschläge und Stellungnahmen, was als Indikator für die rege Beteiligung während des Weißbuchprozesses gelten kann.
[67] Auf die Initiativen und ihre Wohngruppenprojekte wird zum Schluss des Kapitels noch eingegangen.
[68] Dr. Konrad Hummel ist Beauftragter des Oberbürgermeisters für Konversion in Mannheim und hauptverantwortlich für den umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess. Er ist ein Experte im Bereich Kommunalpolitik und Bürgerbeteiligung und hat seine Erfahrungen in Mannheim unter anderem in der Publikation „Demokratie in den Städten“ niedergeschrieben (siehe Hummel 2015).
[69] Die Protokolle der Workshops lassen sich im Weißbuch (2012: 84-87) einsehen.
[70] Siehe im Internet unter: http://www.konversion-mannheim.de/buergerbeteiligung/ zukunftslotsen (Zugriff am 5.11.2016).
[71] Die Marken Grün und Wohnen bildeten nicht den einzigen Schwerpunkt. Weitere Informationen zu anderen Marken unter: http://www.konversion-mannheim.de/ (Zugriff am 5.11.2016).
[72] Information zur Realisierung des Grünzuges Nordost und dem damit in Verbindung stehenden Event der Bundesgartenschau 2023 unter: http://www.buga2023.de/ (Zugriff am 5.11.2016).
[73] Siehe Abb. 1 und 2 im Weißbuch (2013: 11) und/oder das Video auf der BUGA23-Homepage im Internet unter: http://www.buga2023.de/ (Zugriff am 5.11.2016).
[74] Der positive volkswirtschaftliche Nutzen für Städte, in denen die Bundesgartenschau stattgefunden hat, wie z.B. München, Schwerin und Koblenz, sei hier zu beachten (BUGA23 2016b: 18).
[75] Der Zeit-Artikel von Prothmann und Dartsch (2013) bringt die Stimmungslage in Mannheim kurz vor dem Bürgerentscheid über die BUGA23 am 22.09.2013 vielleicht ein wenig zu überspitzt zum Ausdruck.
[76] Siehe im Internet unter: http://www.konversion-mannheim.de/projekt/wohngruppen (Zugriff am 5.11.2016).
[77] Siehe die Selbstbeschreibung der Wohngruppe 13ha Freiheit unter: http://www.13ha freiheit.de/wohnprojekt-472.html (Zugriff am 5.11.2016). 13ha Freiheit wird hier stellver-tretend für alle drei Wohngruppen beschrieben. Auf die geringfügigen, konzeptionellen Unterschiede der drei Gruppierungen wird aus Platzgründen nicht näher eingegangen.
[78] Siehe die Selbstbeschreibung der Wohngruppe im Internet unter: http://www.13ha freiheit.de/wohnprojekt-472/konzept-13hafreiheit.html (Zugriff am 5.11.2016).
[79] Die Finanzierung der Wohnprojekte über die Mietshäuser Syndikat GmbH kommt dabei einer dauerhaft und effektiv funktionierenden Mietpreisbremse gleich. Siehe hierzu z.B. den Flyer „Freiheit leben – Freiheit finanzieren“ unter: http://www.13hafreiheit.de/ fileadmin/13ha/documents/Flyer_FreiheitLebenFinanzieren.pdf. (Zugriff am 5.11.2016). Für nähere Informationen zum Mietshäuser Syndikat siehe z.B. im Internet unter: http://swk-mannheim.de/mietshaeuser-syndikat/ (Zugriff am 5.11.2016).
[80] Siehe die Zeitschrift im Internet unter: http://www.konversion-mannheim.de/flaechen/ turley-areal (Zugriff am 5.11.2016). Hier sind alle Ausgaben der Turley-News zu finden, die ausführlich über die aktuellen Entwicklungen auf dem Turley-Gelände berichtet.
[81] Für eine ausführlichere Wiedergabe der Ergebnisse des ersten Mannheimer Demokratie Audits kann hier Demokratie in der Großstadt herausgegeben von Deth (2014) empfohlen werden.
[82] Markus Miessen hat mit Alptraum Partizipation (Miessen 2012) ein interessanten Bei-trag zur Diskussion über das Dogma der politischen Beteiligung heutzutage geschrieben. Obwohl Miessen zu einer berechtigten Kritik an dem naiven Je-mehr-Partizipation-desto-besser-Verständnis in der Sozialwissenschaft ansetzt, dass auch ich kritisiere, ist mir sein Partizipationsverständnis allgemein aber viel zu pessimistisch und auch zu elitär.
[83] Zur Politik der Mitte tragen nach der Kritik von Mouffe bekanntlich auch alle etablierten Parteien bei, weshalb eine Gegenbewegung vor allem aus der Zivilgesellschaft heraus bzw. durch eine Vernetzung der neuen, sozialen Bewegungen zu einem gegenhegemonialen, linken Projekt erfolgen soll (vgl. Teil 2.2, S. 42-43).
[84] Nicht nur Sprache, sondern alle möglichen Handlungsformen, wie z.B. Protestaktionen, können nach der Diskurstheorie von Laclau und Mouffe als Artikulationen gelten.
[85] Zwar ist Mouffes Kritik an der neoliberalen Hegemonie z.T. berechtigt. Ganz zustimmen kann ich ihrer Argumentation aber aus verschiedenen Gründen nicht (siehe unten).
[86] Mannheim ist auch eine Stadt in Baden-Württemberg. Ob aber ein Zusammenhang zwischen der Politik des Gehörtwerdens und der Mannheimer Konversion bestand, kann hier nicht genau gesagt werden. Vielleicht ging Letztere auch aus der Eigeninitiative Mannheims hervor.
Häufig gestellte Fragen zu Schriftenreihe „Komplexes Entscheiden“ (Professional Public Decision Making)
Was ist das Inhaltsverzeichnis dieser Leseprobe?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Einleitung, Wechselseitige Bedingtheit zwischen Demokratie und Partizipation, Rolle unkonventioneller Partizipation aus drei Perspektiven, Unkonventionelle Beteiligung für eine selbstbestimmte städtische Zukunft, Bewertung der drei Demokratieverständnisse, Fazit und Literaturverzeichnis.
Was ist das Vorwort der Leseprobe?
Das Vorwort beschreibt die Schriftenreihe "Komplexes Entscheiden", in der herausragende Arbeiten von Studierenden des gleichnamigen Masterstudiengangs der Universität Bremen veröffentlicht werden. Der Studiengang konzentriert sich auf interdisziplinäre Entscheidungsforschung.
Was sind die zentralen Themen der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert Politikskepsis und Demokratiemüdigkeit, wachsende Legitimationsdefizite in liberalen Demokratien, rückläufige Wahlbeteiligung, Mitgliederschwund in Parteien und Gewerkschaften, sowie die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft. Es wird die Frage aufgeworfen, wie die repräsentative Demokratie wieder stärker eine "Herrschaft des Volkes über sich selbst" werden kann.
Welche Aspekte werden in Bezug auf die wechselseitige Bedingtheit zwischen Demokratie und Partizipation behandelt?
Es wird die Notwendigkeit von Partizipation für eine Demokratie hervorgehoben, die Begriffsdefinition politischer Partizipation, sowie Formen und Reichweite der Beteiligung. Konventionelle und unkonventionelle Partizipation werden als Gegensatzpaar betrachtet.
Welche Demokratiemodelle werden im Hinblick auf die Rolle unkonventioneller Partizipation verglichen?
Es werden das deliberative Demokratiemodell von Jürgen Habermas, das agonistische Demokratiemodell von Chantal Mouffe und das pragmatische Demokratiemodell von Jane Mansbridge verglichen.
Welche Aspekte werden im Zusammenhang mit unkonventioneller Beteiligung für eine selbstbestimmte städtische Zukunft behandelt?
Es geht um die Potenziale und Risiken von mehr Demokratie in der Stadtentwicklung, die Auseinandersetzung um "Stuttgart 21", die chronologische Darstellung der Ereignisse und eine kritische Bestandsaufnahme von Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung, inklusive der Konversion in Mannheim.
Welche Kernaussagen werden im Fazit erwartet?
Das Fazit wird voraussichtlich die Ergebnisse der Analyse zusammenfassen und möglicherweise noch offene Fragen der Masterarbeit ansprechen.
Welche Literatur wird im Literaturverzeichnis angegeben?
Das Literaturverzeichnis enthält eine Liste der Fachliteratur die in dieser Arbeit untersucht wird.
- Citation du texte
- Jan Striemer (Auteur), 2016, Unkonventionelle Partizipation als Kompensation für die wachsenden Legitimationsdefizite repräsentativer Demokratie? Die Rolle von Protestbewegungen und Bürgerbeteiligung: Stuttgart 21 und die Mannheimer Konversion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359402