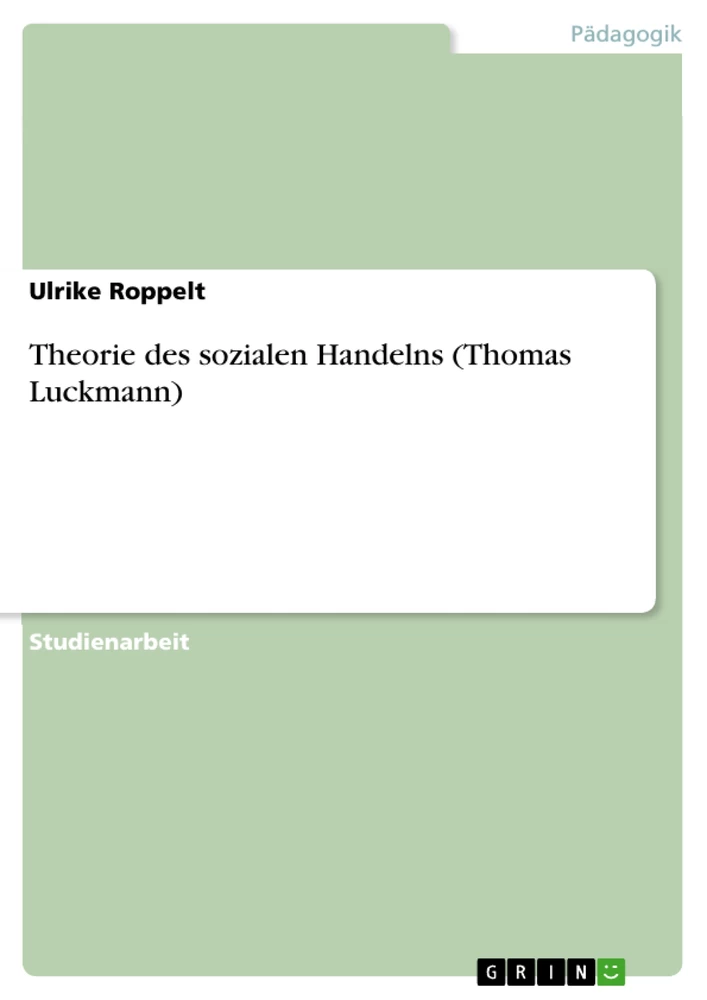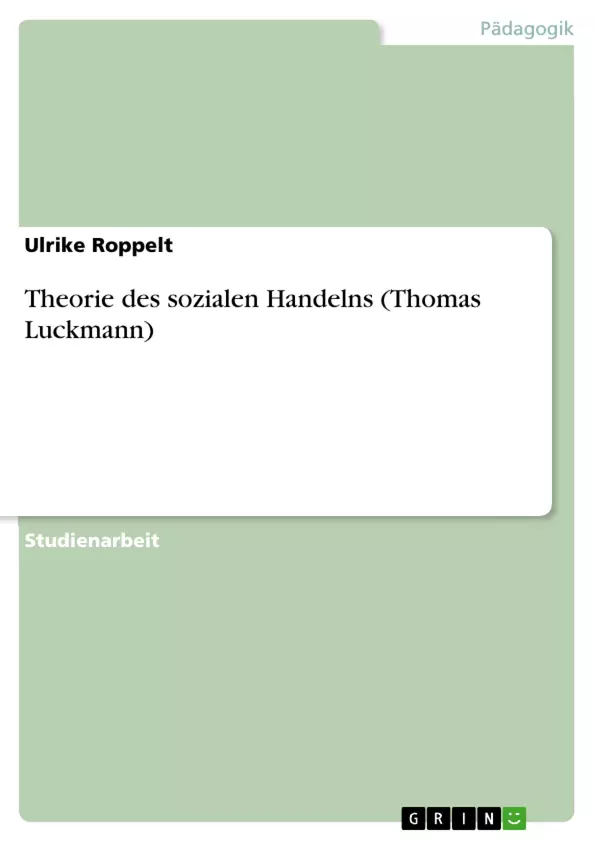Einleitung
Der Alltag eines Menschen ist geprägt von einer Fülle unterschiedlicher Handlungen. Es gibt kleine routinisierte Handlungen, wie Wecker stellen, Zähne putzen oder Kaffee kochen und große bedeutungsvolle Handlungen, wie eine Hochzeit, eine Bergbesteigung oder die Fertigstellung einer wissenschaftlichen Arbeit. Auch wenn nicht alles im menschlichen Leben Handeln ist, so besteht doch das elementare Grundgerüst jeden Tages im Prinzip aus einer Aneinanderreihung von Handlungen. Diese Verkettung, mit welcher sich der Mensch tagtäglich konfrontiert sieht, wird oft in ihrer Bedeutung nicht bewußt wahrgenommen: im Zusammenleben von Mitgliedern einer Gesellschaft muß der Mensch zum Überleben handeln. Ein Leben mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit ist denkbar, ein Tag gänzlich ohne Handlungen dagegen bleibt allein der Phantasie vorbehalten. Wir leben mit anderen Menschen, handeln für oder gegen andere. Die menschliche Gesellschaft kann aus diesem Blickwinkel auch als konkreter Handlungszusammenhang von Mitmenschen betrachtet werden und ist bereits - entstehungsgeschichtlich gesehen - das Ergebnis einer langen Handlungsfolge.
Es ist schwierig, die Komplexität menschlichen Handelns zu beschreiben und in Worte zu fassen. Diese Arbeit möchte trotzdem den Versuch wagen, das soziale Handeln als eine alltägliche Leistung in ihren Grundzügen zu umreißen. Im ersten Teil sollen die wichtigsten Grundlagen einer Beschäftigung mit menschlichem Handeln benannt werden - im Vordergrund stehen hierbei v.a. Aussagen zur Begrifflichkeit und ein kurzer geschichtlicher Abriß der Handlungstheorie.
Der Schwerpunkt der Arbeit befaßt sich mit der Theorie des sozialen Handelns von Luckmann - hier soll ein möglichst differenziertes Bild der Handlungsstruktur sowie des Handlungsvollzugs in seinen Grundzügen entwickelt werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlungstheorie als Grundlage der Sozialwissenschaften
- Handlungstheorie - ein geschichtlicher Abriß
- Handlungstheorien im Spannungsverhältnis von Individuum und Gesellschaft
- Phänomenologie
- Erläuterungen zum Begriff der Phänomenologie
- Phänomenologische Analyse
- Handeln als Wirklichkeitsveränderung und als Bewußtseinsleistung
- Erleiden und Tun
- Die Konstitution von Sinn im Handeln
- Der Sinngebungsprozeß im Erleiden (Typ 1)
- Der Sinngebungsprozeß im Tun (Typ 2)
- Sinn als Relation
- Das Verstehen von Handlungen
- Elementare Axiome
- Deutungsschema für das Handeln anderer
- Handeln und Verhalten
- Handeln in der Welt und Handeln in die Welt
- Die Zeit- und Sinnstruktur von Handeln
- Die Zeitperspektive des Entwurfs
- Die Zeitperspektive des Handlungsvollzugs
- Die Sinnstruktur des Handlungsvollzugs
- Der Zeit- und Sinnzusammenhang von Entwürfen
- Der Handlungsentwurf
- Entwurf als praktische Utopie
- Entwurf als Denkakt aus Bausteinen
- Entwerfen nach dem Baukastenprinzip
- Die Wahl zwischen Entwürfen
- Wahlvorgang
- Der Handlungsvollzug
- Die Schwellenüberschreitung im Handlungsvollzug
- Anfang und Ende des Handlungsvollzugs
- Verlaufstypen von Handlungen
- Erfolgreiche Handlung im engeren Sinn
- Erfolgreiche Handlungen im weiteren Sinn: Unterbrechung und Umweg
- Verlaufstyp: Abbruch der Handlung
- Verlaufstyp: Zielverfehlung
- Verlaufstyp: Zielveränderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Theorie des sozialen Handelns von Thomas Luckmann und zielt darauf ab, die Handlungsstruktur und den Handlungsvollzug im Detail zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Handelns als alltägliche Leistung und der Klärung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft im Kontext von Handlungstheorien.
- Handlungstheorie als Grundlage der Sozialwissenschaften
- Phänomenologie und ihre Rolle in der Analyse von Handeln
- Die Bedeutung von Sinn im Handeln
- Das Verstehen von Handlungen und die Interaktion zwischen Menschen
- Die Zeit- und Sinnstruktur von Handlungsentwürfen und -vollzügen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Alltag eines Menschen als ein Gefüge unterschiedlicher Handlungen dar und betont die Bedeutung des Handelns für das menschliche Zusammenleben.
Kapitel 2 beleuchtet die Handlungstheorie als Grundlage der Sozialwissenschaften, wobei ein historischer Überblick und die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft in Handlungstheorien behandelt werden.
Kapitel 3 widmet sich der Phänomenologie und erörtert den Begriff sowie die phänomenologische Analyse.
Kapitel 4 beleuchtet Handeln als Wirklichkeitsveränderung und als Bewußtseinsleistung. Dabei werden die Aspekte von Erleiden und Tun sowie die Konstitution von Sinn im Handeln, unterteilt in den Sinngebungsprozess im Erleiden und im Tun, behandelt.
Kapitel 5 befasst sich mit dem Verstehen von Handlungen und stellt elementare Axiome sowie ein Deutungsschema für das Handeln anderer vor.
Kapitel 6 analysiert das Verhältnis von Handeln in der Welt und Handeln in die Welt.
Kapitel 7 untersucht die Zeit- und Sinnstruktur von Handeln, wobei die Zeitperspektive des Entwurfs, des Handlungsvollzugs sowie die Sinnstruktur des Handlungsvollzugs und die Beziehung zwischen Zeit und Sinn in Entwürfen betrachtet werden.
Kapitel 8 beschäftigt sich mit dem Handlungsentwurf, der als praktische Utopie und Denkakt aus Bausteinen betrachtet wird.
Kapitel 9 behandelt den Handlungsvollzug, einschließlich der Schwellenüberschreitung im Handlungsvollzug, Anfang und Ende des Handlungsvollzugs sowie verschiedener Verlaufstypen von Handlungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen des sozialen Handelns, der Handlungstheorie, der Phänomenologie, der Sinnkonstitution, des Verstehens von Handlungen, der Zeit- und Sinnstruktur von Handeln sowie des Handlungsentwurfs und -vollzugs. Die Arbeit beschäftigt sich auch mit den Begriffen wie „Erleiden“ und „Tun“ sowie den verschiedenen Verlaufstypen von Handlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Handlungstheorie von Thomas Luckmann?
Luckmann analysiert soziales Handeln als eine alltägliche Leistung und untersucht, wie Individuen durch ihr Tun Sinn konstituieren und die Wirklichkeit verändern.
Was unterscheidet „Erleiden“ von „Tun“?
Handeln wird als „Tun“ definiert, während „Erleiden“ Vorgänge beschreibt, die dem Individuum widerfahren. Beides sind Prozesse der Sinngebung im Bewusstsein.
Wie funktioniert der Handlungsentwurf laut Luckmann?
Ein Entwurf ist ein Denkakt, der wie ein Baukastenprinzip funktioniert. Er dient als „praktische Utopie“, bevor die eigentliche Handlung vollzogen wird.
Welche Rolle spielt die Zeitstruktur beim Handeln?
Luckmann unterscheidet zwischen der Zeitperspektive des Entwurfs (Zukunft) und der des Handlungsvollzugs (Gegenwart/Vergangenheit), die den Sinnzusammenhang prägen.
Welche Verlaufstypen von Handlungen gibt es?
Es wird zwischen erfolgreichen Handlungen, Unterbrechungen, Umwegen, Abbrüchen sowie Zielverfehlungen oder Zielveränderungen unterschieden.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Roppelt (Autor:in), 1998, Theorie des sozialen Handelns (Thomas Luckmann), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3605