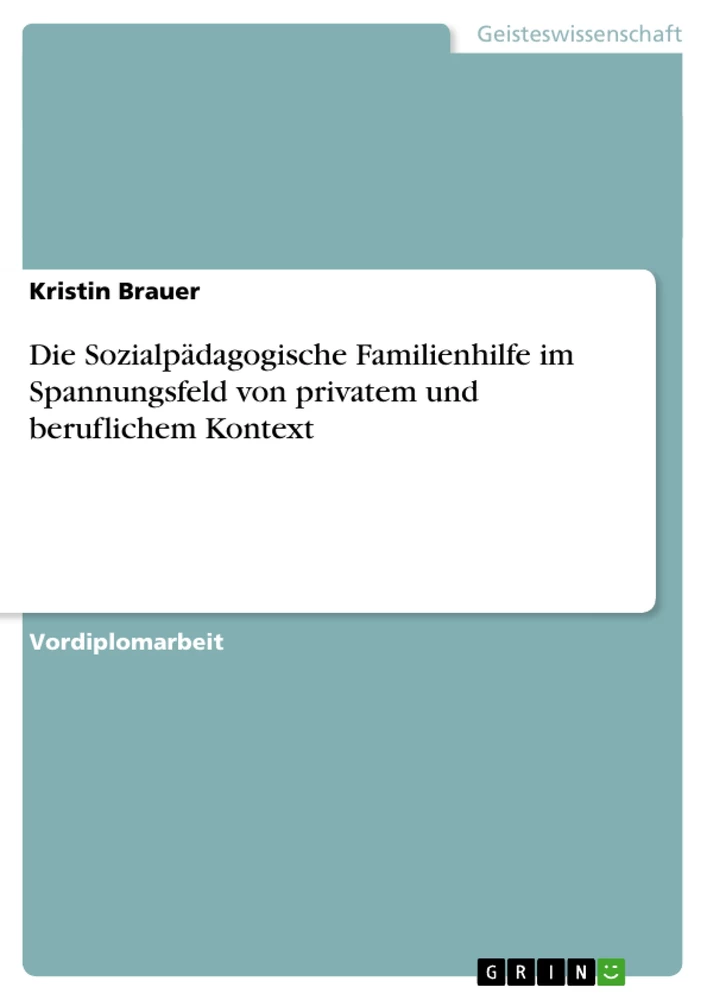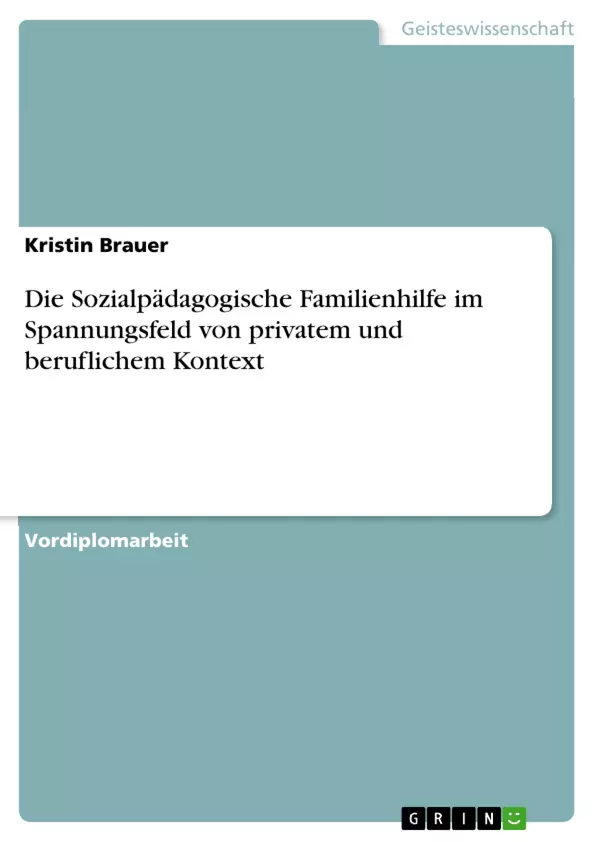In Bezug auf den historischen Kontext der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) soll auf verschiedene Spannungsfelder, als auch durch die Darlegung unterschiedlicher Klientelmerkmale welche deutlich die Arbeit beeinflussen und die verschiedenen Perspektiven hinsichtlich der vorfindbaren Arbeitsweisen, versucht werden ein möglichst allgemeingültiges Resultat zu formulieren, wie man es erreichen kann das vorhandene Spannungsfeld von privatem und beruflichem Kontext zu bearbeiten und welche möglichen Problematiken hier auffindbar sein könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale Definitionsbeschreibung des SPFH
- Rechtliche Einbindung
- Entstehung und seine historischen Vorläufer
- Das Klientel
- Merkmale des Klientel
- Wer erhält einen SPFH?
- Die Sozialpädagogische Familienhilfe
- Aufgaben
- Anforderungen
- Qualifikationen
- Arbeitsbedingungen und Formen der Hilfe
- Pädagogisches Handeln im Arbeitsfeld
- Schwierigkeiten im Hinblick auf Supervision als wichtige Vorraussetzung
- Ein Beispiel wie man in einer Gefahrensituation handeln kann
- Die Methoden mit denen ein SPFH arbeiten kann (theoretische Betrachtungsweise)
- Die Phasen des Hilfeplanprozesses
- Anfangsphase
- Hauptphase
- Abschlussphase
- Zeitliche Intensität/ Dauer der Hilfe
- Erfolge des SPFH
- Das Spannungsverhältnis
- Familie W aus L. als Beispiel für die Arbeit in der SPFH
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und untersucht das Spannungsfeld zwischen privatem und beruflichem Kontext, in dem sich diese Hilfeform bewegt. Ziel ist es, zu erforschen, wie dieses Spannungsfeld bestmöglich bearbeitet werden kann. Dazu werden die Entwicklung der SPFH, verschiedene Spannungsfelder, die Merkmale des Klientels und unterschiedliche Perspektiven hinsichtlich der Arbeitsweise beleuchtet. Durch die Analyse dieser Aspekte soll ein allgemeingültiges Resultat erzielt werden, das sowohl die Bewältigung des Spannungsfelds als auch die damit verbundenen Probleme beschreibt.
- Die Entwicklung der Sozialpädagogischen Familienhilfe
- Spannungsfelder in der Arbeit der SPFH
- Merkmale des Klientels, das die SPFH in Anspruch nimmt
- Verschiedene Perspektiven auf die Arbeitsweise der SPFH
- Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Spannungsfeld
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Sozialpädagogische Familienhilfe als ein Arbeitsfeld eines Sozialpädagogen vor und erklärt die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die Bearbeitung des Spannungsfelds von privatem und beruflichem Kontext in der SPFH konzentriert.
- Formale Definitionsbeschreibung des SPFH: Dieses Kapitel definiert die Sozialpädagogische Familienhilfe und beschreibt ihre rechtliche Einbindung im Kinder- und Jugendhilfegesetz. Es erläutert den Zweck der SPFH, die Zielgruppe und die Besonderheiten dieser Hilfeform im Vergleich zu anderen Hilfen zur Erziehung.
- Entstehung und seine historischen Vorläufer: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entstehung der SPFH in den 1960er Jahren in Berlin als präventives Mittel zur Vermeidung von Heimeinweisungen. Er erklärt die Faktoren, die zur Entwicklung dieser Hilfeform führten, und die historische Entwicklung der SPFH im Kontext der Jugendhilfe.
- Das Klientel: Dieses Kapitel beschreibt die Zielgruppe der Sozialpädagogischen Familienhilfe und deren Merkmale. Es analysiert, wer einen SPFH in Anspruch nehmen kann und welche Faktoren zu einer Inanspruchnahme führen können.
- Die Sozialpädagogische Familienhilfe: Dieser Abschnitt widmet sich den Aufgaben und Arbeitsbedingungen der SPFH. Er beleuchtet die Anforderungen an die Arbeit des Familienhelfers, die notwendigen Qualifikationen, verschiedene Formen der Hilfe und das pädagogische Handeln im Arbeitsfeld. Außerdem werden Schwierigkeiten im Hinblick auf Supervision und ein Beispiel für das Handeln in einer Gefahrensituation dargestellt.
- Die Methoden mit denen ein SPFH arbeiten kann (theoretische Betrachtungsweise): Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Methoden, die ein Familienhelfer im Rahmen seiner Arbeit einsetzen kann. Es bietet eine theoretische Betrachtungsweise der Methoden und ihrer Anwendung in der Praxis.
- Die Phasen des Hilfeplanprozesses: Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Phasen des Hilfeplanprozesses, der bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe durchgeführt wird. Die Phasen der Planung, Durchführung und Evaluation der Hilfe werden erläutert und die Bedeutung der aktiven Beteiligung aller Beteiligten hervorgehoben.
- Zeitliche Intensität/ Dauer der Hilfe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Dauer der Sozialpädagogischen Familienhilfe und deren zeitlicher Intensität. Es analysiert, wie lange ein Familienhelfer in der Regel in einer Familie tätig ist und welche Faktoren die Dauer der Hilfe beeinflussen können.
- Erfolge des SPFH: Dieser Abschnitt beleuchtet die Erfolge der Sozialpädagogischen Familienhilfe. Er präsentiert die positiven Auswirkungen der Hilfe auf Familien und Kinder und zeigt die Wirksamkeit des Konzepts auf.
Schlüsselwörter
Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine intensive ambulante Hilfe zur Erziehung, die Familien in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt. Sie ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verankert und zielt auf die Mobilisierung der Ressourcen und Selbsthilfekräfte der Familien ab. Die SPFH befasst sich mit komplexen Problemlagen, die zu Erziehungsschwierigkeiten, Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen führen können. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Wichtige Themenfelder sind die rechtliche Einbindung, die historische Entwicklung, das Klientel, die Arbeitsbedingungen, die Methoden und die Erfolge der SPFH. Zudem stehen das Spannungsverhältnis zwischen privatem und beruflichem Kontext, die Supervision und die Bedeutung des Hilfeplanprozesses im Zentrum der Betrachtung.
- Arbeit zitieren
- Kristin Brauer (Autor:in), 2004, Die Sozialpädagogische Familienhilfe im Spannungsfeld von privatem und beruflichem Kontext, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36066