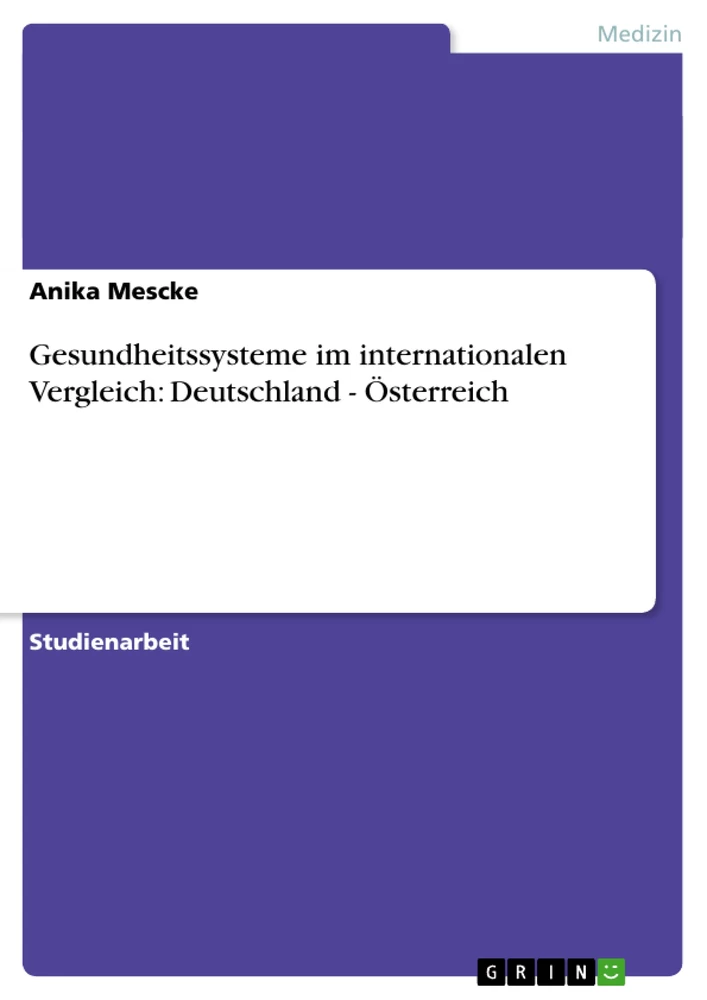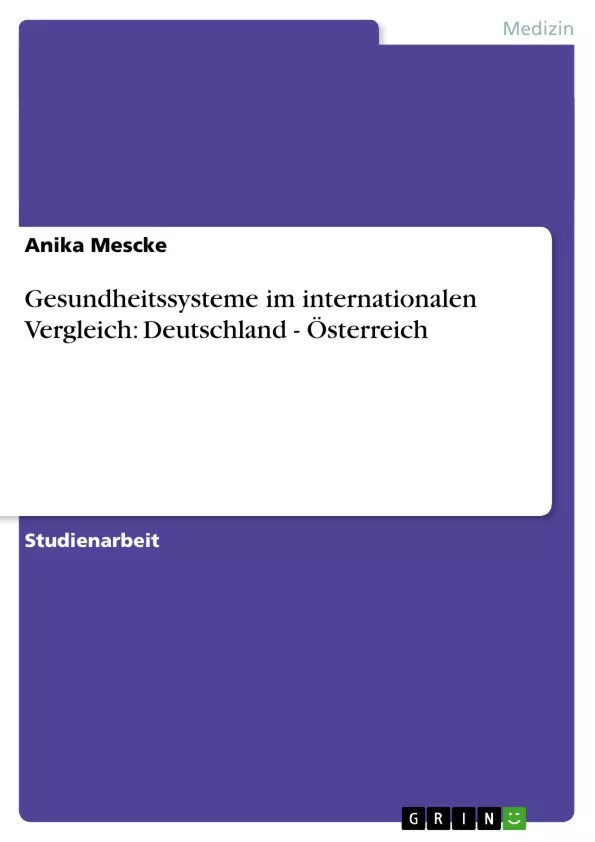Im Zeichen zunehmender Globalisierung und Europäisierung orientieren sich die nationalen Gesundheitssysteme zunehmend an der Entwicklung anderer Systeme. Dabei konzentriert sich die europaweite Diskussion nicht nur auf den reinen Vergleich der Systeme, sondern auch auf die allgemeine ökonomische Konvergenz, die als Zielsetzung der nationalen Gesundheitspolitik immer mehr in den Vordergrund rückt. Schon 1992 bemühten sich die Mitgliedsstaaten der EU um eine Annähung ihrer Volkswirtschaft. Dabei könnte aufgrund der Bemühungen zu einer ökonomischen Konvergenz, auf eine Konvergenz der Gesundheitssysteme (innerhalb von Europa) geschlossen werden.
Bei der Betrachtung verschiedener Gesundheitssysteme (GS) zeigen sich vor allem Unterschiede in der Organisation, der Finanzierung sowie in der Bereitstellung von Ressourcen, womit jeweils auch individuelle Stärken und Schwächen dieser Gesundheitssysteme verbunden sind.
Der Vergleich eines GS mit anderen Systemen anderer Staaten unterstützt des Weiteren einen gegenseitigen Lernprozess, der zu einer deutlichen Verbesserung der systematischen Ausgestaltung führen kann. Dabei wird angestrebt, die gesundheitliche Situation der Bevölkerung zu verbessern.
Das Ziel von GS- Vergleichen liegt primär darin, einen weitfassenden Überblick über die Entwicklung wichtiger Merkmale und Kerngrößen von GS anderer Länder zu bekommen. Darüber hinaus bieten GS-Vergleiche die Möglichkeit, den Stellenwert der medizinischen Versorgung und der Gesundheit in einem Land zu ermitteln. Damit ist der GS-Vergleich auch bedeutend für die Beurteilung der Effizienz und Effektivität eines GS.
In meiner vorliegenden Arbeit befasse ich mich ausschließlich mit dem Vergleich der GS Deutschland - Österreich. Dabei werde ich zunächst die beiden GS grob vorstellen und unter den Gesichtspunkten Struktur des GS, Finanzierung, Leistungserbringung, Verwendung der Finanzmittel sowie Reformen im GS beleuchten. Abschließend fasse ich die Stärken und Schwächen des österreichischen Gesundheitssystems noch einmal kurz zusammen und gehe darauf ein, was Deutschland von Österreich lernen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wirtschaftliche und Demografische Rahmenbedingungen
- Grundstruktur des Gesundheitswesens
- Organisationsstruktur
- Sozialversicherungssystem
- Pflichtversicherung/ Sozialversicherung
- Krankenversicherung
- Unfallversicherung
- Bundespflegegeld
- Finanzierung des Gesundheitssystems
- Finanzierung der Krankenversicherungsträger
- Zusätzliche Finanzierungsquellen
- Out-of-Pocket Payments
- Primärer Sektor
- Stationärer Sektor
- Ausgaben des Gesundheitssystems
- Leistungserbringung und Inanspruchnahme im Gesundheitssystem
- Primäre Gesundheitsversorgung
- Ärzte
- Spitalambulanzen
- Stationäre Gesundheitsversorgung
- Pflege
- Ambulante Pflege
- Stationäre Pflege
- Primäre Gesundheitsversorgung
- Mittelverwendung im Gesundheitssystem
- Budgetsetzung und Ressourcenallokation
- Finanzierung von Krankenhäusern
- Allgemeine Finanzierung
- Leistungsorientierte Krankenanstalten- Finanzierung / DRG- System
- Reformen im Gesundheitssystem
- Zielvorgaben
- Qualitätssicherung/ Qualitätsmessung
- Integrative Versorgung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Vergleich des Gesundheitssystems Deutschlands und Österreichs. Das Ziel des Vergleichs liegt in der Erörterung der strukturellen Unterschiede, der Finanzierung, der Leistungserbringung, der Verwendung von Finanzmitteln und der Reformbemühungen in beiden Systemen. Der Fokus liegt dabei auf der Identifizierung von Stärken und Schwächen des österreichischen Systems, um daraus Erkenntnisse für Deutschland zu gewinnen.
- Struktur des Gesundheitssystems
- Finanzierung des Gesundheitssystems
- Leistungserbringung und Inanspruchnahme
- Mittelverwendung im Gesundheitssystem
- Reformen im Gesundheitssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Gesundheits- systemvergleichen im Kontext der europäischen Integration und ökonomischen Konvergenz heraus. Sie betont die Bedeutung des gegenseitigen Lernens und der Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung. Die Arbeit fokussiert auf den Vergleich der Gesundheitssysteme Deutschlands und Österreichs und skizziert die Kernthemen der Analyse.
Das Kapitel "Wirtschaftliche und Demografische Rahmenbedingungen" beleuchtet die demografische Entwicklung beider Länder, insbesondere den Anstieg der Lebenserwartung und den Rückgang der Geburtenrate. Es werden die Auswirkungen dieser demografischen Veränderungen auf die Gesundheitssysteme diskutiert.
Das Kapitel "Grundstruktur des Gesundheitswesens" beschreibt die Organisationsstruktur des österreichischen Gesundheitswesens mit Schwerpunkt auf dem Sozialversicherungssystem. Es analysiert die verschiedenen Bereiche der Pflichtversicherung, einschließlich Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung.
Das Kapitel "Finanzierung des Gesundheitssystems" untersucht die Finanzierung des österreichischen Gesundheitswesens, inklusive der Finanzierung der Krankenversicherungsträger, zusätzlicher Finanzierungsquellen und "Out-of-Pocket Payments".
Das Kapitel "Ausgaben des Gesundheitssystems" befasst sich mit den Ausgaben im österreichischen Gesundheitssystem. Es untersucht die Entwicklung der Gesundheitsausgaben im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und betrachtet die unterschiedlichen Ausgabenanteile aus öffentlichen Quellen in der Europäischen Region der WHO.
Das Kapitel "Leistungserbringung und Inanspruchnahme im Gesundheitssystem" fokussiert auf die primäre und stationäre Gesundheitsversorgung, einschließlich der Rolle von Ärzten, Spitalambulanzen und der ambulanten und stationären Pflege.
Das Kapitel "Mittelverwendung im Gesundheitssystem" beleuchtet die Budgetsetzung und Ressourcenallokation im österreichischen Gesundheitssystem. Es betrachtet die Finanzierung von Krankenhäusern und die Rolle des DRG-Systems.
Das Kapitel "Reformen im Gesundheitssystem" befasst sich mit den Reformen im österreichischen Gesundheitssystem. Es analysiert die Zielvorgaben, die Qualitätssicherung und die Integrative Versorgung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich der Gesundheitssysteme Deutschlands und Österreichs und beleuchtet dabei Themen wie Organisationsstruktur, Finanzierung, Leistungserbringung, Mittelverwendung und Reformen. Weitere wichtige Schlagwörter sind Sozialversicherungssystem, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Bundespflegegeld, Out-of-Pocket Payments, DRG-System, Qualitätssicherung und Integrative Versorgung. Der Fokus liegt auf der Analyse der demografischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme und der Identifizierung von Stärken und Schwächen des österreichischen Systems im Hinblick auf Lehren für Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem deutschen und österreichischen Gesundheitssystem?
Unterschiede zeigen sich vor allem in der Organisationsstruktur, der Finanzierung (z. B. Out-of-Pocket Payments) und der Bereitstellung von Ressourcen.
Wie wird das österreichische Gesundheitssystem finanziert?
Die Finanzierung erfolgt über Sozialversicherungsbeiträge, zusätzliche öffentliche Quellen sowie private Zuzahlungen der Patienten (Out-of-Pocket Payments).
Was bedeutet „leistungsorientierte Krankenanstalten-Finanzierung“?
Dies bezieht sich auf das DRG-System, bei dem Krankenhäuser nach Fallpauschalen und erbrachten Leistungen statt nach Verweildauer finanziert werden.
Welchen Einfluss hat die Demographie auf beide Systeme?
Steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten erhöhen den Bedarf an medizinischer Versorgung und Pflege, was beide Systeme vor finanzielle Herausforderungen stellt.
Was kann Deutschland von Österreich lernen?
Die Arbeit analysiert Stärken des österreichischen Modells, wie etwa Aspekte der integrativen Versorgung oder der Ressourcenallokation, als mögliche Vorbilder.
- Quote paper
- Anika Mescke (Author), 2004, Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich: Deutschland - Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36072