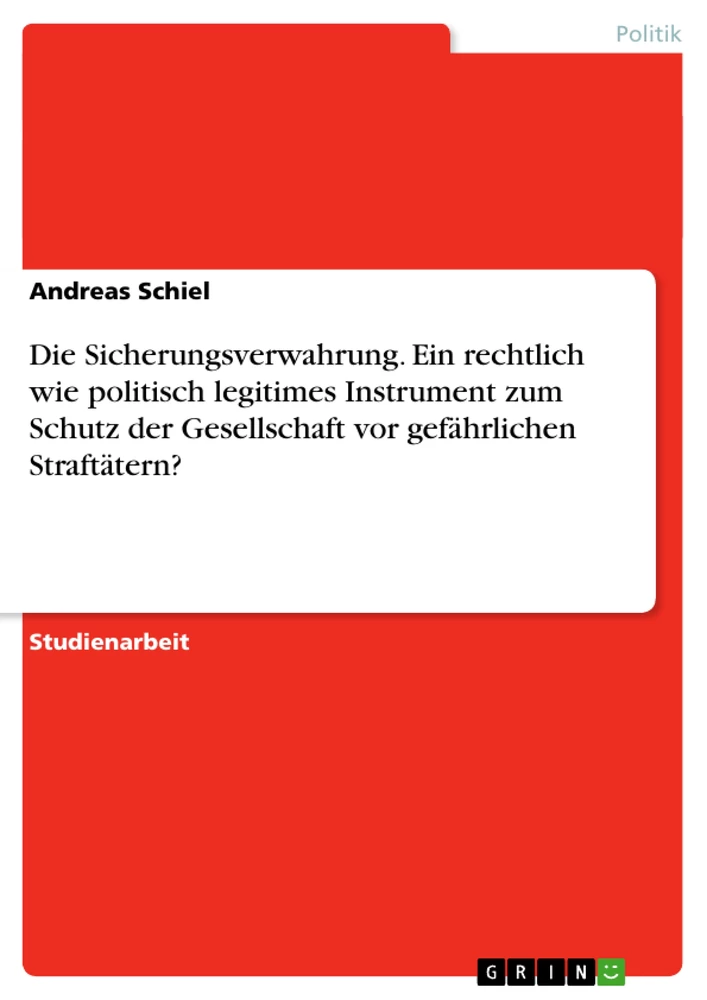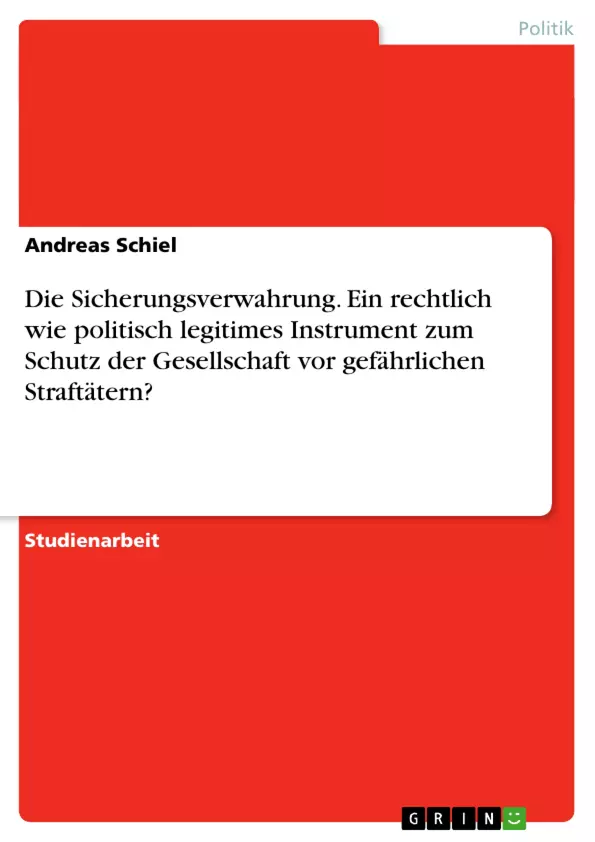„Wegschließen – und zwar für immer!“ forderte Bundeskanzler Gerhard Schröder im Sommer 2001 in einem Interview mit der Bild-Zeitung und verlangte die unbefristete Sicherungsverwahrung für Sexualverbrecher, die Morde an Kindern begehen. Seit Ende der 90er Jahre wird die rechtlich wie politisch umstrittene Sicherungsverwahrung fast ausschließlich mit dem Hinweis auf das Schutzbedürfnis der Gesellschaft vor gefährlichen, rückfälligen Sexualstraftätern legitimiert. Und in der Tat scheint diese Argumentation einleuchtend. Einige wenige, offenbar nicht therapierbare Täter lebenslang ‚wegzuschließen’ scheint ein geringer Preis für den Schutz unserer Kinder zu sein.
Doch eine nähere Beschäftigung mit der Thematik stimmt nachdenklich. Nicht nur stellt der aufmerksame Beobachter überrascht fest, dass ein knappes Viertel der sich heute in Sicherungsverwahrung befindlich Menschen dort wegen gewaltfreien Delikten wie Betrugs und Diebstahls einsitzt, auch stellen sich bei der Betrachtung des strafrechtlichen Instruments Sicherungsverwahrung schnell ernsthafte Bedenken ein. So ist die Verfassungskonformität der Sicherungsverwahrung seit ihrer Einführung schwer umstritten. Und auch wenn man sich in dieser Hinsicht von den zahlreichen affirmativen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts aus vergangenen Jahrzehnten und jüngster Zeit beruhigen lässt, so bleiben weitere Zweifel. Zu Befürchten steht, dass die Sicherungsverwahrung, die einen schwerwiegenden Eingriff in die Freiheitsrechte der von ihr Betroffenen bedeutet, ein weit gehend ineffizientes Instrument zum Schutz der Gesellschaft vor gefährlichen Straftätern darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sicherungsverwahrung – rechtliche Grundlagen und Anwendung
- Rechtlicher Charakter und Intention
- Gesetzliche Anordnungsvoraussetzungen
- Vollstreckung und Vollzug
- Rechtliche Legitimationsprobleme
- Unschärfe der materiellen Voraussetzungen
- Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
- Politische Legitimationsprobleme
- Notwendig? Zweifel an der Bedrohungsanalyse von Politik und Medien
- Effizient? Unzuverlässigkeit der Gefährlichkeitsprognosen
- Moralisch zu rechtfertigen? Die Wirkung des Maßregelvollzugs auf die Verwahrten
- Fazit und Ausblick
- Die Sicherungsverwahrung – rechtlich wie politisch fragwürdig
- Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Legitimität der Sicherungsverwahrung in Deutschland. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Anwendung dieses Instruments, beleuchtet kritische Punkte bezüglich seiner rechtlichen und politischen Legitimation, und bewertet seine Effizienz und moralische Vertretbarkeit.
- Rechtliche Grundlagen und Anwendung der Sicherungsverwahrung
- Rechtliche Legitimationsprobleme der Sicherungsverwahrung (Verfassungsmäßigkeit, Unschärfe der Voraussetzungen)
- Politische Legitimation der Sicherungsverwahrung (Notwendigkeit, Effizienz, moralische Aspekte)
- Bewertung der Gefährlichkeitsprognosen im Kontext der Sicherungsverwahrung
- Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die Betroffenen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sicherungsverwahrung ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach deren Legitimität. Sie verortet die Debatte im Kontext politischer Forderungen nach unbefristeter Sicherungsverwahrung für Sexualstraftäter, besonders im Hinblick auf den Schutz der Gesellschaft vor rückfälligen Tätern. Gleichzeitig werden jedoch Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und Effizienz des Instruments geäußert, welche im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden sollen.
Die Sicherungsverwahrung – rechtliche Grundlagen und Anwendung: Dieses Kapitel erläutert die rechtlichen Grundlagen der Sicherungsverwahrung. Es beschreibt ihren Charakter als Maßregel, nicht als Strafe, und hebt das erklärte Ziel des Schutzes der Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern hervor. Es differenziert zwischen formellen und materiellen Voraussetzungen für die Anordnung, wobei die Fokussierung auf Sexualdelikte seit der Reform von 1998 hervorgehoben wird. Die Ausführungen erläutern die Abwägung zwischen dem Schutz der Allgemeinheit und den Freiheitsrechten der Betroffenen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.
Rechtliche Legitimationsprobleme: Dieses Kapitel behandelt die Unschärfe der materiellen Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung und die damit verbundenen rechtlichen Bedenken. Es thematisiert die anhaltende Debatte um die Verfassungsmäßigkeit der Sicherungsverwahrung, obwohl das Bundesverfassungsgericht diese mehrfach bejaht hat. Die Diskussion konzentriert sich auf die schwerwiegenden Eingriffe in die Freiheitsrechte der Betroffenen und die Notwendigkeit einer genaueren Definition der Gefährlichkeit.
Politische Legitimationsprobleme: Dieses Kapitel befasst sich mit der politischen Legitimation der Sicherungsverwahrung. Es hinterfragt die Notwendigkeit des Instruments im Lichte einer kritischen Analyse der Bedrohungslage durch Politik und Medien. Es bewertet die Effizienz der Sicherungsverwahrung, indem es die Unzuverlässigkeit der Gefährlichkeitsprognosen thematisiert und den Maßregelvollzug in Bezug auf seine Wirkung auf die Inhaftierten kritisch beleuchtet. Dabei werden moralische Aspekte der lebenslangen Freiheitsentziehung diskutiert.
Schlüsselwörter
Sicherungsverwahrung, Rechtliche Legitimität, Politische Legitimität, Gefährlichkeitsprognose, Verfassungsmäßigkeit, Sexualstraftäter, Maßregelvollzug, Freiheitsrechte, Verhältnismäßigkeit, Rückfallprophylaxe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sicherungsverwahrung in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Legitimität der Sicherungsverwahrung in Deutschland. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Anwendung, beleuchtet kritische Punkte bezüglich der rechtlichen und politischen Legitimation und bewertet Effizienz und moralische Vertretbarkeit. Der Inhalt umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den rechtlichen Grundlagen und Anwendung, rechtlichen und politischen Legitimationsproblemen, sowie ein Fazit und Ausblick. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche rechtlichen Grundlagen und Anwendungen der Sicherungsverwahrung werden behandelt?
Die Arbeit erläutert die rechtlichen Grundlagen der Sicherungsverwahrung als Maßregel, nicht als Strafe, mit dem Ziel des Schutzes der Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern. Sie beschreibt die formellen und materiellen Voraussetzungen für die Anordnung, die Fokussierung auf Sexualdelikte seit 1998 und die Abwägung zwischen dem Schutz der Allgemeinheit und den Freiheitsrechten der Betroffenen unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips.
Welche rechtlichen Legitimationsprobleme werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt die Unschärfe der materiellen Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung und die damit verbundenen rechtlichen Bedenken. Sie thematisiert die anhaltende Debatte um die Verfassungsmäßigkeit, trotz positiver Urteile des Bundesverfassungsgerichts, fokussiert auf die schwerwiegenden Eingriffe in die Freiheitsrechte und die Notwendigkeit einer genaueren Definition der Gefährlichkeit.
Welche politischen Legitimationsprobleme werden angesprochen?
Die Arbeit hinterfragt die politische Notwendigkeit der Sicherungsverwahrung anhand einer kritischen Analyse der Bedrohungslage durch Politik und Medien. Sie bewertet die Effizienz durch die Thematisierung der Unzuverlässigkeit von Gefährlichkeitsprognosen und beleuchtet kritisch den Maßregelvollzug und seine Auswirkungen auf die Inhaftierten. Moralische Aspekte der lebenslangen Freiheitsentziehung werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Sicherungsverwahrung, Rechtliche Legitimität, Politische Legitimität, Gefährlichkeitsprognose, Verfassungsmäßigkeit, Sexualstraftäter, Maßregelvollzug, Freiheitsrechte, Verhältnismäßigkeit, Rückfallprophylaxe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den rechtlichen Grundlagen und der Anwendung der Sicherungsverwahrung, ein Kapitel zu den rechtlichen Legitimationsproblemen, ein Kapitel zu den politischen Legitimationsproblemen und abschließend ein Fazit mit Ausblick. Jedes Kapitel wird zusammengefasst und die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis.
Welche zentralen Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist die Legitimität der Sicherungsverwahrung in Deutschland, sowohl aus rechtlicher als auch aus politischer Perspektive. Dabei werden Fragen nach der Verfassungsmäßigkeit, Effizienz und moralischen Vertretbarkeit des Instruments untersucht.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Sicherungsverwahrung sowohl rechtlich als auch politisch fragwürdig ist. Der Ausblick thematisiert Perspektiven für eine Reform oder mögliche Alternativen zur Sicherungsverwahrung.
- Citar trabajo
- Andreas Schiel (Autor), 2004, Die Sicherungsverwahrung. Ein rechtlich wie politisch legitimes Instrument zum Schutz der Gesellschaft vor gefährlichen Straftätern?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36154