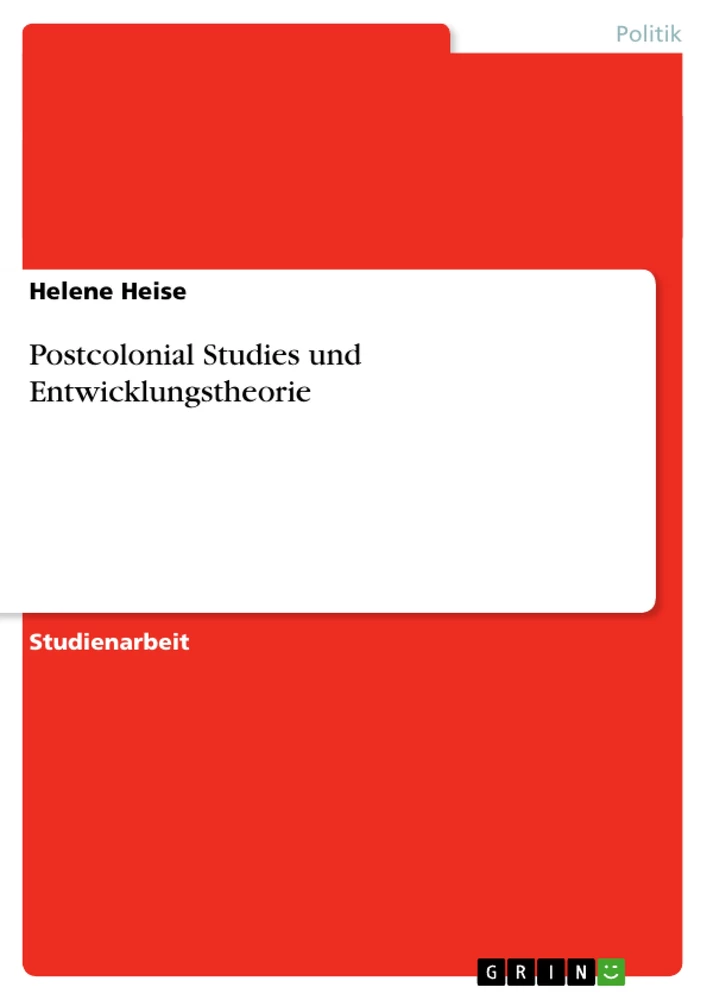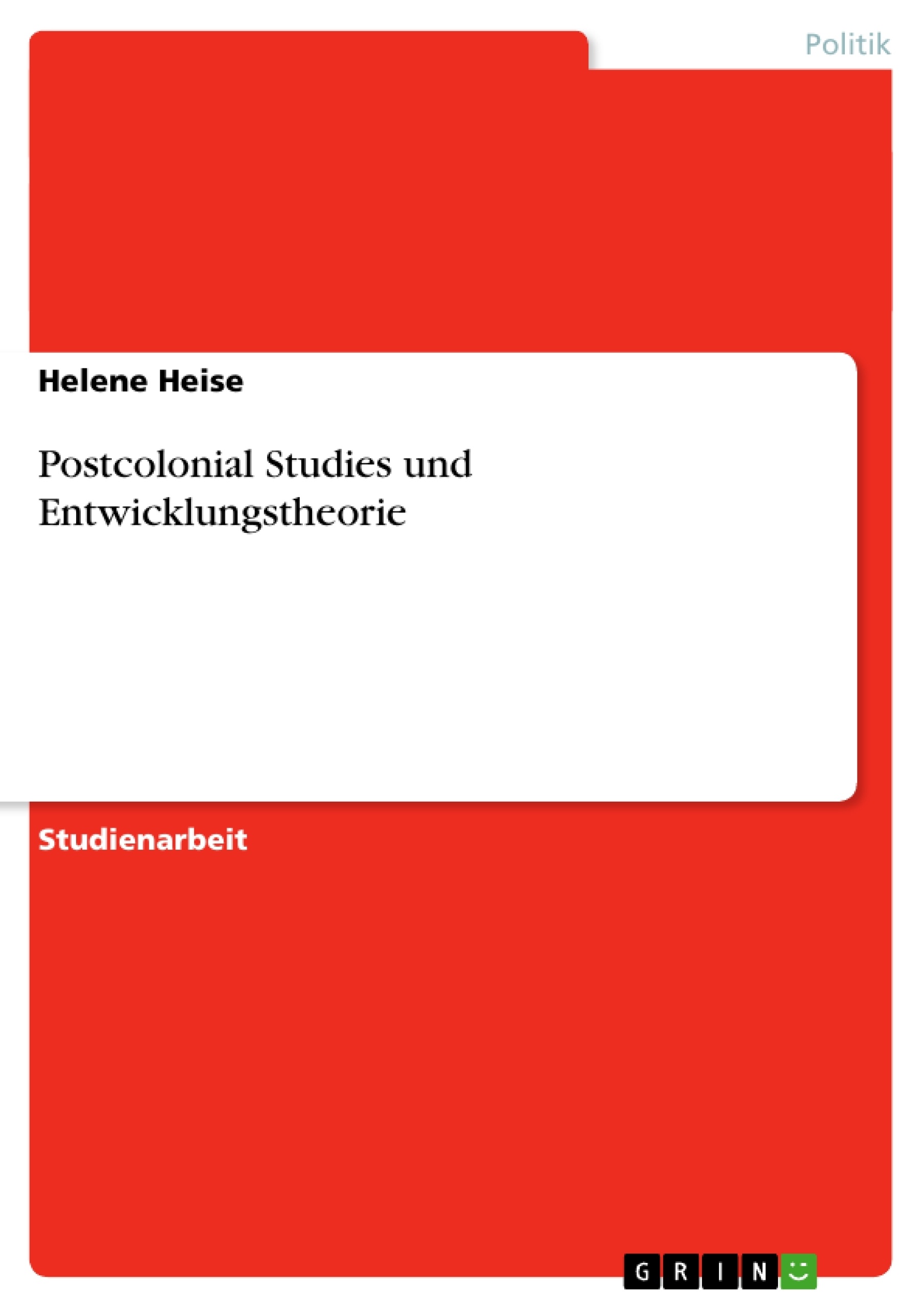Einleitung
Postcolonial theory ist keine Entwicklungstheorie, vielmehr ist sie ein Analyseinstrument aus den Geistes- und Kulturwissenschaften, dass nach der Verbindung zwischen (wissenschaftlich produziertem) Wissen und Machtausübung während und nach Ende der Kolonialzeit fragt.1 Hierfür bedient sie sich der Methode der Diskursanalyse: es wird gefragt, in wieweit ein (wissenschaftlicher) Diskurs dazu dient, Machtstrukturen oder eine Weltordnung festzulegen. Wer bestimmt, was (wissenschaftlich) gesicherte Erkenntnisse sind, was richtig und falsch, gut und schlecht ist, der legitimiert bestimmte Formen von Herrschaft und Ordnung.2 Dies muss kein bewusster, absichtsvoller Prozess sein und ist er auch historisch nur zum Teil gewesen, er lässt sich aber mit Hilfe der Diskursanalyse aufdecken und untersuchen.
Um der Frage nachzugehen, inwieweit die postcolonial theory im Rahmen der Entwicklungstheorie eine Rolle spielen kann, reicht es daher nicht, einfach nur die Ideen der postcolonial studies darzustellen. Diese sind nicht im entwicklungstheoretischen Kontext entstanden und auch in der politikwissenschaftlichen Diskussion bisher noch nicht gründlich verankert. Aus diesem Grund scheint es sinnvoll, die postcolonial theory auf die Entwicklungstheorie anzuwenden: Entwicklungstheorie soll hier im Sinne der postcolonial studies als ein wissenschaftlicher Diskurs verstanden werden. In ihm wird festgelegt, was Entwicklung ist, wie sie vonstatten gehen soll und was die Ziele der Entwicklung sein können. Damit ist sie keine ‚objektive’ Beschreibung von Ist-Zustand und möglichen Wegen zu einer Veränderung, sondern legt im Diskurs selbst fest, was als richtige oder falsche, gute oder schlechte ‚Entwicklung’ zu verstehen ist.3
----------
1 Vgl. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin: Post-Colonial Studies. The Key Concepts. London 1998. S. 1-3; Ato Quayson: Postcolonialism. Theory, Practice or Process? Cambridge 2000. S. 2-5
2 Vgl. Robert J.C. Young: Postcolonialism. A Very Short Introduction. Oxford 2003; ders.: Postcolonialism. An Historical Introduction. Oxford 2001; Edward W. Said: Orientalism. Western Conceptions of the Orient. London 41995; Jürgen Osterhammel: Kolonialismus. Geschichte – Formen – Folgen. München 2001.
3 Vgl. Young: Historical Introduction, S. 46-56; Rita Abrahamsen: African Studies and the Postcolonial Challenge. In: African Affairs 102 (2003), S. 189-210. hier: S. 201-204.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Good Governance
- Weltbank
- UNDP
- Deutschland und EU
- Vergleich
- Kritik aus Sicht der postcolonial studies
- Power-knowledge
- Eurozentrismus
- Binäre Gegensätze
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern die postcolonial theory im Kontext der Entwicklungstheorie eine Rolle spielen kann. Die Arbeit betrachtet Entwicklungstheorie aus der Perspektive der postcolonial studies als einen wissenschaftlichen Diskurs, der festlegt, was Entwicklung ist, wie sie ablaufen soll und welche Ziele sie verfolgt.
- Die Analyse des Konzepts von "Good Governance" im Rahmen der Entwicklungstheorie als Beispiel für die Wirkungsweise der Entwicklungstheorie auf die politische Realität in Entwicklungsländern.
- Die Untersuchung der unterschiedlichen Definitionen und Schwerpunkte von "Good Governance" durch die Weltbank, UNDP und das BMZ.
- Die Kritik an der Entwicklungstheorie aus der Sicht der postcolonial studies, insbesondere die Kritik an Machtverhältnissen und Eurozentrismus.
- Die Darstellung der postcolonial theory als Analyseninstrument, das die Verbindung zwischen Wissen und Macht während und nach der Kolonialzeit untersucht.
- Die Frage, inwiefern Entwicklungstheorie zur Verfestigung politischer und kultureller Machtverhältnisse in Entwicklungsländern beiträgt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die postcolonial theory als ein Analyseninstrument vor, das nach der Verbindung zwischen Wissen und Macht während und nach der Kolonialzeit fragt. Sie argumentiert, dass die postcolonial theory im Rahmen der Entwicklungstheorie eine Rolle spielen kann, da sie die Entwicklungstheorie als einen Diskurs betrachtet, der festlegt, was Entwicklung ist und wie sie ablaufen soll.
- Good Governance: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept des "Good Governance", das in den 1990er Jahren in der Entwicklungstheorie und -politik eingeführt wurde. Es stellt die unterschiedlichen Definitionen und Schwerpunkte dieses Konzepts durch die Weltbank, UNDP und das BMZ dar. Der Fokus liegt auf den Kriterien, die für gute Regierungsführung erfüllt sein müssen, sowie auf den Auswirkungen auf die politische Realität in Entwicklungsländern.
- Kritik aus Sicht der postcolonial studies: Dieses Kapitel beleuchtet die Kritik an der Entwicklungstheorie aus der Sicht der postcolonial studies. Es beleuchtet die Konzepte von "Power-knowledge", "Eurozentrismus" und "binären Gegensätzen", die in der Entwicklungstheorie kritisch hinterfragt werden. Der Fokus liegt darauf, wie die Entwicklungstheorie dazu beiträgt, Machtverhältnisse zu festigen und eurozentrische Perspektiven zu reproduzieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Verbindung von postcolonial studies und Entwicklungstheorie, wobei Begriffe wie "Good Governance", "Power-knowledge", "Eurozentrismus", "binäre Gegensätze", "Diskursanalyse" und "Entwicklungspolitik" im Mittelpunkt stehen. Die Arbeit analysiert die Wirkungsweise der Entwicklungstheorie auf die politische Realität in Entwicklungsländern und beleuchtet kritische Perspektiven aus der postcolonial theory.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Postcolonial Studies?
Sie untersuchen die Verbindung zwischen Wissen und Macht und fragen, wie Diskurse dazu dienen, koloniale Machtstrukturen auch nach der Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten.
Wie wird Entwicklungstheorie aus postkolonialer Sicht kritisiert?
Sie wird oft als eurozentrischer Diskurs gesehen, der westliche Standards als universell vorgibt und dadurch andere Kulturen abwertet.
Was bedeutet "Good Governance" in diesem Zusammenhang?
Es ist ein Konzept für "gute Regierungsführung", das von Organisationen wie der Weltbank gefordert wird, aber oft westliche politische Modelle als einzige Lösung darstellt.
Was meint der Begriff "Power-knowledge"?
Er beschreibt, dass Wissen nicht neutral ist, sondern dass diejenigen, die definieren, was als "richtiges" Wissen gilt, damit Macht über andere ausüben.
Welche Rolle spielen binäre Gegensätze in der Entwicklungspolitik?
Gegensätze wie "entwickelt/unterentwickelt" oder "modern/traditionell" zementieren Hierarchien und rechtfertigen das Eingreifen westlicher Akteure.
- Citar trabajo
- Helene Heise (Autor), 2004, Postcolonial Studies und Entwicklungstheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36328