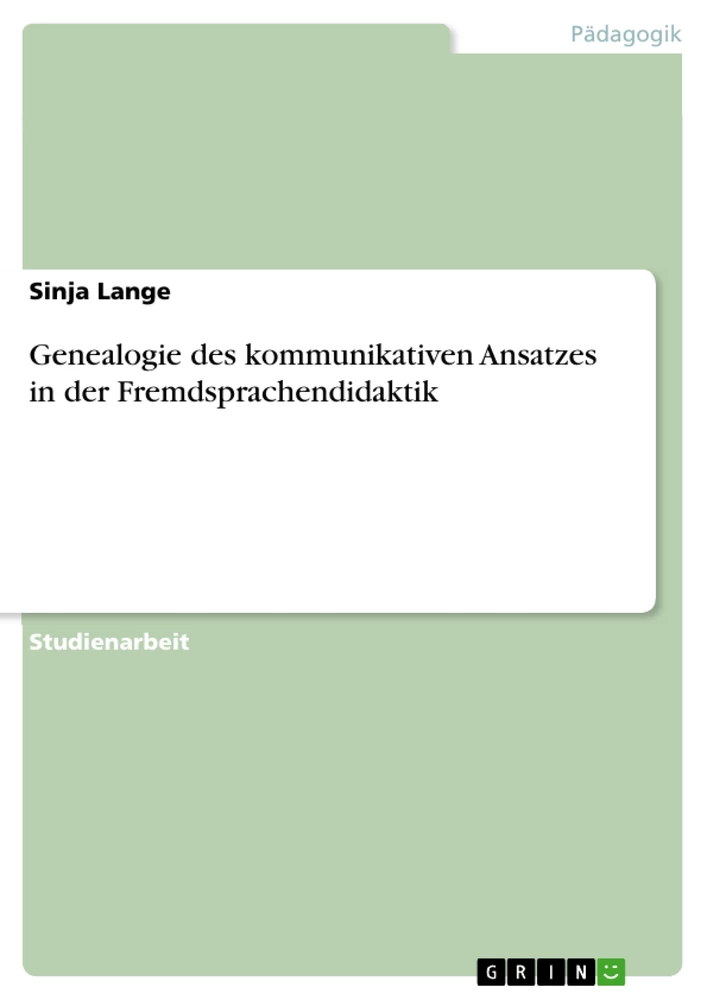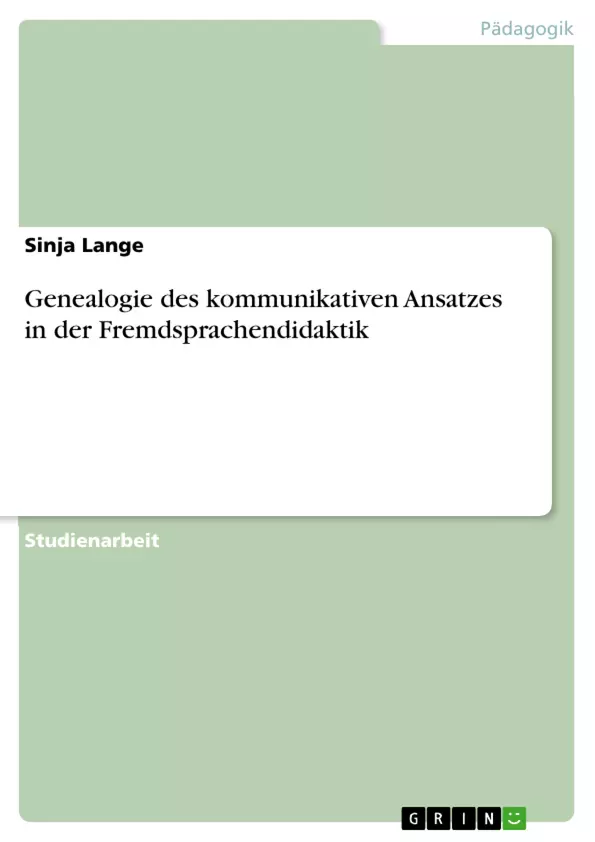Wie lernt man eine Sprache besser als durch Sprechen?! Indem man immer wieder übt und versucht, sich auszudrücken, auf Fragen zu antworten, Fragen zu stellen - eben eine Konversation zu führen - benutzt man die Sprache und wird sie mehr und mehr beherrschen.
Wie lässt sich die Grammatik in den Hintergrund stellen, sodass sie nur noch funktionell gelehrt werden kann? Welche didaktischen und methodischen Prinzipien bzw. Vorgehensweisen beinhalten beide Ansätze? Lassen sich beide Ansätze vergleichen? Ist die Inlingua-Methode gleichzusetzen mit dem kommunikativen Ansatz oder lassen sich erhebliche Unterschiede nachweisen?
Um diese Fragen zu beantworteten, erscheint es mir unumgänglich den Entstehungsprozess des kommunikativen Ansatzes aufzuarbeiten. Denn alle Autoren sind sich einig: der kommunikative Ansatz entwickelte sich ausgehend von der Sprechakttheorie und basiert auf den von Habermas sowie Hymes ausgearbeiteten konzeptionellen Definitionen von „kommunikativer Kompetenz“.
In Hinsicht auf die Lernform Problembasiertes Lernen eröffnen sich mir daraus zwei Problemstellungen: (1) Ich möchte die grundlegenden Konzepte, die zur Entstehung des kommunikativen Ansatzes führten nachvollziehen können. (2) Ich möchte wissen, was die Besonderheiten einer kommunikativ ausgerichteten Didaktik sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was kann unter „kommunikativ ausgerichteter Unterricht“ verstanden werden?
- Kommunikative Kompetenz
- Habermas' Theorie der idealen Sprechsituation
- Hymes' Analyse realer Kommunikation
- Synthese beider Ansätze
- Sprechakttheorie
- Kommunikativer Fremdsprachenunterricht
- Entstehung
- Würdigung
- Heute
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Entstehung des kommunikativen Ansatzes in der Fremdsprachendidaktik und erörtert dessen Bedeutung für den heutigen Unterricht. Er zeigt die theoretischen Grundlagen des Ansatzes auf, die aus der Sprechakttheorie und den Konzepten der kommunikativen Kompetenz von Habermas und Hymes resultieren.
- Der Aufstieg des kommunikativen Ansatzes im Kontext der gesellschaftlichen und bildungspolitischen Veränderungen der 1970er Jahre.
- Die Definition und die Bedeutung der kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht.
- Die Rolle der Sprechakttheorie in der Entwicklung des kommunikativen Ansatzes.
- Der Vergleich zwischen Habermas' Theorie der idealen Sprechsituation und Hymes' Analyse realer Kommunikation.
- Die Bedeutung des kommunikativen Ansatzes für die Praxis des Fremdsprachenunterrichts.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Forschungsinteresse des Autors vor. In Kapitel 2 wird der Begriff des „kommunikativ ausgerichteten Unterrichts“ definiert. Dabei wird die Bedeutung der kommunikativen Kompetenz für den Fremdsprachenunterricht betont. Kapitel 2.1 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der kommunikativen Kompetenz, insbesondere die Ansätze von Habermas und Hymes. Kapitel 2.2 stellt die Sprechakttheorie als wichtige Grundlage für den kommunikativen Ansatz vor.
In Kapitel 3 wird die Entstehung des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts, seine Würdigung und seine aktuelle Relevanz besprochen. Der Text geht allerdings nicht auf die Schlussfolgerung oder den Inhalt des letzten Kapitels ein, um keine Spoiler zu liefern.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die Entstehung und Entwicklung des kommunikativen Ansatzes in der Fremdsprachendidaktik, die Bedeutung der kommunikativen Kompetenz, die Sprechakttheorie, die theoretischen Ansätze von Habermas und Hymes, sowie der Vergleich von idealer und realer Kommunikation. Weitere wichtige Begriffe sind: Emanzipation, Gesellschaftskritik, Bildungskritik, Paradigmenwechsel, Didaktik, Methoden, Sprachlehre und Fremdsprachenunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des kommunikativen Ansatzes?
Das Ziel ist die Vermittlung von "kommunikativer Kompetenz", also der Fähigkeit, sich in einer Fremdsprache situationsgerecht auszudrücken und Konversationen zu führen, anstatt nur Grammatikregeln zu beherrschen.
Welche Rolle spielt die Sprechakttheorie?
Die Sprechakttheorie bildet eine theoretische Grundlage, da sie Sprache als Handeln begreift (z. B. Bitten, Versprechen, Fragen) und den Fokus auf die Funktion der Äußerung legt.
Wie unterscheiden sich die Ansätze von Habermas und Hymes?
Habermas konzentriert sich auf die "ideale Sprechsituation" und die emanzipatorische Kraft der Sprache, während Hymes die Analyse realer, soziokulturell geprägter Kommunikation betont.
Warum trat die Grammatik in diesem Ansatz in den Hintergrund?
Grammatik wird im kommunikativen Unterricht nur noch funktionell gelehrt, das heißt als Mittel zum Zweck der Verständigung, nicht als Selbstzweck.
Wann entstand der kommunikative Ansatz?
Der Ansatz entwickelte sich maßgeblich in den 1970er Jahren als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen und die Kritik an rein strukturellen Lehrmethoden.
- Quote paper
- Sinja Lange (Author), 2017, Genealogie des kommunikativen Ansatzes in der Fremdsprachendidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/364792