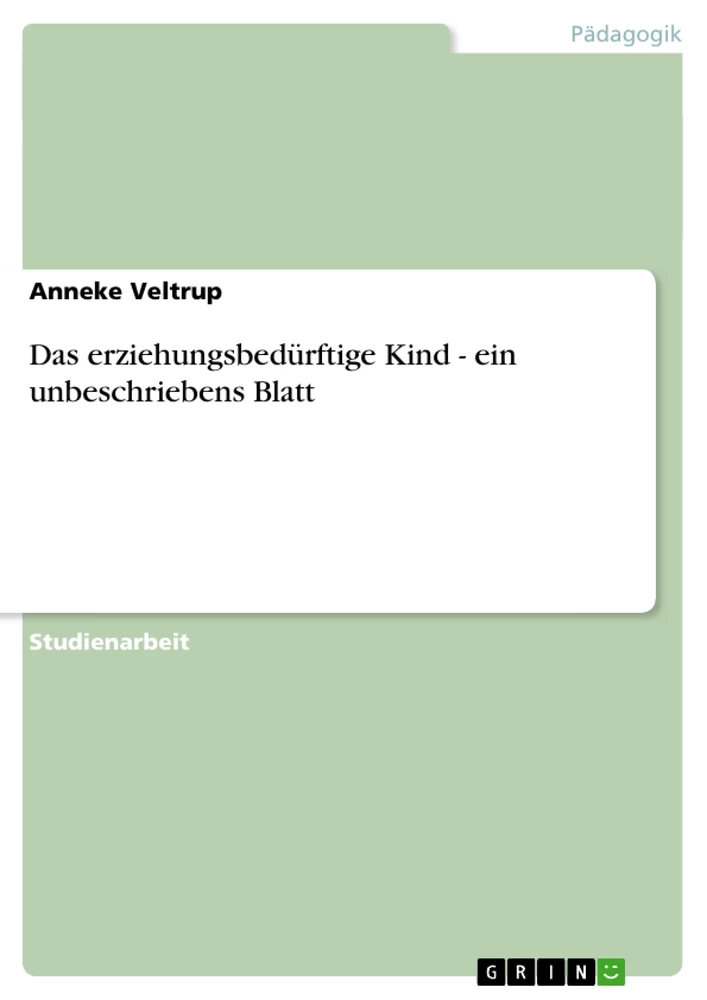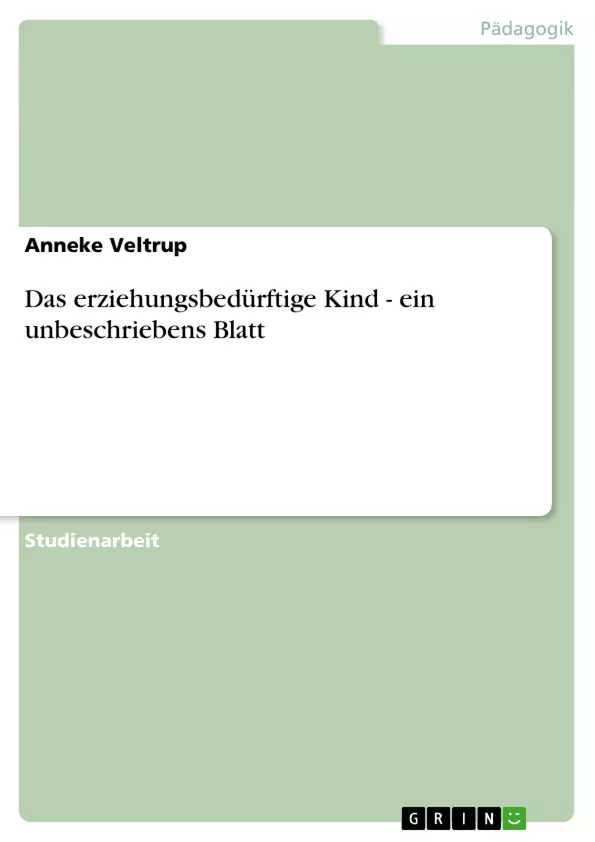Einführung
Im Rahmen der Anlage-Umwelt-Problematik soll diese Seminararbeit einen Einblick in den Entwicklungs- und Erziehungsprozess des Menschen geben. In diesem Zusammenhang wird in einem ersten Schritt die Frage nach der Erziehungsbedürftigkeit oder sogar –notwendikeit des Menschen im Vordergrund stehen.
Eng daran anschließend und aus der Konsequenz resultierend, dass der Mensch zumindest erziehungsbedürftig ist, rückt dann die Erziehbarkeit in den Blickpunkt. Im Verlauf wird hier zunächst ein Einblick in die Anlage-Umwelt- Debatte gegeben, um anschließend die Bedeutung dieser Entwicklungseckpunkte für Erziehung herauszustellen. Der dritte Schritt wirft dann die Frage nach der Planbarkeit von Erziehung auf, um auf diese Weise Spielräume und Grenzen von Erziehung noch einmal zu verdeutlichen. Im abschließenden Ausblick wird es darum gehen, inwieweit Kinder auf Anregungen durch die Umwelt angewiesen sind und inwieweit Förderung durch die Eltern sinnvoll ist. Am Ende bleibt die Frage, ob die Debatte um Anlage und Umwelt vorbei sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Erziehungsbedürftigkeit und Erziehbarkeit im Spannungsfeld von Anlage, Umwelt und Selbstbestimmung
- Erziehungsbedürftigkeit
- Erziehbarkeit
- Die Frage nach der Planbarkeit von Erziehung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Entwicklungs- und Erziehungsprozess des Menschen im Kontext der Anlage-Umwelt-Problematik. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Erziehungsbedürftigkeit des Menschen und die daraus resultierende Erziehbarkeit. Die Arbeit analysiert die Anlage-Umwelt-Debatte und deren Bedeutung für Erziehung. Schließlich werden die Grenzen und Möglichkeiten der Planbarkeit von Erziehung beleuchtet.
- Erziehungsbedürftigkeit des Menschen
- Erziehbarkeit und das Anlage-Umwelt-Problem
- Pädagogischer Pessimismus und Optimismus
- Planbarkeit von Erziehung
- Bedeutung von Umwelteinflüssen und Förderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung
Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und erläutert den Fokus auf die Erziehungsbedürftigkeit und Erziehbarkeit des Menschen im Rahmen der Anlage-Umwelt-Problematik. Die Arbeit behandelt die Bedeutung der Anlage-Umwelt-Debatte für die Erziehung sowie die Frage nach der Planbarkeit von Erziehung.
2. Erziehungsbedürftigkeit und Erziehbarkeit im Spannungsfeld von Anlage, Umwelt und Selbstbestimmung
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Auffassungen von Erziehungsbedürftigkeit und Erziehbarkeit. Es präsentiert unterschiedliche Standpunkte, die von der Ohnmacht oder Allmacht der Erziehung ausgehen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Anlage-Umwelt-Problems und dessen Auswirkungen auf die Erziehbarkeit des Menschen. Der dritte Aspekt des Kapitels befasst sich mit der Frage nach der Planbarkeit von Erziehung und betrachtet verschiedene Theorien zu diesem Thema.
2.1. Erziehungsbedürftigkeit
Der erste Teil des Kapitels definiert den Menschen als „erziehungsbedürftiges Wesen“ und diskutiert die Bedeutung von physiologischen und biologischen Mängeln des Menschen bei der Geburt. Es werden verschiedene Philosophen und ihre Auffassungen zur Erziehungsbedürftigkeit vorgestellt, darunter M.J. Langveld, J.A. Comenius und I. Kant.
2.2. Erziehbarkeit
Der zweite Teil des Kapitels beleuchtet die Frage nach dem Ausmaß der Erziehbarkeit und untersucht die beiden Eckpunkte Anlage und Umwelt. Die beiden gegensätzlichen Auffassungen des pädagogischen Pessimismus und Optimismus werden vorgestellt und mit Beispielen von Philosophen wie Otto F. Bollnow und Arthur Schopenhauer veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die Erziehungsbedürftigkeit und Erziehbarkeit des Menschen im Spannungsfeld von Anlage und Umwelt. Weitere wichtige Themen sind das Anlage-Umwelt-Problem, pädagogischer Pessimismus und Optimismus, Planbarkeit von Erziehung, Umwelteinflüsse und Förderung.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Mensch von Natur aus erziehungsbedürftig?
Ja, die Pädagogik definiert den Menschen als „erziehungsbedürftiges Wesen“, da er im Vergleich zu Tieren mit biologischen Mängeln geboren wird und ohne Erziehung nicht überlebensfähig wäre.
Was bedeutet das Anlage-Umwelt-Problem in der Erziehung?
Es beschreibt die Debatte darüber, wie viel der menschlichen Entwicklung durch die Gene (Anlage) und wie viel durch äußere Einflüsse (Umwelt/Erziehung) bestimmt wird.
Was versteht man unter pädagogischem Optimismus?
Pädagogischer Optimismus ist die Überzeugung, dass der Mensch durch Erziehung fast unbegrenzt formbar ist und Umwelteinflüsse die entscheidende Rolle spielen.
Was ist pädagogischer Pessimismus?
Im Gegensatz dazu geht der pädagogische Pessimismus davon aus, dass die Anlagen eines Kindes so stark dominieren, dass Erziehung nur einen sehr geringen Einfluss auf den Charakter hat.
Ist Erziehung planbar?
Die Arbeit untersucht die Grenzen der Planbarkeit von Erziehung und zeigt auf, dass trotz methodischer Ansätze die Selbstbestimmung des Kindes und unvorhersehbare Umwelteinflüsse eine Rolle spielen.
- Citar trabajo
- Anneke Veltrup (Autor), 2004, Das erziehungsbedürftige Kind - ein unbeschriebens Blatt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36520