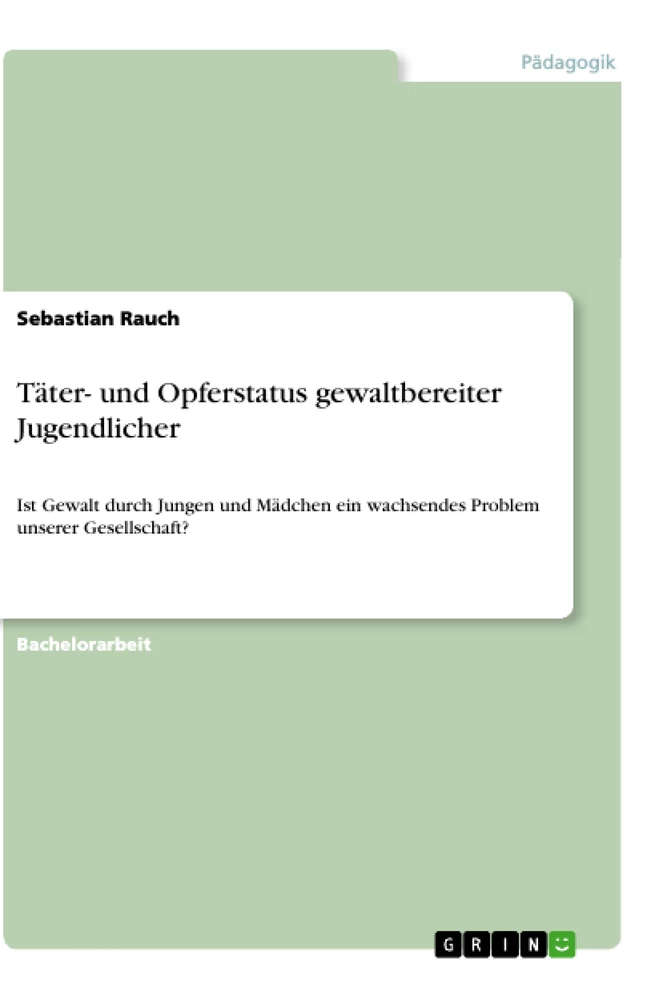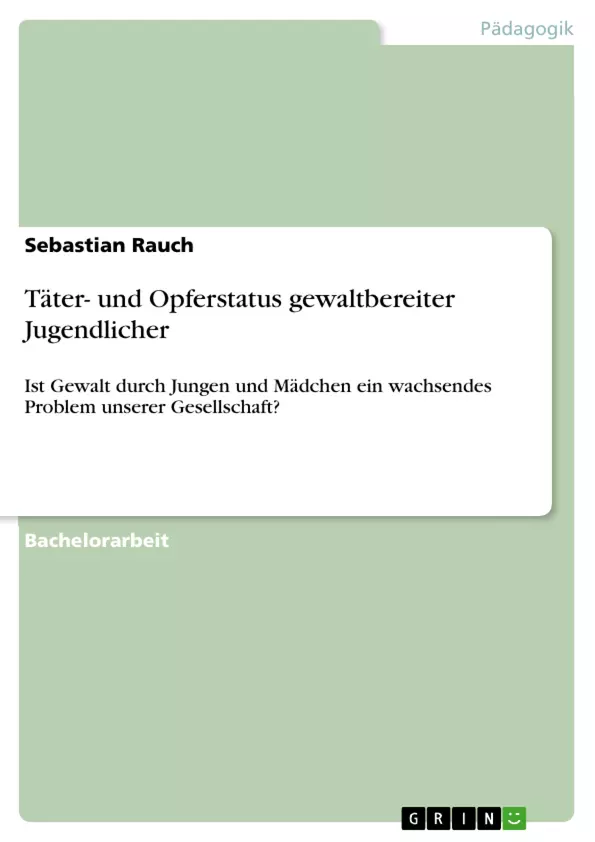Innerhalb dieser Arbeit soll die Frage nach der wahrnehmungsbedingten Täter- und/oder Opferseite gewaltbereiter Jungen und Mädchen geklärt werden. Als Ergebnis soll also herauskristallisiert werden, ob und in welche Richtung sich die pädagogische Aufmerksamkeit vermehrt lenken muss, damit diesen Gewaltphänomenen in adäquater Weise entgegengetreten werden kann.
Zu diesem Zweck werden zunächst Fragestellungen aus essentiellen Gebieten der Gewaltforschung ins Blickfeld genommen, wobei untersucht wird, wie aggressive Jungen und Mädchen selbst Opfer ihrer Sozialisation bzw. von Gewalt werden, indem soziale Faktoren in Hinsicht auf die Entstehung von Gewalt thematisiert werden.
Seit gut zwei Jahrzehnten häufen sich Medienberichte über offensiv gewalttätige Kinder und Jugendliche, in denen immer wieder Fälle massiver Gewalt an Schulen sowie im öffentlichen Raum ein lautes Echo finden. Während in der Vergangenheit Beleidigungen und körperliche Auseinandersetzungen Heranwachsender noch scheinbar harmlos und selten waren, so sollen sich junge Menschen heute immer häufiger ihrer verbalen und vor allem physischen Stärke bewusst sein und Gewalt zunehmend brutaler, erbarmungs- und bedenkenloser gegenüber Mitmenschen ausüben.
Beispielsweise titelte der Stern schon im Jahr 2004 „Werden Schüler immer brutaler? Mitschüler werden brutal verprügelt, andere psychisch drangsaliert, zuweilen auch von Gruppen und systematisch. Wird die Schule vom Lernort immer mehr zum Tatort?“. 2009 hieß es ebenfalls im Stern „Sie prügeln wahllos Passanten zusammen, schlagen und treten auf ihre Opfer ein, wenn diese schon am Boden liegen: Kinder und Jugendliche ohne Mitleid”. Insbesondere soll die Anzahl der von jungen Frauen verübten Gewalttaten immer mehr zunehmen: So konnte man 2008 im Focus lesen „‚Da habe ich rotgesehen‛ – Schlagen, treten, niedermachen – die wachsende Gewaltbereitschaft junger Frauen beschäftigt Polizei und Psychologen“. Orientiert man sich an dieser Gewaltpräsenz in den Medien, so scheint es an der Zeit, dass im Deutschen ein neues Wort gebräuchlich wird: die Macha, als das weibliche Gegenstück zum Macho. Denn wenn junge Frauen früher noch bei Gefahr mit dem großen Bruder drohen mussten, schlagen sie laut medialer Aufarbeitung immer öfter selbst zu. Letztendlich wird in den täglich auf uns einwirkenden Berichterstattungen festgestellt, dass eine stark ansteigende Anzahl der Gewalttäter/innen in und außerhalb der Schule auszumachen sei.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Zum Gewaltbegriff
- A: Gewaltbereite Jungen und Mädchen als Täter und Opfer
- 1 Soziale Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Gewalt bei Jungen und Mädchen
- 1.1 Die Familie
- 1.2 Die Schule
- 2 Typische Jungengewalt und typische Mädchengewalt?
- 3 Jungen- und Mädchengewalt im Laufe der Zeit
- 3.1 Die Polizeiliche Kriminalstatistik der letzten zwei Jahrzehnte
- 3.1.1 Allgemeine Gewaltdelikte
- 3.1.2 Körperverletzungsdelikte
- 3.2 Einschätzung der Jungen- und Mädchengewalt der letzten zwei Jahrzehnte
- 3.1 Die Polizeiliche Kriminalstatistik der letzten zwei Jahrzehnte
- 1 Soziale Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Gewalt bei Jungen und Mädchen
- B: Gewaltwahrnehmung und -beobachtung in der Schule
- 4 Gewalt in der Schule
- 4.1 Bochumer Untersuchung zur Gewaltwahrnehmung innerhalb der Schule
- 4.2 Daten des Bundesverbandes der Unfallkassen in Deutschland zur körperlichen Gewalt mit Verletzungsfolgen an deutschen Schulen (2003)
- 5 Ethnographische Forschung in der Schule
- 5.1 Beobachtungsort: Die Heiligenwegschule Osnabrück
- 5.2 Beobachtung vom 29.09.2011 - Gewaltverhalten unter Schülern
- 5.2.1 Beobachtete Rahmenbedingungen
- 5.2.2 Beobachteter Vorfall
- 5.3 Hypothese
- 5.3.1 Begriffserklärung zur Hypothese
- 5.3.2 Hypothesen-/Beobachtungsanalyse
- 4 Gewalt in der Schule
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob und in welcher Weise Gewalt durch Jungen und Mädchen als Ausdruck einer zunehmenden Täter- oder Opferrolle verstanden werden kann. Das Ziel der Arbeit ist es, die gewaltbezogenen Verhaltensmuster von Jungen und Mädchen zu analysieren und die pädagogische Aufmerksamkeit auf die Bereiche zu lenken, die für eine effektive Präventionsarbeit relevant sind.
- Soziale Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Gewalt bei Jungen und Mädchen
- Geschlechtsspezifische Ausprägungen von Gewaltformen
- Gewaltstatistiken und deren Interpretation hinsichtlich der Geschlechter
- Gewaltwahrnehmung und -beobachtung in der Schule
- Pädagogisches Handeln im Kontext von Gewalt an Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Das Vorwort beleuchtet den aktuellen Diskurs über steigende Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen und stellt die Frage, ob und wie sich diese Entwicklung geschlechtsspezifisch manifestiert. Die Arbeit zielt darauf ab, die Täter- und Opferrolle von Jungen und Mädchen im Zusammenhang mit Gewalt zu analysieren und die Notwendigkeit pädagogischer Interventionen zu beleuchten.
- Zum Gewaltbegriff: Dieses Kapitel befasst sich mit der Klärung der Begriffe „Gewalt“ und „Aggression“. Es werden unterschiedliche Erklärungsversuche und Definitionen beleuchtet, um ein präzises Verständnis dieser zentralen Konzepte zu gewährleisten.
- A: Gewaltbereite Jungen und Mädchen als Täter und Opfer: Dieser Abschnitt untersucht die sozialen Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Gewalt bei Jungen und Mädchen. Die Familie und die Schule werden als zentrale Sozialisationsinstanzen betrachtet, die maßgeblich die Entwicklung von Gewaltbereitschaft beeinflussen.
- 1 Soziale Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Gewalt bei Jungen und Mädchen: Das Kapitel analysiert die Rolle der Familie und der Schule bei der Entwicklung von Gewaltbereitschaft bei Jungen und Mädchen.
- 2 Typische Jungengewalt und typische Mädchengewalt?: Dieses Kapitel geht der Frage nach, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede in den Auslösern, Motiven und Formen von Gewalt gibt. Es wird untersucht, ob diese Unterschiede auf eine genderheterogene oder -homogene Entwicklung hindeuten.
- 3 Jungen- und Mädchengewalt im Laufe der Zeit: Das Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Gewaltbereitschaft bei Jungen und Mädchen im Laufe der Zeit. Es werden die Ergebnisse der Polizeilichen Kriminalstatistik der letzten zwei Jahrzehnte analysiert, um das Ausmaß und die Trends von gewaltbereitem Verhalten beider Geschlechter zu beleuchten.
- B: Gewaltwahrnehmung und -beobachtung in der Schule: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Wahrnehmung von Gewalt in der Schule und untersucht die Rolle des Pädagogen/der Pädagogin in diesem Kontext.
- 4 Gewalt in der Schule: Dieses Kapitel präsentiert Ergebnisse aus verschiedenen Studien zur Gewaltwahrnehmung in der Schule, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
- 5 Ethnographische Forschung in der Schule: Dieses Kapitel beschreibt eine beobachtungsbasierte Untersuchung in einer Schule, um Einblicke in die Dynamik von Gewalt zwischen Schülern zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert zentrale Fragen der Gewaltforschung und der Pädagogik. Schwerpunkte liegen auf den Begriffen Gewalt und Aggression, den Sozialisationsinstanzen Familie und Schule, geschlechtsspezifischen Ausprägungen von Gewaltformen, Polizeiliche Kriminalstatistik, Gewaltwahrnehmung in der Schule und pädagogischem Handeln im Kontext von Gewalt.
Häufig gestellte Fragen
Sind gewaltbereite Jugendliche Täter oder Opfer?
Die Arbeit untersucht, wie aggressive Jugendliche oft selbst Opfer ihrer Sozialisation oder erfahrener Gewalt sind, bevor sie zu Tätern werden.
Gibt es Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchengewalt?
Ja, die Arbeit analysiert geschlechtsspezifische Ausprägungen und Motive sowie die mediale Wahrnehmung der zunehmenden Gewaltbereitschaft junger Frauen („Macha“).
Welche sozialen Faktoren fördern Gewaltbereitschaft?
Besonders die Familie und die Schule werden als zentrale Sozialisationsinstanzen identifiziert, die maßgeblich zur Entstehung von Gewalt beitragen können.
Wie wird Gewalt in der Schule wahrgenommen?
Die Arbeit nutzt ethnographische Forschung und Studien (z.B. Bochumer Untersuchung), um die Diskrepanz zwischen realem Vorfall und pädagogischer Beobachtung zu zeigen.
Was sagt die Polizeiliche Kriminalstatistik über die Trends aus?
Es werden Daten der letzten zwei Jahrzehnte zu allgemeinen Gewaltdelikten und Körperverletzungen analysiert, um die reale Entwicklung der Jugendkriminalität zu bewerten.
- Quote paper
- Sebastian Rauch (Author), 2011, Täter- und Opferstatus gewaltbereiter Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365316