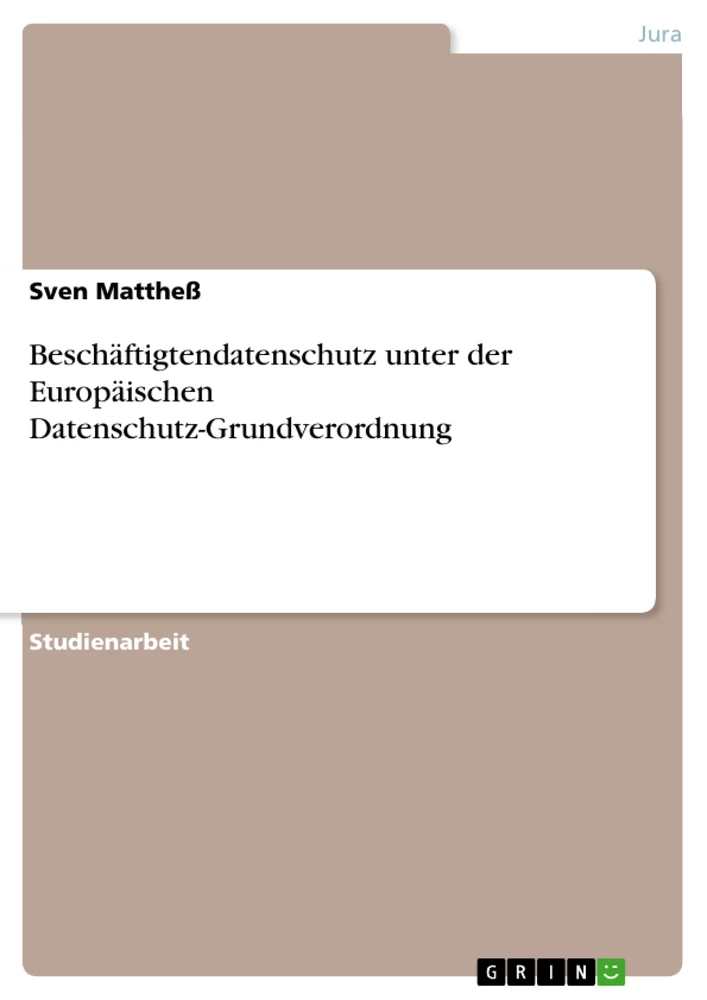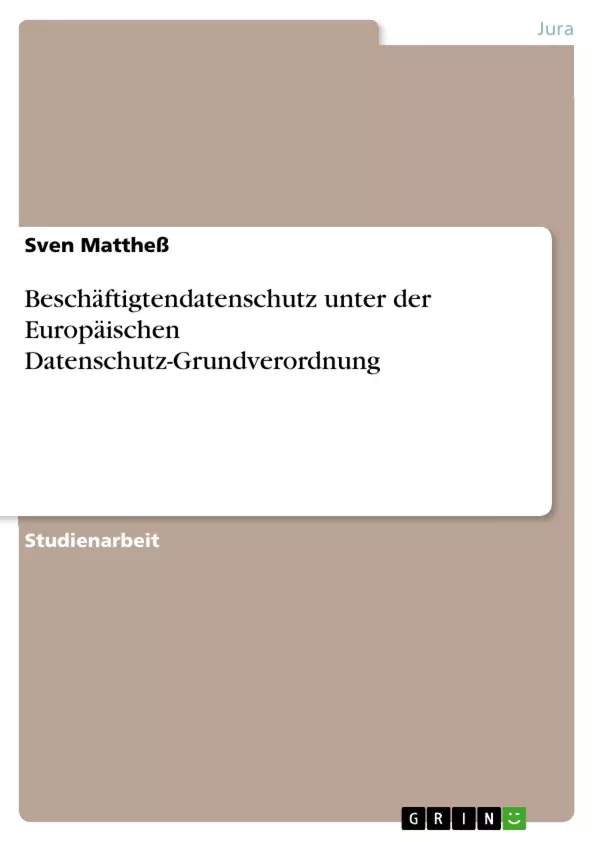Ein Leben ohne die Herausgabe von Daten und deren Verarbeitung scheint im 21. Jahrhundert mittlerweile zum Alltag zu gehören. Dabei sind die dafür benötigten gesetzlichen Regelungen erst knapp 50 Jahre alt. Das erste Datenschutzgesetz der Welt, ist aus Hessen (HDSG) von 1970. Dem folgte das Landesdatenschutzgesetz von der Rheinland - Pfalz von 1974 bis schließlich das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 1977 verkündet wurde und 1979 in Kraft getreten ist, was zunächst inhaltlich hinter dem HDSG zurückblieb.
Nach weiteren Reformen des BDSG und den ersten Versuchen einer europäischen Vereinheitlichung, die kurz im Kapitel 2 beschrieben werden, soll es im Kapital 3 um die DS-GVO der Europäische Union (EU) gehen. Daran anschließend beschäftigt sich das Kapitel 4 mit dem Beschäftigtendatenschutz unter der EU-DS-GVO und endet mit einem kleinen Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des (Beschäftigten-) Datenschutzes mit dem BDSG
- Novellierung von 1991
- Europäische Vereinheitlichung von 2001
- Entbürokratisierung von 2006
- Kunden- und Beschäftigtendatenschutz von 2009.
- Entwurf zum Beschäftigtendatenschutzgesetz von 2010
- Datenschutz - Grundverordnung (DS-GVO) und Beschäftigtendatenschutz?
- Entstehung der DS-GVO.
- Kritik zum Beschäftigtendatenschutz Art. 88 DS-GVO
- Beschäftigtendatenschutz unter der DS-GVO in Deutschland
- Vorgaben für den Beschäftigtendatenschutz von der DS-GVO.
- Erste Entwürfe vom neuen BDSG nach der DS-GVO
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Thema Beschäftigtendatenschutz im Kontext der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Datenschutzes in Deutschland im Hinblick auf Beschäftigte zu beleuchten, die Auswirkungen der DS-GVO auf diesen Bereich zu analysieren und die Herausforderungen für den Beschäftigtendatenschutz in Deutschland zu erörtern.
- Die Entwicklung des Datenschutzes in Deutschland mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- Die Einführung und Bedeutung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für den Beschäftigtendatenschutz
- Die Herausforderungen und Perspektiven für den Beschäftigtendatenschutz in Deutschland unter der DS-GVO
- Die Bedeutung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen für Unternehmen und Arbeitnehmer
- Die Rolle von Datenschutzbeauftragten und Aufsichtsbehörden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Beschäftigtendatenschutz und beleuchtet die historische Entwicklung des Datenschutzes in Deutschland. Anschließend werden die einzelnen Novellierungen des BDSG von 1991, 2001, 2006 und 2009 betrachtet, die den Datenschutz in Deutschland immer wieder angepasst haben. Die Bedeutung der EU-Richtlinie 95/46/EG, die bis zum Inkrafttreten der DS-GVO maßgeblich war, wird ebenfalls erörtert. Danach wird die Entstehung der DS-GVO beleuchtet und die Kritik am Artikel 88 DS-GVO, der sich mit dem Beschäftigtendatenschutz befasst, untersucht. Abschließend wird der Beschäftigtendatenschutz unter der DS-GVO in Deutschland betrachtet und erste Entwürfe für ein neues BDSG nach der DS-GVO vorgestellt.
Schlüsselwörter
Beschäftigtendatenschutz, Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Arbeitnehmerdatenschutz, Datenschutzrecht, Informationelle Selbstbestimmung, Europäische Union, Datenschutzbeauftragter, Aufsichtsbehörde, Datenverarbeitung, Datenübermittlung, Rechtssicherheit, Transparenz, Verantwortlichkeit, Einwilligung, Recht auf Vergessenwerden, Datenminimierung, Zweckbindung.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde das erste Datenschutzgesetz eingeführt?
Das weltweit erste Datenschutzgesetz wurde 1970 in Hessen (HDSG) verabschiedet, gefolgt vom ersten Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) im Jahr 1977.
Was regelt Artikel 88 der DS-GVO?
Artikel 88 der Datenschutz-Grundverordnung befasst sich spezifisch mit dem Beschäftigtendatenschutz und erlaubt den Mitgliedstaaten, durch Rechtsvorschriften oder Kollektivvereinbarungen spezifischere Regeln zur Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext festzulegen.
Warum ist der Beschäftigtendatenschutz für Unternehmen wichtig?
Er gewährleistet Rechtssicherheit, Transparenz und den Schutz der informationellen Selbstbestimmung der Arbeitnehmer, während er gleichzeitig klare Regeln für die Datenverarbeitung durch den Arbeitgeber vorgibt.
Welche Grundsätze gelten für die Datenverarbeitung unter der DS-GVO?
Zu den Kernprinzipien gehören Datenminimierung, Zweckbindung, Transparenz, Verantwortlichkeit und die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung.
Was ist die Rolle eines Datenschutzbeauftragten?
Der Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der Datenschutzvorschriften im Unternehmen, berät die Verantwortlichen und dient als Kontaktperson für Betroffene und Aufsichtsbehörden.
- Arbeit zitieren
- Sven Mattheß (Autor:in), 2017, Beschäftigtendatenschutz unter der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365324