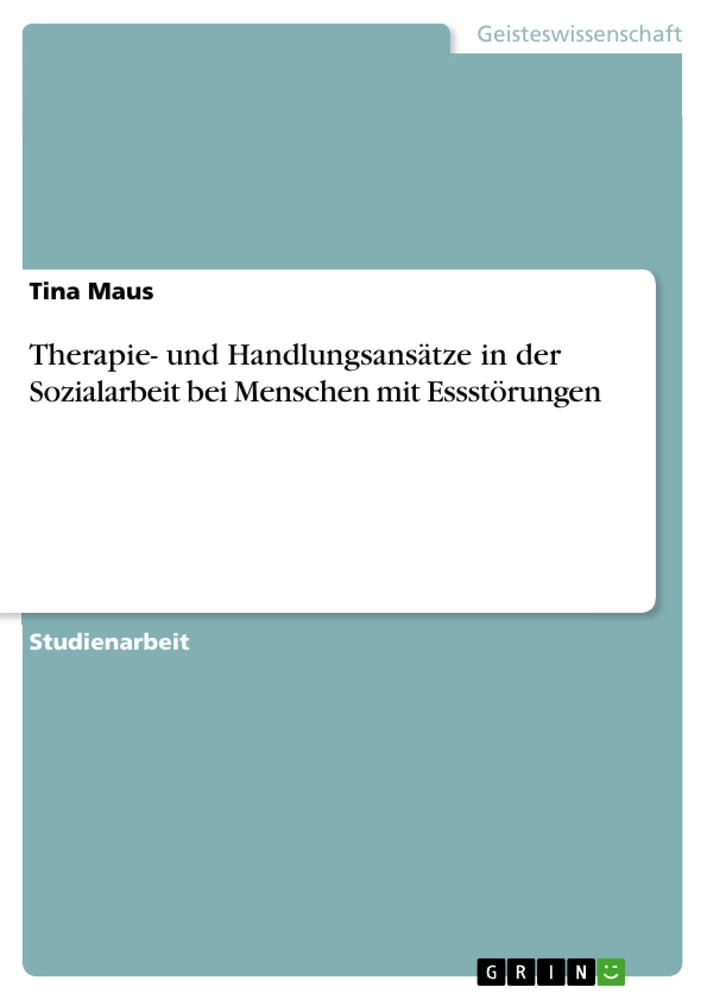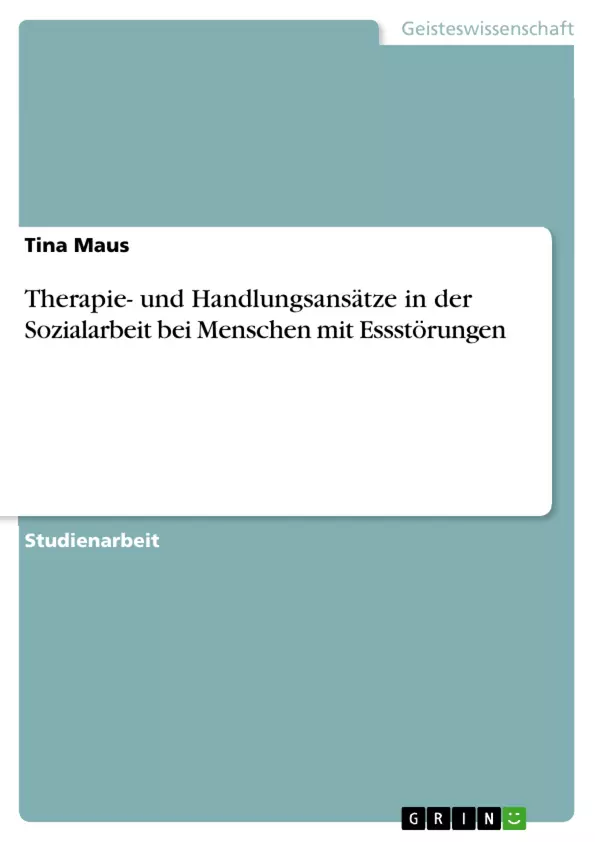Unzufriedenheit mit der Figur und dem Gewicht ist bereits ab der Pubertät vor allem bei Frauen ein weit verbreitetes Phänomen und das öffentliche Interesse am Thema Essstörungen ist ungebrochen. Dies mag auch daran liegen, dass die Nahrungsaufnahme, das Essen, einerseits zu den Grundbedürfnissen der Menschen gehört, andererseits aber auch im Falle einer Essstörung schwerwiegende gesundheitliche, teils sogar tödliche, Folgen haben kann.
In unserer westlichen Gesellschaft werden Menschen zunehmend nach ihrer äußeren Erscheinung bewertet und das Selbstwertgefühl der von Essstörungen Betroffenen orientiert sich vornehmlich an einem möglichst attraktiven Körper. Jede Abweichung des Körpergewichts nach oben ist geeignet, tiefe Selbstzweifel auszulösen. „Die Tatsache, dass Essstörungen vorrangig Frauen betreffen, führt zu einer kritischen Betrachtung der Rollenvorstellungen, mit denen Frauen konfrontiert werden.“ (Cuntz et al. 2015).
Zwei Drittel der Frauen im Jugend- und Erwachsenenalter neigen daher dazu Maßnahmen zur Gewichtsregulation, wie zum Beispiel chronische Diäten, durchzuführen. „Die Kombination von einem gestörten Körperbild und Diätverhalten führt nicht selten zu einer manifesten Essstörung mit anorektischen und / oder bulimischen Symptomen […]“ (Brunner und Resch 2008). Die ansteigende Zahl anorektischer und bulimischer Mädchen und auch junger Frauen oder Adipöse männlichen und weiblichen Geschlechts ist erschreckend. Es sind mittlerweile vielerorts Beratungsstellen und Therapiezentren entstanden, die sich ausschließlich mit diesen Krankheitsbildern beschäftigen. "Essstörungen haben vielfältige Bezüge zu Substanzmissbrauch und Sucht." (Thomasius & Küstner 2005). Insbesondere bei der Bulimie findet sich eine relativ hohe Komorbidität zum Substanzmissbrauch sowohl in den Familien als auch bei den betroffenen Patientinnen selbst. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Psychische Störungsbilder
2.1. Grundlagen von Essstörungen
2.2. Anorexia nervosa
2.3. Bulimia nervosa
3. Therapieansätze
4. Handlungsansätze für Sozialarbeiter
5. Konsequenzen für Sozialarbeiter/innen in der Therapie mit essgestörten Menschen
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Arten von Essstörungen werden unterschieden?
Die Arbeit behandelt primär die Anorexia nervosa (Magersucht), Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht) und die Adipositas.
Welche Rolle spielt die Sozialarbeit bei Essstörungen?
Sozialarbeiter unterstützen Betroffene durch Beratung, Begleitung in Therapiezentren und die Bearbeitung sozialer Ursachen oder Folgen der Erkrankung.
Warum sind besonders Frauen von Essstörungen betroffen?
Dies wird oft auf gesellschaftliche Rollenvorstellungen und Schönheitsideale zurückgeführt, die einen attraktiven, schlanken Körper mit Selbstwertgefühl verknüpfen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Essstörungen und Sucht?
Ja, insbesondere bei der Bulimie gibt es eine hohe Komorbidität zu Substanzmissbrauch und anderen Suchterkrankungen.
Welche gesundheitlichen Folgen können Essstörungen haben?
Die Folgen reichen von Mangelernährung und Organschäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen und tödlichem Ausgang.
- Citation du texte
- Tina Maus (Auteur), 2017, Therapie- und Handlungsansätze in der Sozialarbeit bei Menschen mit Essstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365662