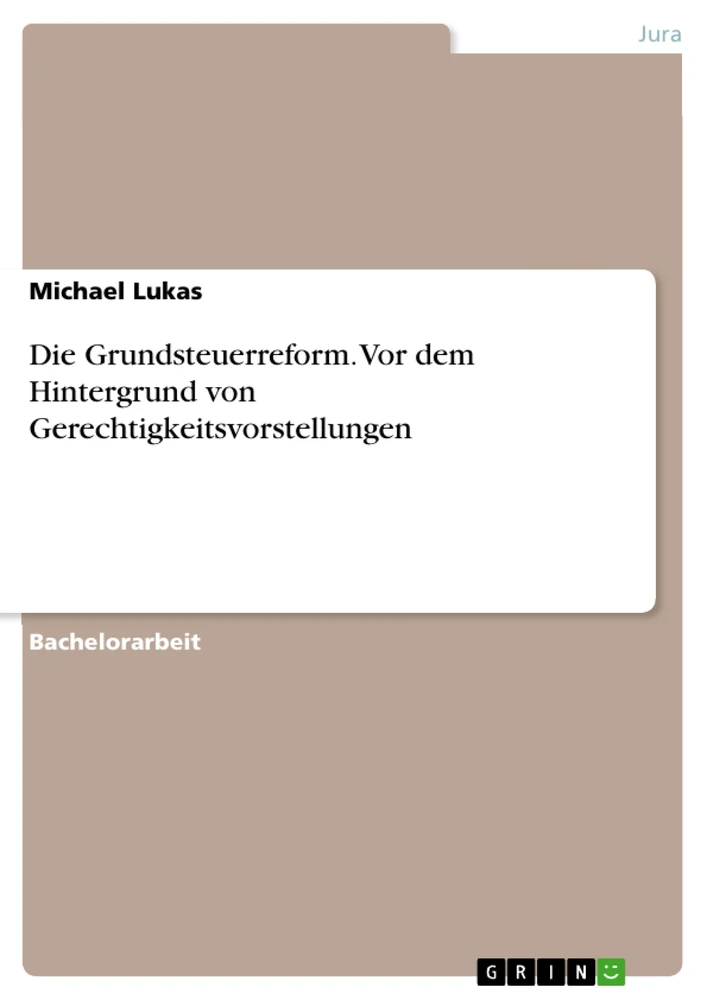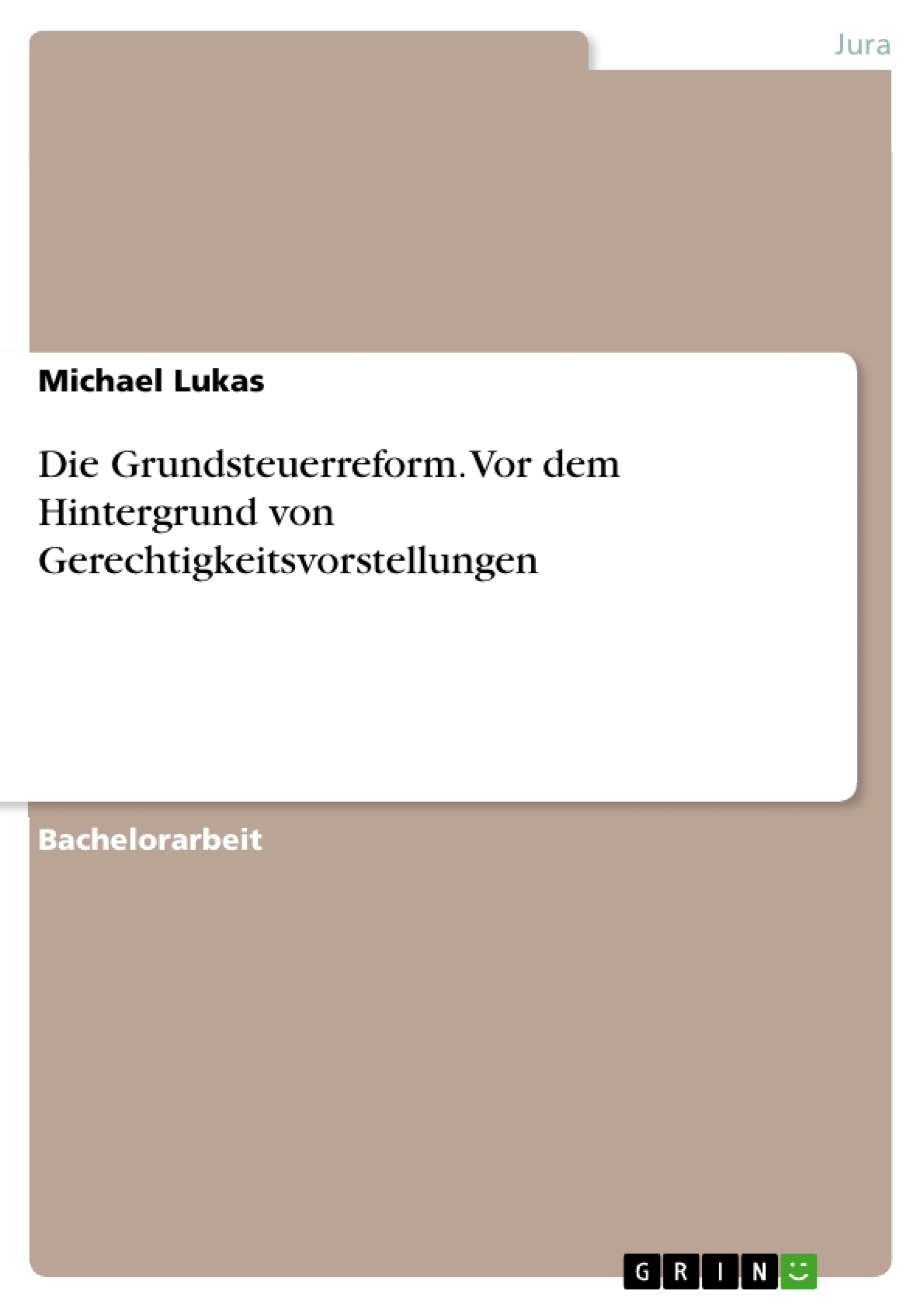Die Ansprüche könnten höher nicht sein: fair, einfach, akzeptabel, zeitgemäß und natürlich gerecht. Dies sind nur einige, wenige Forderungen, die verschiedene Akteure an eine Reform der Grundsteuer stellen.
Wenn sich im Laufe des Jahres 2017 die obersten Hüter der deutschen Verfassung in Karlsruhe zum Spruch erheben werden, steht für den hiesigen Fiskus Einiges auf dem Spiel.
Denn seit Jahrzehnten wird zwar Land auf, Land ab viel diskutiert und geforscht. Reformanträge wurden geschrieben und wieder verworfen; Fensterreden, von Volksvertretern aller politischer Couleur, gehalten.
Doch geschehen ist bisher – nichts!
In einem sind sich alle Akteure jedoch einig: Die Grundsteuer ist dringend reformbedürftig und weist erhebliche Mängel auf.
Zu Kritik veranlasst die Verwendung von veralteten Einheitswerten als Bemessungsgrundlage. Diese geht in den „alten“ Bundesländern auf den 1.Januar 1935 und in den „neuen“ Bundesländern auf den 1.Januar 1964 zurück.
Bereits 2010 hat der Bundesfinanzhof in München erhebliche Zweifel an einer Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer geäußert und nun dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Dies erzeugte Druck auf die aktuelle Bundesregierung, weshalb man eine Grundsteuerreform anstieß, die nun überraschend, möglicherweise aufgrund der nahenden Bundestagswahl in diesem Herbst, „auf Eis gelegt“ wurde. Über die wahren Gründe schweigt die Bundesregierung bisweilen.
In meiner Arbeit werden unterschiedliche, aktuell diskutierte, Reformansätze untersucht und in ein Verhältnis zur Gerechtigkeit gestellt. Hierzu ist zunächst erforderlich, dass verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen beschrieben werden. Danach werde ich das aktuelle Grundsteuersystem darstellen und sodann in die Diskussion von Reformvorschlägen einsteigen.
Eines scheint jedoch den Verfassern von fast allen Reformansätzen klar zu sein. Effizienz und Gerechtigkeit kann nicht gleichzeitig gelingen. Oder doch?
Eine Besteuerung nach dem Bodenwert, welcher in der Orthodoxie (leider) keine große Rolle zu spielen vermag, könnte den gordischen Knoten lösen; und - basierend auf Mason Gaffneys´ Philosophie - beweisen, dass beides, Effizienz und Gerechtigkeit, doch gleichzeitig möglich sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemstellung
- II. Lösungsansätze
- B. Was ist Gerechtigkeit?
- I. Ansätze nach Platon und Aristoteles
- 1. Ansatz nach Platon
- 2. Ansatz nach Aristoteles
- II. Ansatz nach Immanuel Kant
- III. Ansatz nach John Rawls
- IV. Ansatz nach Mason Gaffney
- C. Rechtfertigung einer Grundsteuer
- I. Allgemeiner Charakter der Steuer
- II. Rechtfertigung der Steuer
- D. Grundlagen aktuellen Rechts (Stand: März 2017)
- I. Steuerobjekt
- II. Bewertungsverfahren
- III. Steuerbefreiungen
- IV. Steuersubjekt
- V. Steuermessbetrag
- 1. Bemessungsgrundlage
- 2. Steuermesszahl
- VI. Hebesatzrecht
- VII. Besteuerungsverfahren
- VIII. Kritik
- E. Reformmodelle
- I. Nord-Modell
- 1. Charakter des Modells
- 2. Subsumtion der Gerechtigkeitsvorstellungen
- II. Süd-Modell
- 1. Charakter des Modells
- 2. Subsumtion der Gerechtigkeitsvorstellungen
- III. Kombinationsmodell
- 1. Charakter des Modells
- 2. Subsumtion der Gerechtigkeitsvorstellungen
- IV. Bundesratsmodell
- 1. Charakter des Modells
- 2. Subsumtion der Gerechtigkeitsvorstellungen
- F. Bodenwertmodell
- I. Der Boden als Lebensgrundlage
- 1. „Die Erde ist des Herrn“
- 2. „Der Boden als soziale Hypothek“
- II. Charakter des Modells
- III. Subsumtion der Gerechtigkeitsvorstellungen nach Gaffney und Konklusion
- G. Gesamtfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht verschiedene Reformansätze für die Grundsteuer und setzt diese in Bezug zu unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen. Das Ziel ist es, die verschiedenen Konzepte zu analysieren und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Dabei wird auch die Frage nach der Vereinbarkeit von Effizienz und Gerechtigkeit in der Grundsteuerreform beleuchtet.
- Gerechtigkeitsvorstellungen in der Grundsteuerreform
- Analyse verschiedener Reformmodelle
- Bewertung der aktuellen Grundsteuer
- Das Konzept des Bodenwerts und seine Rolle in der Gerechtigkeitsdebatte
- Effizienz und Gerechtigkeit in der Grundsteuerreform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung der Grundsteuerreform erläutert und die Notwendigkeit einer Reform dargelegt wird. Kapitel B beleuchtet verschiedene Ansätze zur Gerechtigkeit, um einen theoretischen Rahmen für die Analyse der Grundsteuerreform zu schaffen. Kapitel C beschäftigt sich mit der Rechtfertigung einer Grundsteuer im Allgemeinen und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit der Besteuerung von Grundbesitz stellen.
Kapitel D präsentiert die Grundlagen des aktuellen Grundsteuerrechts in Deutschland. Es werden die Steuerobjekte, Bewertungsverfahren, Steuerbefreiungen, das Steuersubjekt, der Steuermessbetrag sowie das Hebesatzrecht und das Besteuerungsverfahren detailliert erläutert. Kapitel E stellt verschiedene Reformmodelle vor, die in der öffentlichen Debatte diskutiert werden, und analysiert deren Charakter sowie deren Subsumtion der Gerechtigkeitsvorstellungen.
Kapitel F befasst sich mit dem Konzept des Bodenwertmodells, das als Alternative zu den bestehenden Modellen diskutiert wird. Es wird die Bedeutung des Bodens als Lebensgrundlage beleuchtet und der Charakter des Modells sowie dessen Subsumtion der Gerechtigkeitsvorstellungen nach Gaffney erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Grundsteuerreform, Gerechtigkeitsvorstellungen, Reformmodelle, Bodenwertmodell, Effizienz, Gerechtigkeit, Steuerobjekt, Bewertung, Steuerbefreiungen, Steuersubjekt, Steuermessbetrag, Hebesatzrecht, Besteuerungsverfahren, Kritik, Mason Gaffney, Platon, Aristoteles, Immanuel Kant, John Rawls, Grundgesetz, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, Bewertungsgesetz.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die aktuelle Grundsteuer in Deutschland reformbedürftig?
Die Grundsteuer basiert auf veralteten Einheitswerten (1935 in West-, 1964 in Ostdeutschland), was zu erheblichen Ungerechtigkeiten und verfassungsrechtlichen Zweifeln führt.
Was ist das Bodenwertmodell nach Mason Gaffney?
Dieses Modell besteuert ausschließlich den Wert des Bodens, nicht aber die darauf befindlichen Gebäude, was sowohl effizient als auch sozial gerecht sein soll.
Welche Gerechtigkeitsansätze werden in der Debatte herangezogen?
Die Arbeit analysiert die Reformansätze anhand der Gerechtigkeitstheorien von Platon, Aristoteles, Immanuel Kant und John Rawls.
Was unterscheidet das Nord-Modell vom Süd-Modell?
Die Modelle unterscheiden sich in ihrer Gewichtung von Grundstücksfläche, Gebäudefläche und Lage sowie in der Komplexität der Wertermittlung.
Können Effizienz und Gerechtigkeit gleichzeitig erreicht werden?
Während viele Modelle einen Kompromiss darstellen, argumentiert das Bodenwertmodell, dass durch die richtige Besteuerung beide Ziele gleichzeitig realisierbar sind.
Was ist ein Hebesatzrecht der Kommunen?
Das Hebesatzrecht erlaubt es den Städten und Gemeinden, die endgültige Höhe der Grundsteuer eigenständig festzulegen, um ihren Finanzbedarf zu decken.
- Quote paper
- Michael Lukas (Author), 2017, Die Grundsteuerreform. Vor dem Hintergrund von Gerechtigkeitsvorstellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365997