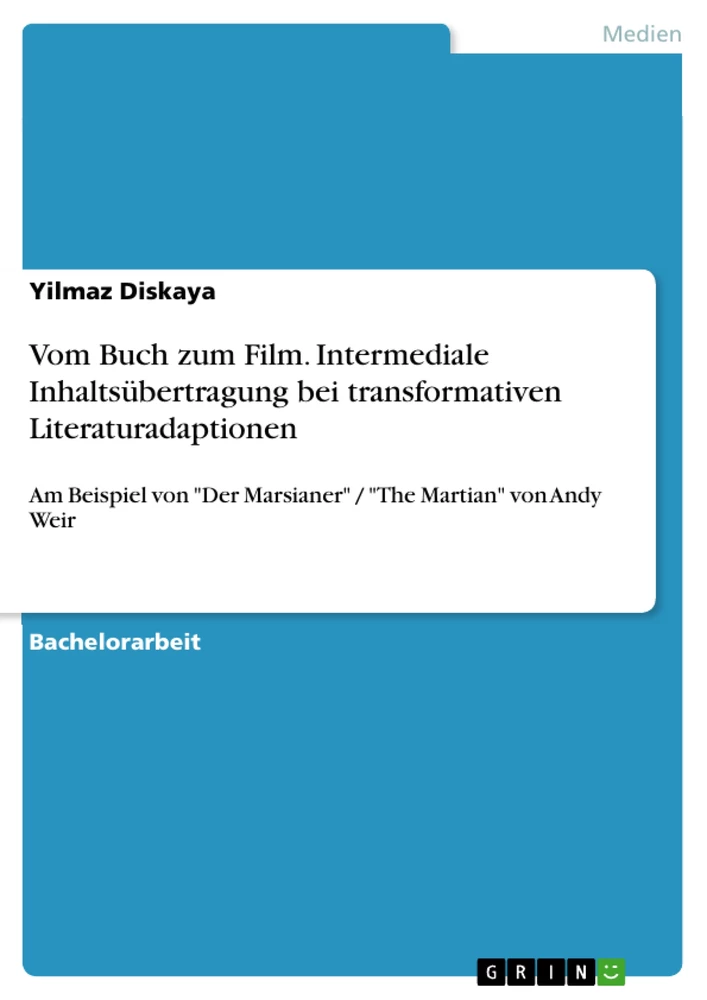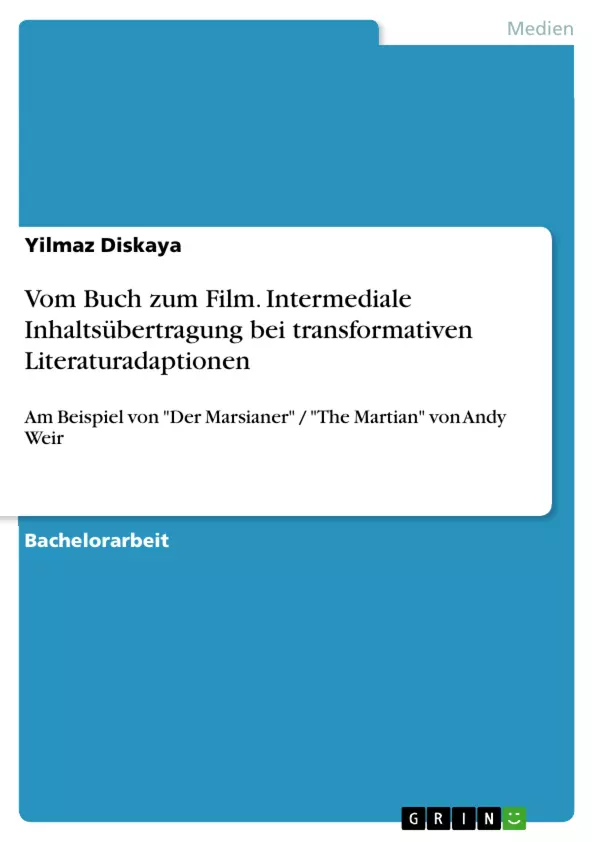"Das Buch ist besser als der Film!" Bei dieser Form von Kritik wird meist nicht berücksichtigt, dass es sich beim Buch und Film um vollkommen unterschiedliche Medien handelt. So werden beim Wechsel vom Ausgangsmedium der Literatur in das Zielmedium des Films mediale Grenzen überschritten. Ein Medienwechsel, der entgegen der medienspezifischen Unterschiede vollzogen wird und zwangsweise eine intermediale Transformation des Inhalts, beziehungsweise ein Wechsel des semiotischen Zeichensystems, erfordert.
Es ist genau dieser offensichtliche Wechsel, der mich im Kontext der vorherrschenden Kritik fragen lässt, in welchen Maßen sich der Inhalt aus der Vorlage unter Berücksichtigung von filmischen Aspekten überhaupt ins Bild übertragen lässt. Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich klären, ob und wie sich der medienspezifisch fixierte Prätext in der literarischen Vorlage im Rahmen einer filmischen Aufbereitung überhaupt in das audiovisuelle Zielmedium transferieren lässt. Hierzu möchte ich mich im theoretischen Teil meiner Arbeit, vor dem Hintergrund der Filmgeschichte, intensiv mit der bisherigen Intermedialitäts- und Adaptionsforschung auseinandersetzen, um so den Prozess des Medienwechsels bei transformativen Literaturverfilmungen genauer zu beleuchten und zudem die grundlegende Adaptionsproblematik näher zu untersuchen.
Neben den hieraus resultierenden Schwierigkeiten für die Umsetzung, möchte ich außerdem auf verschiedene Möglichkeiten zur Problembehandlung eingehen und diese an einem konkreten Beispiel veranschaulichen. So sollen im eher analytisch ausgelegten Teil dieser Arbeit dann anhand des Bestsellers "Der Marsianer" von Andy Weir und seiner gleichnamigen Verfilmung von Ridley Scott inhaltliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lokalisiert werden, um im Zusammenhang meiner Ausführungen exemplarisch zu zeigen, wie diese zustande gekommen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Vorgehensweise
- Ziel
- Die Literaturverfilmung
- Zum Begriff „Adaption“ und „Verfilmung“
- Arten der Adaption
- Aneignung von literarischen Rohstoff
- Illustration
- Interpretierende Transformation
- Dokumentation
- Schwierigkeiten und Adaptionsstrategien
- Literaturverfilmung als intermedialer Adaptionsprozess
- Adaptionsproblematik
- Filmischer Anspruch
- Transformativer Ansatz
- Schwierigkeiten
- Wege zur Problembehandlung
- Filmische Gestaltungsmittel
- Russischer Formalismus
- Codes
- Multimedialität
- Der Marsianer - Bestseller und Publikumserfolg
- Das Buch
- Der Film
- Handlung
- Ein Vergleich zwischen Buch und Verfilmung
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Prozess der Literaturverfilmung und untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der intermedialen Inhaltsübertragung bei transformativen Adaptionen. Die Arbeit widmet sich dem Spannungsfeld zwischen filmischen Ansprüchen und dem Anspruch auf Werktreue gegenüber der literarischen Vorlage.
- Der Begriff „Adaption“ und seine verschiedene Formen im Kontext der Literaturverfilmung
- Die Problematik der intermedialen Transformation und die Schwierigkeiten bei der Übertragung von literarischen Inhalten in das filmische Medium
- Mögliche Adaptionsstrategien und filmische Gestaltungsmittel, die bei der Übertragung von literarischen Inhalten zum Einsatz kommen können
- Ein Vergleich zwischen Buch und Verfilmung anhand des Bestsellers "Der Marsianer", um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Medien exemplarisch aufzuzeigen
- Die Grenzen und Potentiale des Films als Medium für transformative Literaturverfilmungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor, erläutert die Vorgehensweise und das Ziel der Analyse. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Adaption“ im Kontext der Literaturverfilmung definiert und verschiedene Arten der Adaption werden vorgestellt. Kapitel drei befasst sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der Literaturverfilmung als intermedialer Adaptionsprozess. Es werden die Adaptionsproblematik, die Schwierigkeiten der Umsetzung und die möglichen Lösungsansätze beleuchtet. Kapitel vier bietet eine vergleichende Analyse des Romans "Der Marsianer" und seiner Verfilmung, um die Umsetzung der literarischen Vorlage in das filmische Medium zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Literaturverfilmung, Adaption, intermediale Transformation, filmische Gestaltungsmittel, Adaptionsproblematik, Werktreue, "Der Marsianer", Andy Weir, Ridley Scott.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird oft behauptet, das Buch sei besser als der Film?
Diese Kritik ignoriert oft, dass Buch und Film unterschiedliche Zeichensysteme nutzen. Ein Film kann literarische Inhalte nie 1:1 kopieren, sondern muss sie intermedial transformieren.
Welche Arten der Literaturadaption werden unterschieden?
Es gibt verschiedene Formen, wie die bloße Illustration, die interpretierende Transformation, die Dokumentation oder die freie Aneignung von literarischem Rohstoff.
Was sind die größten Schwierigkeiten bei einer Literaturverfilmung?
Die Herausforderung liegt darin, den medienspezifisch fixierten Prätext der Vorlage in das audiovisuelle Medium des Films zu übertragen, ohne den Kern der Geschichte zu verlieren.
Wie wird „Der Marsianer“ als Beispiel in der Arbeit genutzt?
Anhand von Andy Weirs Buch und Ridley Scotts Film werden inhaltliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysiert, um den Prozess des Medienwechsels exemplarisch aufzuzeigen.
Was versteht man unter transformativer Literaturadaption?
Es bezeichnet einen bewussten Prozess der Umgestaltung, bei dem der Inhalt der Vorlage an die ästhetischen und technischen Möglichkeiten des Films angepasst wird.
- Arbeit zitieren
- Yilmaz Diskaya (Autor:in), 2016, Vom Buch zum Film. Intermediale Inhaltsübertragung bei transformativen Literaturadaptionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366090