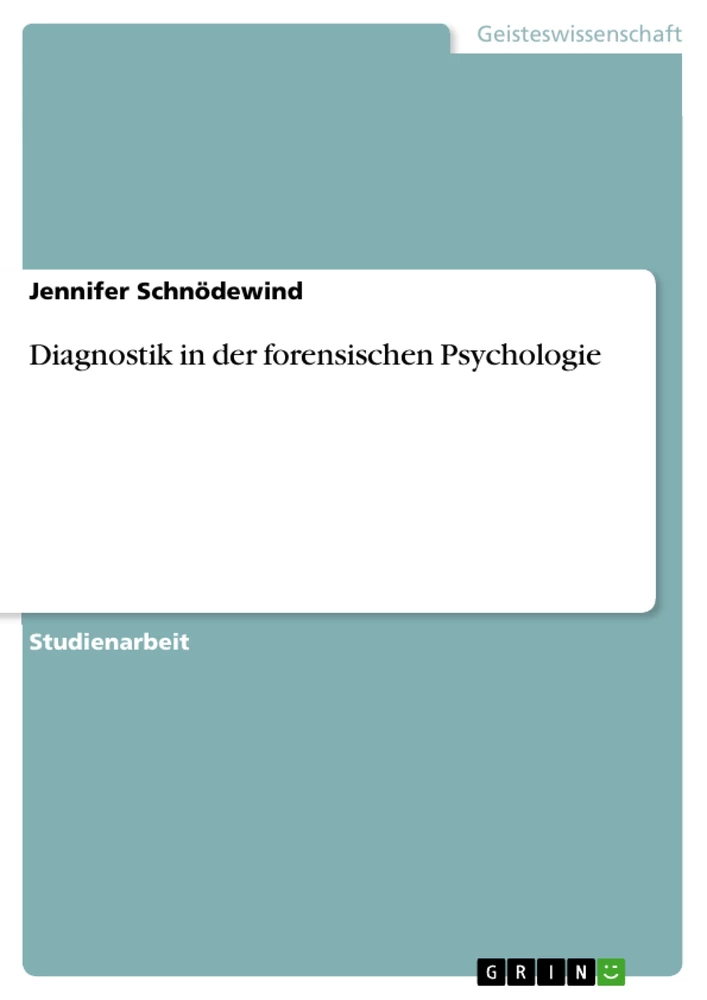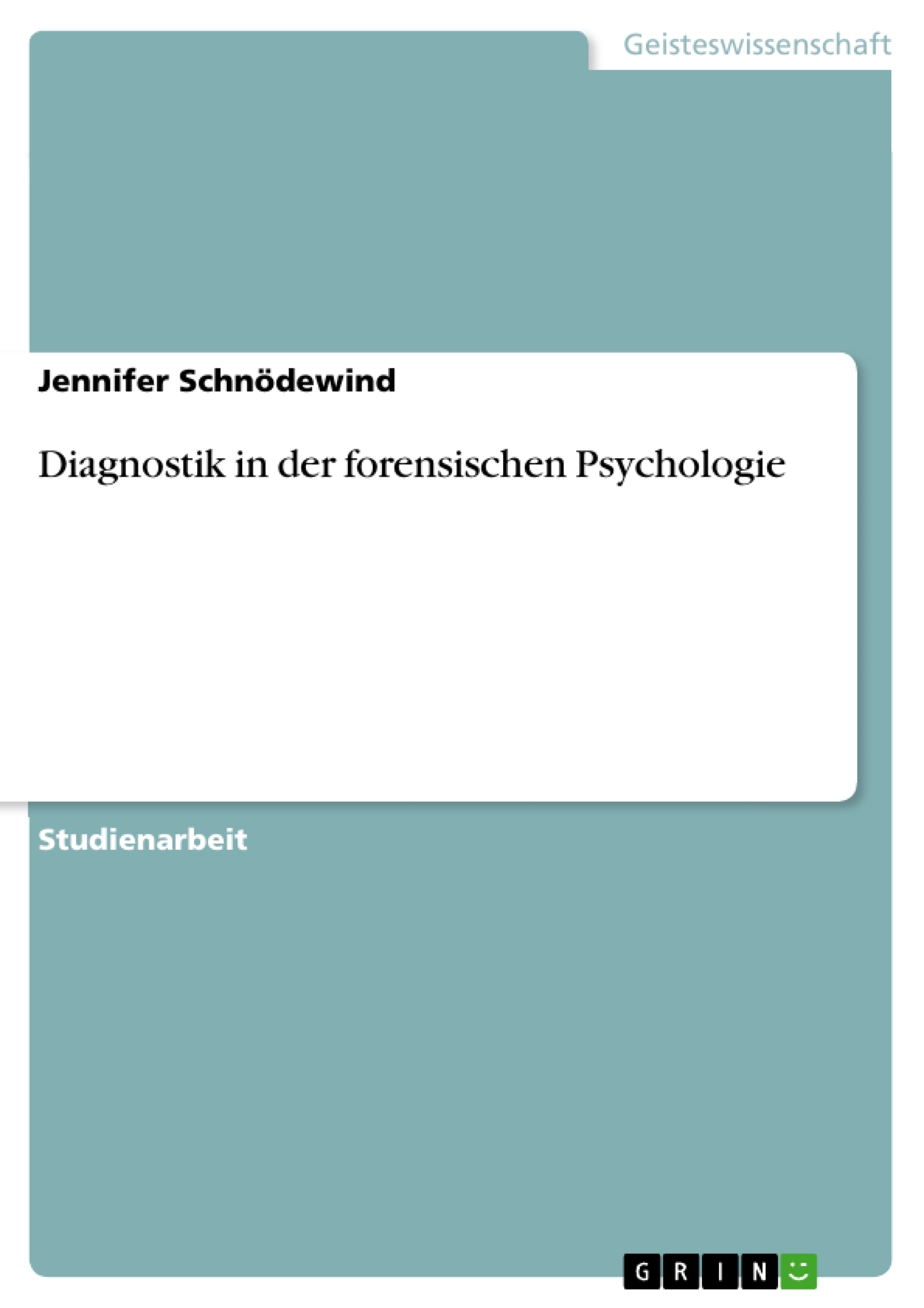Der Begriff „Forensik“ ist in den letzten Jahren immer populärer geworden. Medien berichten nach öffentlichkeitswirksamen Straftaten oft in spektakulärer Form über forensische Untersuchungen und deren Ergebnisse. In Serien wie „Criminal Minds“ werden hochkompetente Ermittler charakterisiert, die an jeglichen Tätigkeiten von der Spurensicherung bis zur Zeugenvernehmung beteiligt sind.
Durch diese Darstellungen entsteht leicht ein unrealistischer Eindruck der rechtspsychologischen Arbeitsfelder. Es wird vermittelt, dass diverse Tätigkeiten durch eine Person erledigt werden. Während in der Realität verschiedenste Fachleute in ihrer jeweiligen Kompetenz erforderlich sind. Auch die psychologische Diagnostik wird in Serien oft durch die generellen Ermittler übernommen. Die Notwendigkeit psychologischer Fachexpertise wird nicht deutlich. Der diagnostische Anteil in der Rechtspsychologie sowie deren Teilgebiet der forensischen Psychologie ist im Vergleich zu anderen psychologischen Arbeitsfeldern hoch.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forensisch-psychologische Diagnostik
- Definition und Abgrenzung
- Anwendungsgebiete
- Aufgaben und Fragestellungen
- Zielsetzungen
- Rechtliche Grundlagen
- Schuldfähigkeit nach §§ 20, 21 StGB
- Maßregeln nach §§ 63, 64, 66 StGB
- Weitere Gesetzmäßigkeiten
- Diagnostische Verfahren in der forensischen Psychologie
- Strafrecht
- Glaubhaftigkeitsbeurteilung
- Verantwortlichkeit von Straftätern
- Kriminalprognose und Vollzugsplanung
- Weitere Rechtsgebiete und deren Verfahren
- Strafrecht
- Praxisreflexion
- Kritische Betrachtung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem umfassenden Feld der forensisch-psychologischen Diagnostik. Ziel ist es, den Umfang und die Vielfältigkeit dieses Arbeitsfeldes in der Praxis aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung forensisch-psychologischer Diagnostik
- Anwendungsgebiete und Fragestellungen im Straf- und Zivilrecht
- Rechtliche Grundlagen und relevante Gesetze
- Diagnostische Verfahren und die Rolle von Sachverständigen
- Praxisbezogene Anwendung der Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Themenfeld der forensisch-psychologischen Diagnostik ein und verdeutlicht die Bedeutung dieses Arbeitsbereichs im Kontext des Rechtswesens.
- Forensisch-psychologische Diagnostik: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Forensik“ und grenzt die forensische Psychologie von der Kriminalpsychologie ab. Zudem werden die Anwendungsgebiete, Aufgaben und Fragestellungen sowie die rechtlichen Grundlagen erläutert.
- Diagnostische Verfahren in der forensischen Psychologie: Hier werden verschiedene diagnostische Verfahren, die in der forensischen Psychologie eingesetzt werden, vorgestellt, insbesondere im Strafrecht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen forensische Psychologie, Gerichtspsychologie, Strafrecht, Diagnostik, Glaubhaftigkeitsbeurteilung, Verantwortlichkeit, Kriminalprognose, Vollzugsplanung, Sachverständige, Gutachten.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet forensische Psychologie von Kriminalpsychologie?
Die forensische Psychologie konzentriert sich auf die psychologische Diagnostik für gerichtliche Verfahren, während Kriminalpsychologie eher Täterverhalten analysiert.
Was ist eine Glaubhaftigkeitsbeurteilung?
Ein Verfahren zur Prüfung, ob eine Aussage (z.B. eines Zeugen) auf realem Erleben basiert oder fiktiv ist.
Welche Rolle spielt die Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 StGB)?
Psychologische Sachverständige prüfen, ob ein Täter zum Tatzeitpunkt aufgrund psychischer Störungen einsichtsfähig oder steuerungsfähig war.
Was versteht man unter Kriminalprognose?
Die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Straftäter in Zukunft erneut Straftaten begehen wird, oft relevant für die Vollzugsplanung.
Sind TV-Serien wie „Criminal Minds“ realistisch?
Nein, sie vermitteln oft ein falsches Bild, da in der Realität verschiedene Fachleute für Spurensicherung, Vernehmung und psychologische Gutachten zuständig sind.
- Quote paper
- Jennifer Schnödewind (Author), 2016, Diagnostik in der forensischen Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366096