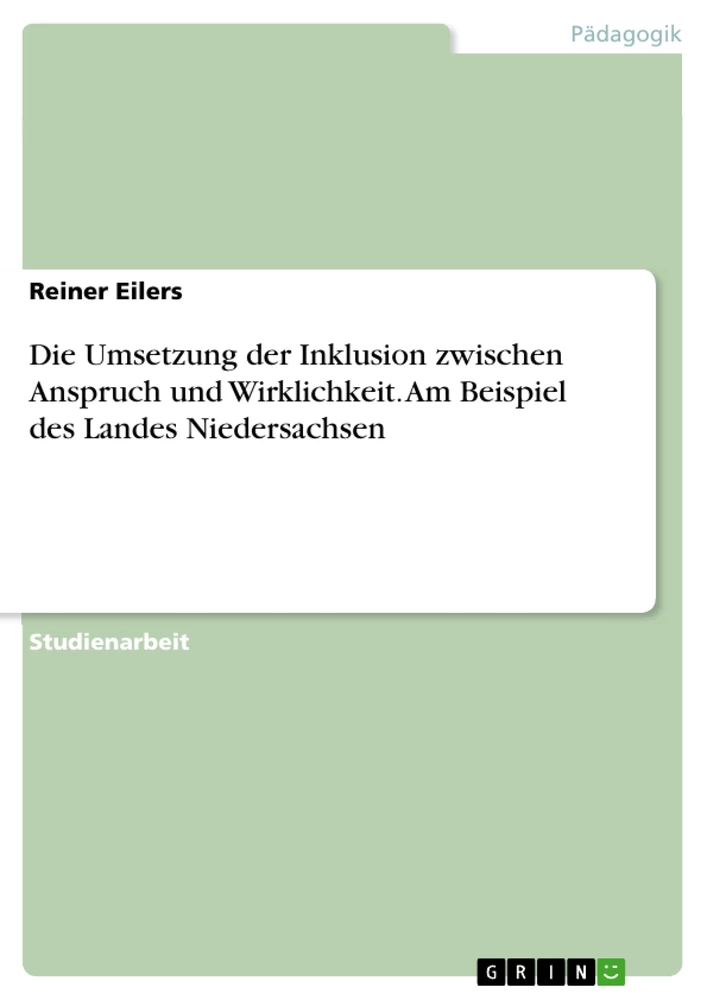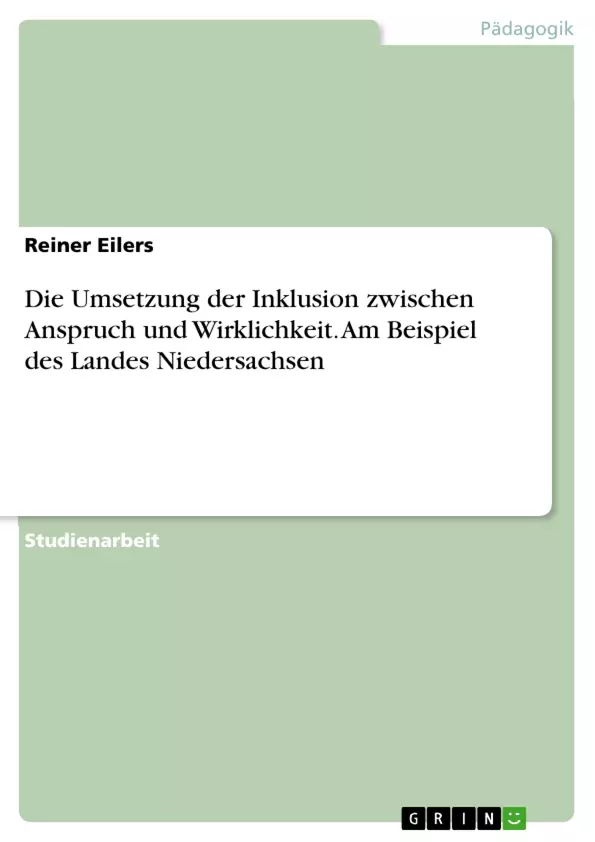Der Fokus dieser Seminararbeit liegt auf der Umsetzung der Inklusion im Bundesland Niedersachsen. Dabei soll die Divergenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit dieses Bildungsverständnisses dargestellt werden. Daher lautet der konkrete Untersuchungsschwerpunkt dieser Seminararbeit, inwieweit sich am niedersächsischen Bildungssystem der Zwiespalt zwischen Wirklichkeit und Anspruch in Bezug auf die Umsetzung der Inklusion zeigt. Als Untersuchungsmaterial dienen die Veröffentlichungen des Niedersächsischen Kultusministeriums.
Der Aufbau dieser Seminararbeit untergliedert sich in vier Kapitel. Nach der Einleitung werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen geschaffen, indem der Begriff der Inklusion definiert und die Behindertenrechtskonvention erläutert werden. Nachdem wichtige theoretische Aspekte für das bessere Verständnis dargelegt wurden, erfolgt in Kapitel 3 der Blick auf die konkrete Praxis der Umsetzung. Im Abschnitt 3.1 wird auf die rechtlichen Bestimmungen eingegangen, die Niedersachsen im Bereich der Inklusion normiert hat. Dabei ist der Blick in das niedersächsische Bildungsgesetz aus dem Jahr 2012 unerlässlich.
Nach der Klärung der rechtlichen Aspekte wird die Umsetzung in der Praxis beleuchtet. Mithilfe von Statistiken und Grafiken wird darauf eingegangen, wie inklusiv das niedersächsische Bildungssystem ist. Die wichtigsten Schlussfolgerungen und einen Ausblick auf die Zukunft und auf die damit verbundenen Herausforderungen für die Umsetzung der Inklusion werden im abschließenden Fazit dieser Seminararbeit dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Inklusion - Versuch einer Definition
- 2.2 Die UN-Behindertenrechtskonvention
- 3. Die Umsetzung der Inklusion in Niedersachsen
- 3.1 Die rechtlichen Grundlagen im niedersächsischen Schulsystem
- 3.2 Die Praktizierung der Inklusion in Niedersachsen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Umsetzung der Inklusion im niedersächsischen Bildungssystem. Ziel ist es, die Diskrepanz zwischen den gesetzlich festgehaltenen Ansprüchen und der realen Situation in der Praxis zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, inwieweit sich der Zwiespalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Bezug auf die Inklusion im niedersächsischen Schulsystem zeigt.
- Definition und theoretische Grundlagen der Inklusion
- Die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für das deutsche Bildungssystem
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Inklusion in Niedersachsen
- Praktische Umsetzung der Inklusion im niedersächsischen Schulsystem
- Herausforderungen und Zukunftsperspektiven für die Inklusion in Niedersachsen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- Kapitel 3: Die Umsetzung der Inklusion in Niedersachsen
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die Relevanz der Inklusion im niedersächsischen Bildungssystem. Sie führt das Zitat des Niedersächsischen Kultusministeriums ein und wirft die Frage nach der realen Umsetzung der Inklusion auf.
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Inklusion und erläutert die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für die Inklusion im deutschen Bildungssystem.
Kapitel 3 befasst sich mit der praktischen Umsetzung der Inklusion in Niedersachsen. Es analysiert die rechtlichen Grundlagen im niedersächsischen Schulsystem und beleuchtet die tatsächliche Situation der Inklusion in der Praxis anhand von Statistiken und Grafiken.
Schlüsselwörter
Inklusion, Diversität, Gerechtigkeit, Bildungssystem, UN-Behindertenrechtskonvention, Niedersachsen, Schulsystem, rechtliche Grundlagen, Praxis, Umsetzung, Herausforderungen, Zukunftsperspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Inklusion im niedersächsischen Bildungssystem?
Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Schüler, unabhängig von Behinderungen oder Förderbedarf, an regulären Schulen gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention.
Welche rechtliche Grundlage gilt für Inklusion in Niedersachsen?
Die wesentliche Grundlage ist das niedersächsische Bildungsgesetz aus dem Jahr 2012, das die Einführung der inklusiven Schule normiert hat.
Wo zeigt sich die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
Der Zwiespalt zeigt sich oft in mangelnden Ressourcen, unzureichender personeller Ausstattung und der Herausforderung, die theoretischen Vorgaben im Schulalltag umzusetzen.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention?
Sie bildet den völkerrechtlichen Rahmen, der Deutschland und damit auch Niedersachsen dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten.
Wie wird die Inklusion in der Praxis statistisch erfasst?
Die Arbeit nutzt Statistiken und Grafiken des Kultusministeriums, um den Grad der Inklusion und die Verteilung von Schülern mit Förderbedarf an Regelschulen aufzuzeigen.
Was sind die größten Herausforderungen für die Zukunft?
Dazu gehören die bedarfsgerechte Finanzierung, die Fortbildung der Lehrkräfte und die Schaffung barrierefreier Lernumgebungen für eine echte Bildungsgerechtigkeit.
- Citar trabajo
- Reiner Eilers (Autor), 2017, Die Umsetzung der Inklusion zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Am Beispiel des Landes Niedersachsen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366476