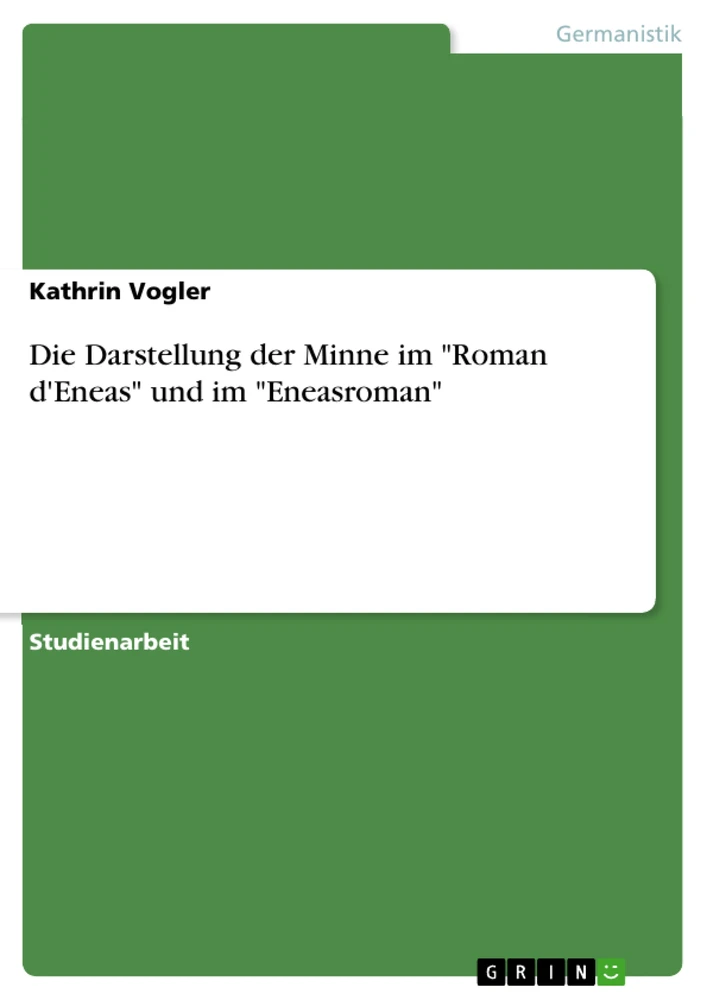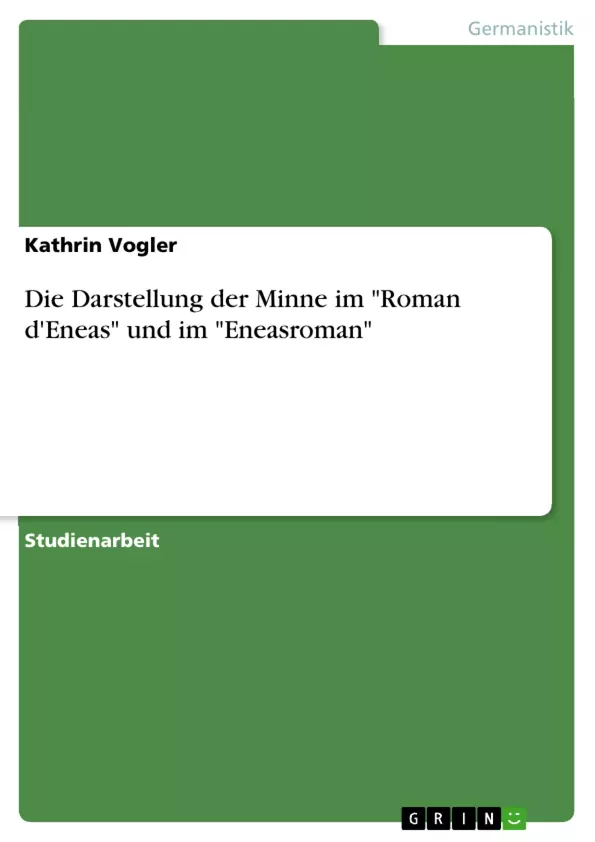„Die glückliche Liebe hat in der abendländischen Kultur keine Geschichte“, konstatiert der Schweizer Kulturhistoriker Denis de Rougement. Dieser Aussage kann man durchaus widersprechen, denn es gibt sehr wohl Geschichten einer glücklichen Liebe in unserer Kultur, und das bereits seit dem Mittelalter. Die Eneasromane, die inhaltlich an Vergils Aeneis angelehnt sind, erweitern die Geschichte der Gründung Roms um den Aspekt der Liebe, der bei Vergil nicht so ausführlich behandelt wird. Sowohl der Eneasroman Heinrichs von Veldeke, als auch der früher verfasste Roman d’Eneas , dessen Autor leider nicht bekannt ist, räumen den Minne-Episoden erheblichen Platz ein. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Minne-Thematik zu einem Hauptthema entwickelte bei der Betrachtung der Eneasromane.
Bereits Gottfried von Straßburg sagt in seinem Tristan über Veldeke: „wie wol er sang von minnen!“ und soll mit dieser Einschätzung nicht alleine bleiben, denn
„Heinrichs von Veldeke im 12. Jahrhundert entstandener Eneasroman gilt der Forschung von jeher als paradigmatischer Text, wenn es um die ihm impliziten Konzeptionen von Liebe und damit verbunden von Liebesentstehung geht.“
Ob Veldeke diesen Ruhm tatsächlich verdient, bleibt zu überprüfen, da sein ER, auch in den Minne-Episoden, schließlich die Handlung des RdE zugrunde liegen hat. Ob und inwiefern Veldeke hier von seiner französischen Vorlage abweicht, soll in dieser Arbeit durch einen Vergleich der beiden Minne-Episoden dargestellt und, wo dies möglich ist, begründet werden.
Die Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die beiden Minne-Episoden im RdE und im ER kontrastiv gegenüberzustellen, und strebt daher einen doppelten Vergleich an. Es soll hauptsächlich um die unterschiedliche Gestaltung der Dido- und der Lavinia-Minne gehen, die Eneas-Minne wird jedoch der Vollständigkeit wegen auch berücksichtigt. Abschließend soll eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse Aufschluss darüber geben, inwieweit Veldeke sich an die Vorgaben des RdE gehalten hat und wo er selbst kreativ am Werk war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Darstellung der Minne im Roman d'Eneas und im Eneasroman
- Entstehung der Minne
- Die Dido-Minne
- Die Lavinia-Minne
- Die Eneas-Minne
- Symptome der Minne
- Liebe als Krankheit
- Schlaflosigkeit
- Weitere Symptome
- Entstehung der Minne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Darstellung der Minne im Roman d'Eneas und im Eneasroman von Heinrich von Veldeke kontrastiv gegenüberzustellen. Der Fokus liegt auf der Entstehung und den Symptomen der Minne, wobei die Eneas-Minne zur Vollständigkeit ebenfalls berücksichtigt wird.
- Entstehung der Minne in den Eneasromanen: Betrachtung des Minne-Konzepts der höfischen Kultur, Analyse der Minneentstehung bei Dido, Lavinia und Eneas.
- Rolle von Magie bei der Entstehung der Minne: Analyse der Legitimation von Liebespassion durch magische Elemente.
- Symptome der Minne: Darstellung der spezifischen Symptome bei den drei Liebenden und deren Interpretation als Zeichen der Liebe.
- Kontrastive Analyse der Dido- und Lavinia-Minne im Roman d'Eneas und im Eneasroman.
- Kreativität von Veldeke im Vergleich zum Roman d'Eneas.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Minne in den Eneasromanen ein und stellt die Bedeutung der Minne-Episoden für die Gesamtwerke heraus. Sie erklärt die Forschungsgeschichte der Minne-Darstellung und definiert den Forschungsgegenstand der Arbeit.
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung der Minne in den Eneasromanen. Es untersucht die Rolle der höfischen Kultur, die verschiedenen Konzepte der Passion und die Legitimation von Liebespassion durch den Einsatz von Magie. Im Fokus stehen die Entstehung der Dido-Minne und die Frage, inwieweit die Liebe zwischen Eneas und Dido von den Göttern beeinflusst wird.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Symptomen der Minne, die in den Eneasromanen als unmittelbare Folge der Entstehung der Liebe auftreten. Es analysiert die Ausprägung dieser Symptome bei Dido, Lavinia und Eneas und interpretiert sie als Ausdruck der Minne.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung der Minne in zwei mittelalterlichen Eneasromanen: dem Roman d'Eneas und dem Eneasroman von Heinrich von Veldeke. Die zentralen Themen sind die Entstehung der Minne in der höfischen Kultur, die Rolle von Magie als Auslöser und Legitimation von Liebespassion, sowie die spezifischen Symptome der Minne bei den drei Liebenden Dido, Lavinia und Eneas.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Vogler (Autor:in), 2015, Die Darstellung der Minne im "Roman d'Eneas" und im "Eneasroman", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366479