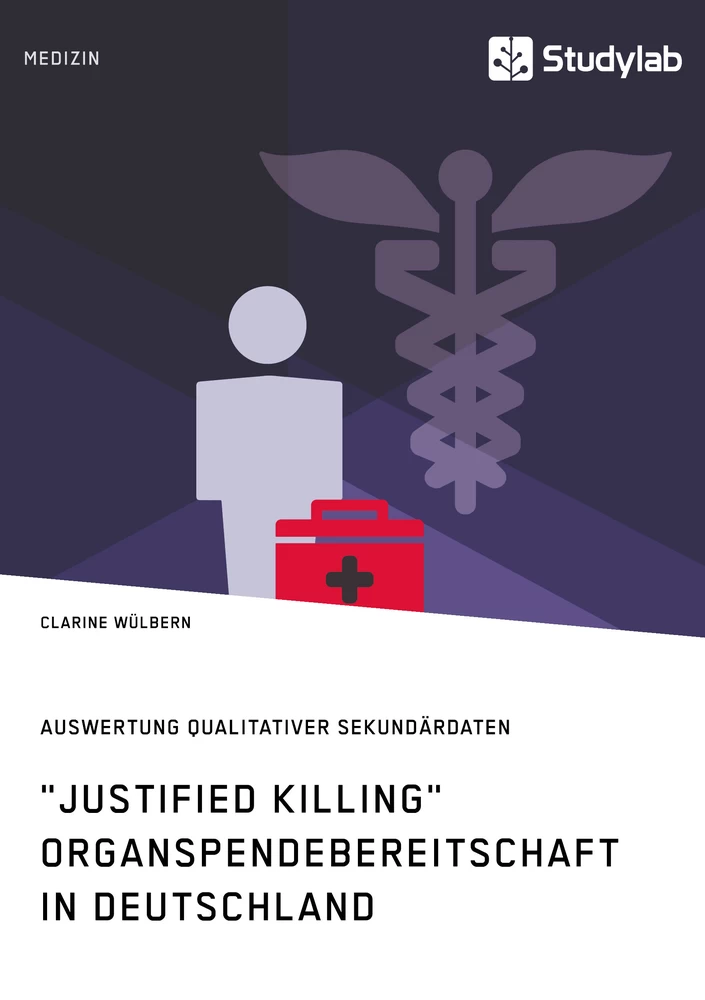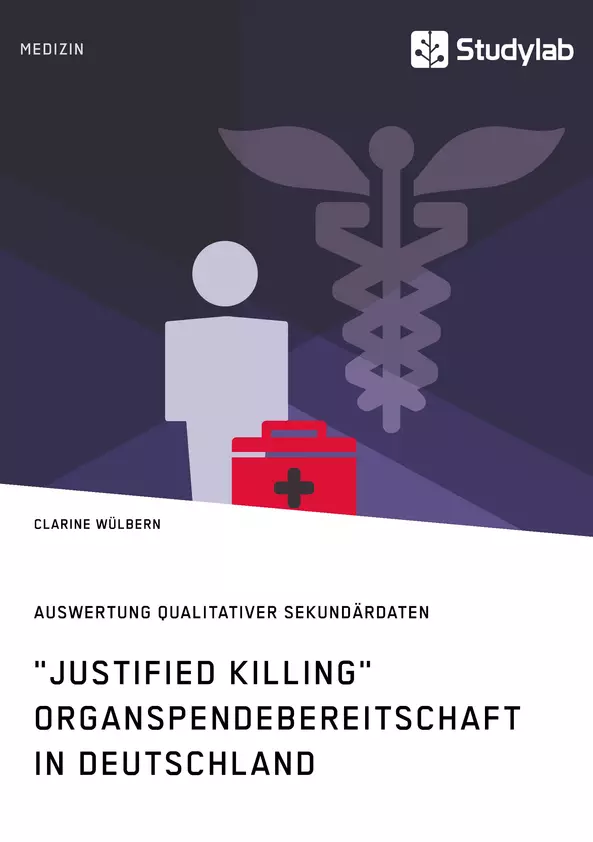Nach Aussagen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) warten 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Aber nur knapp ein Viertel der deutschen Bevölkerung besitzt einen Organspendeausweis. Dabei stellt sich die Frage, warum die Werbekampagnen durch die DSO und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) nicht in dem Maße greifen, wie es gewünscht wird.
Die Organspende bleibt ein Tabu, auch wegen verschiedener Manipulationsfälle. Eine wachsende Ablehnung bzgl. der Organspende ist die Folge. Auch aus diesem Grund ist es notwendig, die bisherigen Offensiven von DSO und BZgA neu zu überdenken, um das Vertrauen und die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung wiederzuerlangen.
Warum spenden Menschen ihre Organe nicht? Für dieses Buch hat die Autorin fünf Experteninterviews nach qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, um dieser Frage nachzugehen. Dabei hat sie neben der einseitigen Aufklärung über Organspende noch zwei weitere wesentliche und entscheidende Aspekte für die Beantwortung herausgearbeitet.
Aus dem Inhalt:
- Hirntod;
- Hirntodkritik;
- Organspendebereitschaft;
- Organtransplantation;
- Transplantationsgesetz
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Hintergründe
- 2.1 Organspende
- 2.2 Transplantationen
- 2.3 Organspende-Bereitschaft und Skandalisierung
- 2.4 Hirntod
- 2.5 Forschungsstand
- 2.6 Zusammenfassung
- 3 Methode
- 3.1 Sozialforschung
- 3.2 Datengrundlage
- 3.3 Qualitative Inhaltsanalyse
- 3.4 Datenauswertung
- 3.5 Induktive und deduktive Kategorienbildung
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Kategoriensystem
- 4.2 Organspende
- 4.3 Hirntodkonzept
- 4.4 Organspendeskandale
- 4.5 Dilemma Organspende
- 4.6 Philosophische und theologische Betrachtung
- 4.7 Entwicklungsperspektiven
- 4.8 Umsetzung Transplantationsgesetz
- 4.9 Zusammenfassung
- 5 Diskussion
- 5.1 Beantwortung der Forschungsfrage
- 5.2 Methodenkritik
- 5.3 Hirntodkritik
- 5.4 Ergebniskritik
- 6 Ausblick
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Organspendebereitschaft in Deutschland anhand qualitativer Sekundärdaten. Ziel ist es, die komplexen Faktoren zu beleuchten, die die Entscheidung für oder gegen eine Organspende beeinflussen. Die Studie analysiert verschiedene Perspektiven und Problemfelder im Kontext der Organspende.
- Faktoren, die die Organspendebereitschaft beeinflussen
- Das Hirntodkonzept und seine gesellschaftliche Akzeptanz
- Ethische und philosophische Fragen der Organspende
- Die Rolle von Organspendeskandalen in der öffentlichen Wahrnehmung
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Organspendebereitschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Organspendebereitschaft in Deutschland ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit. Sie beschreibt die Relevanz des Themas und die Notwendigkeit weiterer Forschung.
2 Theoretische Hintergründe: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen der Organspende, einschließlich der Definition von Organspende und Transplantation, der Herausforderungen der Organspendebereitschaft und der Skandalisierung, des Hirntodkonzepts und des aktuellen Forschungsstands. Es bildet die Basis für die spätere Analyse der qualitativen Daten.
3 Methode: Das Kapitel beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise der Studie. Es erläutert die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse als Forschungsmethode, die Auswahl und Bearbeitung der Datengrundlage, sowie die angewendeten Verfahren der Datenanalyse und der induktiven und deduktiven Kategorienbildung.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse. Es beschreibt das entwickelte Kategoriensystem, die Ergebnisse zur Organspende, zum Hirntodkonzept, zu Organspendeskandalen, zum Dilemma der Organspende und zur philosophischen und theologischen Betrachtung. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und mit relevanten Beispielen aus den Daten belegt. Der Abschnitt zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes analysiert die praktischen Implikationen der gesetzlichen Regelungen.
5 Diskussion: Die Diskussion befasst sich mit der Beantwortung der Forschungsfrage, einer kritischen Reflexion der gewählten Methode, einer Auseinandersetzung mit der Kritik am Hirntodkonzept und einer kritischen Bewertung der Ergebnisse. Es werden Stärken und Schwächen der Studie reflektiert und Ausblicke auf weitere Forschungsfragen gegeben.
Schlüsselwörter
Organspende, Organspendebereitschaft, Transplantation, Hirntod, Ethik, Theologie, Qualitative Inhaltsanalyse, Sekundärdaten, Deutschland, Transplantationsgesetz, Organspendeskandale.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Organspendebereitschaft in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Organspendebereitschaft in Deutschland anhand qualitativer Sekundärdaten. Sie beleuchtet die komplexen Faktoren, die die Entscheidung für oder gegen eine Organspende beeinflussen, und analysiert verschiedene Perspektiven und Problemfelder im Kontext der Organspende.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Faktoren, die die Organspendebereitschaft beeinflussen, dem Hirntodkonzept und seiner gesellschaftlichen Akzeptanz, ethischen und philosophischen Fragen der Organspende, der Rolle von Organspendeskandalen in der öffentlichen Wahrnehmung und Möglichkeiten zur Verbesserung der Organspendebereitschaft.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten. Das Kapitel "Methode" beschreibt detailliert die Auswahl der Daten, die Datenanalyse und die angewandte Kategorienbildung (induktiv und deduktiv).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Danksagung, Vorwort, Einleitung, Theoretische Hintergründe (inkl. Organspende, Transplantationen, Organspende-Bereitschaft und Skandalisierung, Hirntod, Forschungsstand, Zusammenfassung), Methode (inkl. Sozialforschung, Datengrundlage, Qualitative Inhaltsanalyse, Datenauswertung, Induktive und deduktive Kategorienbildung), Ergebnisse (inkl. Kategoriensystem, Organspende, Hirntodkonzept, Organspendeskandale, Dilemma Organspende, Philosophische und theologische Betrachtung, Entwicklungsperspektiven, Umsetzung Transplantationsgesetz, Zusammenfassung), Diskussion (inkl. Beantwortung der Forschungsfrage, Methodenkritik, Hirntodkritik, Ergebniskritik), Ausblick, Literaturverzeichnis und Anlagen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, detailliert dargestellt und mit Beispielen belegt. Es umfasst u.a. das entwickelte Kategoriensystem, Ergebnisse zu Organspende, Hirntodkonzept, Organspendeskandalen, dem Dilemma der Organspende, philosophischen und theologischen Betrachtungen sowie die Umsetzung des Transplantationsgesetzes.
Wie wird die Forschungsfrage beantwortet?
Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt im Diskussionskapitel. Dieses Kapitel beinhaltet zudem eine kritische Reflexion der Methode, Auseinandersetzung mit der Hirntodkritik und eine kritische Bewertung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Organspende, Organspendebereitschaft, Transplantation, Hirntod, Ethik, Theologie, Qualitative Inhaltsanalyse, Sekundärdaten, Deutschland, Transplantationsgesetz, Organspendeskandale.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Das Kapitel "Theoretische Hintergründe" liefert einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen der Organspende, einschließlich der Definition von Organspende und Transplantation, Herausforderungen der Organspendebereitschaft und der Skandalisierung, des Hirntodkonzepts und des aktuellen Forschungsstands. Es bildet die Basis für die Datenanalyse.
- Citation du texte
- Clarine Wülbern (Auteur), 2013, "Justified Killing". Organspendebereitschaft in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366508