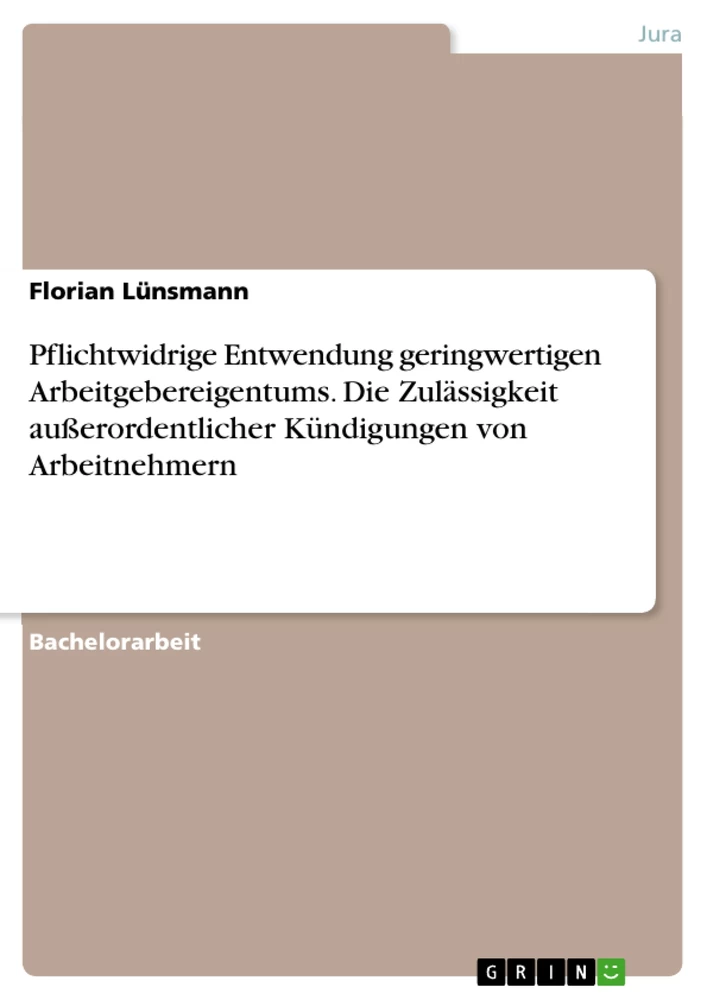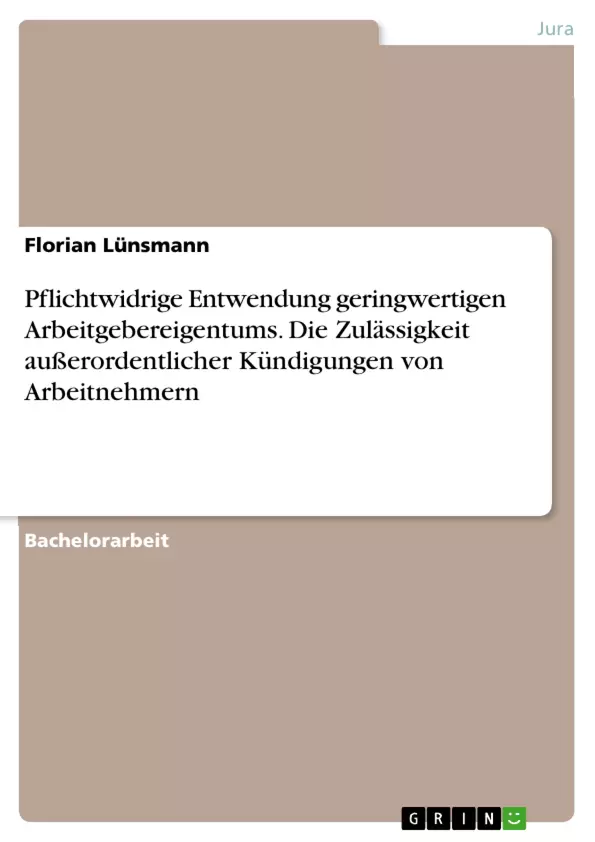Diese Arbeit soll darstellen, unter welchen Umständen eine außerordentliche Kündigung wegen pflichtwidrigem Entwenden geringwertigen Arbeitgebereigentums zulässig ist. Die bisherige Rechtspraxis soll durchleuchtet und kritisch hinterfragt werden. Dabei soll auch die Forderung nach Einführung einer Erheblichkeitsschwelle für Bagatelldelikte erörtert werden.
„Wer klaut, der fliegt“, so wurde zu Teilen die strenge Linie der Rechtsprechung seit dem grundlegenden „Bienenstich“-Urteil aus dem Jahre 1984 bei Kündigungen wegen geringwertiger Vermögensdelikte gegen das Arbeitgebereigentum interpretiert. In den letzten Jahren häuften sich in den Medien Berichte über Fälle, in denen Arbeitnehmern wegen geringfügiger Vermögensdelikte gekündigt wurde. Diese Sachverhalte und insbesondere der sog. „Emmely“-Fall, in dem einer Kassiererin wegen des pflichtwidrigen Einlösen zweier Pfandbons im Wert von 1,30 EUR gekündigt worden war, lösten in der Gesellschaft eine Gerechtigkeitsdebatte über die Wirksamkeit von Kündigungen wegen sog. Bagatelldelikten aus. Die gesellschaftspolitische Diskussion gab zudem den Anstoß zu drei inzwischen gescheiterten parlamentarischen Initiativen der damaligen Opposition. Diese sahen alle im Wesentlichen vor, dass einer außerordentlichen Kündigung wegen eines geringfügigen Vermögensdelikts eine Abmahnung vorausgehen müsse.
Im Zusammenhang mit der Überlegung, bis zu welchem Wert ein Vermögensdelikt geringfügig ist, wurde in der Literatur auch die Einführung einer Bagatellgrenze diskutiert. Ihre vereinzelte Forderung wurde mit Wertungswidersprüchen gegenüber der Rechtspraxis der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichte begründet. Die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte im Umgang mit geringwertigen Vermögensdelikten gegen den Arbeitgeber lässt keine absolut klare Linie erkennen. So hat exemplarisch der einmalige Verzehr eines Bienenstichs eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt, der Diebstahl dreier Kiwis aber nicht. Jedoch sei erkennbar, dass solche Delikte in der Regel eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Allgemeines zu § 626 BGB
- C. Der „wichtige Grund“
- I. Zweistufiges Prüfungsschema der Rechtsprechung
- II. Kritik an der Zwei-Stufen-Theorie
- III. Strukturierung des wichtigen Grundes Bildung von Fallgruppen
- 1. Systematisierung nach Art der Kündigungsgründe
- 2. Systematisierung der Kündigungsgründe nach ihrer Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis
- D. Geringwertige Vermögensdelikte als „an sich“ wichtiger Grund
- I. Wertungswidersprüche und die Einführung von Bagatellgrenzen
- 1. Wertungswidersprüche zum Strafrecht?
- 2. Wertungswidersprüche zur Zivilgerichtsbarkeit?
- 3. Wertungswidersprüche zur Verwaltungsgerichtsbarkeit?
- 4. Wertungswidersprüche zu anderen Kündigungsgründen?
- 5. Weitere Argumente für und gegen die Einführung einer Bagatellgrenze
- II. Stellungnahme
- I. Wertungswidersprüche und die Einführung von Bagatellgrenzen
- E. Interessenabwägung bei geringwertigen Vermögensdelikten
- I. Das Prognoseprinzip
- II. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip
- 1. Ordentliche Kündigung als milderes Mittel
- 2. Abmahnung als milderes Mittel
- F. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Zulässigkeit außerordentlicher Kündigungen von Arbeitnehmern aufgrund der pflichtwidrigen Entwendung geringwertigen Arbeitgebereigentums. Dabei wird die Rechtsprechung zum „wichtigen Grund“ im Sinne von § 626 BGB analysiert und kritisch betrachtet.
- Das zweistufige Prüfungsschema der Rechtsprechung
- Die Bedeutung des „wichtigen Grundes“ bei Vermögensdelikten
- Die Rolle von Bagatellgrenzen bei geringwertigen Vermögensdelikten
- Die Interessenabwägung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Die Anwendung des Prognose- und Verhältnismäßigkeitsprinzips
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der außerordentlichen Kündigung und den „wichtigen Grund“ im Sinne von § 626 BGB ein. Kapitel B erläutert die allgemeine Bedeutung von § 626 BGB und dessen Anwendung im Arbeitsverhältnis. Kapitel C behandelt das Konzept des „wichtigen Grundes“ in der Rechtsprechung, inklusive des zweistufigen Prüfungsschemas und der Kritik an dessen Anwendung. Kapitel D analysiert die Bedeutung geringwertiger Vermögensdelikte als Kündigungsgrund, wobei die Wertungswidersprüche zum Strafrecht, zur Zivilgerichtsbarkeit und zu anderen Kündigungsgründen beleuchtet werden. Das Kapitel schließt mit einer Stellungnahme zum Thema Bagatellgrenzen. Kapitel E fokussiert auf die Interessenabwägung bei geringwertigen Vermögensdelikten, wobei das Prognose- und Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie die Rolle der Abmahnung als milderes Mittel analysiert werden. Das Fazit soll die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenfassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie außerordentliche Kündigung, „wichtiger Grund“ nach § 626 BGB, geringwertige Vermögensdelikte, Bagatellgrenzen, Interessenabwägung, Prognoseprinzip, Verhältnismäßigkeitsprinzip, Abmahnung als milderes Mittel.
Häufig gestellte Fragen
Ist eine Kündigung wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zulässig?
Grundsätzlich ja. Nach der Rechtsprechung (z. B. „Bienenstich-Urteil“) kann auch die Entwendung geringwertiger Güter das Vertrauensverhältnis so schwer schädigen, dass eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt ist.
Was war der „Emmely-Fall“?
In diesem Fall wurde einer Kassiererin wegen der Einlösung zweier Pfandbons im Wert von 1,30 Euro gekündigt. Der Fall löste eine bundesweite Debatte über die Verhältnismäßigkeit von Kündigungen bei Bagatelldelikten aus.
Gibt es eine rechtliche Bagatellgrenze bei Kündigungen?
Nein, eine feste Euro-Grenze existiert nicht. Die Arbeitsgerichte entscheiden im Einzelfall durch eine Interessenabwägung, wobei das Prognoseprinzip und die Dauer der Betriebszugehörigkeit eine Rolle spielen.
Wann reicht eine Abmahnung statt einer Kündigung aus?
Eine Abmahnung ist als milderes Mittel vorzuziehen, wenn davon auszugehen ist, dass das Vertrauensverhältnis noch nicht unwiederbringlich zerstört ist und der Arbeitnehmer sein Verhalten künftig ändern wird.
Was bedeutet das Prognoseprinzip im Arbeitsrecht?
Eine Kündigung dient nicht der Bestrafung für vergangenes Verhalten, sondern der Vermeidung künftiger Störungen. Es muss die Prognose bestehen, dass eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist.
- Citation du texte
- Florian Lünsmann (Auteur), 2016, Pflichtwidrige Entwendung geringwertigen Arbeitgebereigentums. Die Zulässigkeit außerordentlicher Kündigungen von Arbeitnehmern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366632